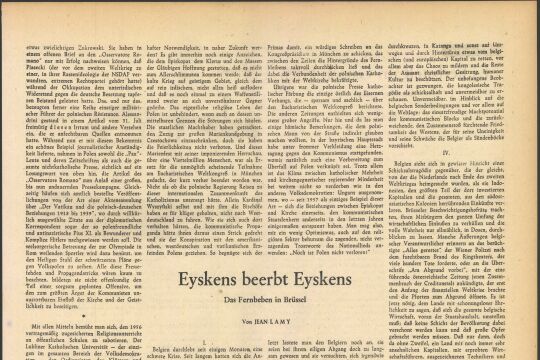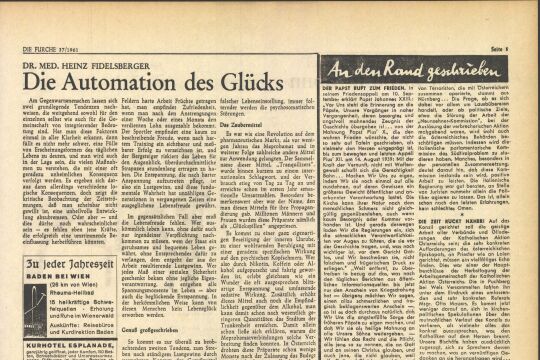Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randhemerkungen zur woche
DER. NEUE BUNDESMINISTER FÜR JUSTIZ, Dr. Hans Kap f er, Uat einen guten, wenn nicht sogar einmaligeit Start. Von der Sozialistischen Partei nominiert, wurde er als „hervorragender Fachmann“ von der Volkspartei begrüßt. Ganz zu schweigen: der Beifall, den die nicht parteigebundene Presse dieser Wahl zollte. Die Sozialistische Partei war gut beraten, als sie sich zu diesem Entschluß durchgerungen hat. Er zeigt eines deutlich: der Ruf nach dem gediegenen Fachmann in bestimmten Ressorts verhallt nicht mehr ungehört. Es ist heute bereits unmöglich, ihn in den Wind zu schlagen — eine Befriedigung für alle, die seit Jahren zuerst als einsame Prediger in der Wüste diese Forderung erhoben haben. Und so darf mit gutem Recht die „Furche“ sich sagen: „Wir waren auch dabei und haben's auch gewollt.“
TR1EST ODER BREMEN? Die Frage rührt an eine der Lebensfragen Triests als Hafenstadt, aber auch an ein sehr ernstes Problem österreichischer Wirtschaft und österreichischer Verkehrs- und Handelspolitik. Nicht umsonst hat ein an der Grazer Handelskammer gebildetes „Triester Komitee“ — eine an und für sich schon ungewöhnliche, auf eine starke Verknüpfung österreichischer Interessen hinweisende Erscheinung — ein Programm entworfen, das einer bereits fälligen aktiven österreichischen Verkehrsund Handelspolitik die Wege weist. 1953 betrug die Gesamttonnage des österreichischen Warenverkehrs von und nach Triest 1,408.000 Tonnen, die aller übrigen Staaten nur 590.127 Tonnen, so daß Oesterreich weit mehr als die Hälfte des gesamten über den Triester Hafen gehenden Warenverkehrs bestritt. Aber so ansehnlich der österreichische Anteil noch immer ist, so zeigt er doch eine auffallende Abnahme gegenüber den Jahren vor und nach dem zweiten Weltkrieg, da Oesterreich vier Fünftel des Gesamtumschlags des Triester Hafens besorgte. In den letzten vergangenen Jahren wurde der Rückgang durch die Ablenkung erheblicher Frachtmengen von Triest nach Bremen hervorgerufen und dies zufolge der auffallenden, zum offenkundigen Schaden von Triest geführten T a r i f p o 1 i-tik der italienischen Staatsbahn. In seinem jüngst erschienenen aufschlußreichen „Mitteilungsblatt“ notiert das Forschungsinstitut für Fragen des Donauraumes, daß zufolge dieser Tarifpolitik der österreichische Verfrachter sich veranlaßt sieht, den Weg über die Nordsee zu wählen, weil die Fracht auf dieser viel längeren Strecke billiger ist als auf der kurzen nach und von Triest und dieser Vorteil auch dann noch besteht, wenn es sich, wie zumeist, um die für die österreichische Ausfuhr namentlich in Betracht kommenden Hafenplätze des Nahen und Mittleren Orients handelt. Zudem hat die „fortschreitende technische Vervollkommnung der Nordseehäfen und deren großes Entgegenkommen Interessenten gegenüber“, wie das Organ des Forschungsinstituts vermerkte, „eine neue Lage geschaffen“. Sollte Italien ernstlich entschlossen sein, die Interessen Triests zu fördern, so wird es nicht umhin können, handelspolitische Gespräche mit Oesterreich über Triest zu beginnen. Erleichtert würde für Italien dieses Gespräch besonders dann, wenn es sich an die Worte des derzeitigen Staatspräsidenten Luigi Ein au di erinnert, der bereits 1915 schrieb: .Triest würde den größten Teil seines Wertes an dem Tage verlieren, an welchem es von dem österreichischen und slawischen Hinterland abgetrennt und an Italien angegliedert würde.“
DIE SCHWERE KRISE DER BEZIEHUNGEN ZWISCHEN BELGIEN UND SPANIEN zeigt, wie leicht alte Wunden in Europa aufbrechen können. Fürst de Eigne, Sproß einer in Wien und Altösterreich wohlbekannten Familie, Botschafter Belgiens in Madrid, wird nicht nach Spanien zurückkehren, bevor nicht eine Antwort der spanischen Regierung auf die letzte belgische Demarche in Brüssel eingetroffen ist. Also fast ein Abbruch der diplomatischen Beziehungen! Was ist geschehen? „Eine unzeitgemäße Lappalie“, so urteilten auf den ersten Blick femstehende Mitteleuropäer: Belgien hatte von Spanien die Auslieferung des Führers fer faschistischen Rex-Bewegung, Leon Degrelle, verlangt, der in der Fremdenlegion der Waffen-SS einen hohen Rang bekleidet hatte und 1945 nach Spanien geflüchtet war. Spanien hat diese Auslieferung abgelehnt mit der Bemerkung, Degrelle befinde sich nicht in Spanien. Darin erblickte die belgische Regierung einen schweren Affront, da Degrelle in Spanien bei einer Parade erkannt worden war. Nun ging die Sache wie ein Lauffeuer schnell an die Oeffentlichkeit, über Nacht erhitzten sich die Leidenschaften, die Erinnerung an schreckliche Tage und Jahre stiegen auf: belgische Flüchtlinge vor Hitler wurden von Spanien an Hitler, in den Tod ausgeliefert; den nach Belgien geflüchteten katatonischen Regierungschef Companys übergaben die Rexisten der Gestapo, diese überstellte ihn nach Spanien, wo dieser führende Republikaner hingerichtet wurde. Die ehemaligen belgischen Häftlinge spanischer Konzentrationslager, die im zweiten Weltkrieg in seinem Fortschreiten allmählich an England übergeben wurden und die heute in Belgien oft an einflußreichen Stellungen stehen, erinnern das belgische Volk an ihre Erlebnisse in Spanien. Da taucht nun aus den schweren Schatten der Vergangenheit die Erinnerung herauf an das Wirken der spanischen Inquisition und der spanischen Besatzungstruppen in den wallonischen Niederlanden, im deutschen Raum wohlbekannt durch Schillers Schilderung und Goethes Fgmont, in Belgien wach erhalten durch ein militant antiklerikales Bürgertum . Auf diese umfangreichen Anschuldigungen erwidert nun Spaniens Presse mit einer Gegenrechnung. An der Spitze ihrer Posten iteht das Denkmal, das die Brüsseler Stadtverwaltung vor 1914 dem 1909 in Barcelona hingerichteten spanischen Anarchisten Francisco Ferrer errichtet hat. Kulturkampfatmosphäre, Resistanceerfahrungen und uralte Ressentiments brachen also da auf beiden Seife jetzt auf. — Die schwere Spannung zwischen Belgien und Spanien wird offensichtlich in absehbarer Zeit behoben werden. Für ganz Europa wichtig ist eine Lehre, die sich aus diesen Vorfällen für alle Europäer ergibt, nicht nur für die berufsmäßigen Einiger und Vereiniger: es kann gar nicht behutsam genug vorgegangen werden bei der wirklichen Zusammenführung der europäischen Völker unter sorgfältigster Rücksichtnahme auf alte und junge Narben, die fast alle Völker in fernerer und naher Vergangenheit erlitten haben.
WAS EIN MUSTANG IST, weiß jeder Schüler, der Indianergeschichten liest-, was aber das Wort sonst bedeutet, weiß nur „der Große“. Das aus dem Spanischen kommende Wort heißt soviel wie „verwildert“. Die Geschichte von den fünfundzwanzig Mustangs, die neuerdings den Außenpolitikern in der Alten und Neuen Welt zu schaffen machen, hat nichts mit verwilderten Präriepferden zu tun. Diese Mustangs wollten nicht in den Hangars der schwedischen Luftwaffe rasten, was in diesem Falle wirklich rosten bedeutet. Und so kamen die fünfundzwanzig Kampfflugzeuge, die in der Alten Welt ausgedient hatten, aber für die Neger und Mestizen in Nikaragua noch allerhand leisten konnten, vermutlich nach alter, trauter Weise als „Maschinen“ oder „Eisenerz“ über den Atlantik Man kennt also die Weise noch von Guatemala her und hat diesmal bloß einen neuen Text unterlegt. Nun: so einfach ist die Sache wirklich nicht! Man schuf seit dem ersten Weltkriege eine stattliche Zahl von Abkommen, von internationalen Organisationen, und man ächtete die Aggression — hat man also auf die Aechtung des Geschäfts vergessen? In Nikaragua mag die soziale Lage zu wünschen übriglassen, in dem von ihm bedrohten Kostarika mag sie besser sein: in beiden Staaten aber ist die Mehrzahl der Menschen, ob dunkelhäutig, ob weiße Oberschicht, katholisch. In Kostarika sind es 95 Prozent mit einem Erzbistum in San Jose, in Nikaragua besteht ebenfalls ein Erzbistum in Managua. Menschen der gleichen Religion, des gleichen Lebenskreises sollen also, weil eine internationale Waffenprofltwirtschaft es tragbar erachtet, unter die Hufe — wollte sagen Tragflächen — der Mustangs kommen.
EINE CHARAKTERISTIK DES NEUEN JAPANISCHEN PREMIERMINISTERS erhält „Die Furche“ aus Japan: Nach acht Jahren voll von bitteren Enttäuschungen konnte Ichiro Hatoyama seinen Traum, die Zügel der Regierung in den Händen zu halten, verwirklichen; wenigstens für eine kurze Zeit. Ob er fähig sein wird, seine Position nach den Wahlen im März oder April zu halten, hängt davon ab, ob er aus den Fehlern und Irrtümern der Vergangenheit in seinem Leben genug gelernt hat. Er hat viele Qualitäten, die ihn zu einem erfolgreichen Politiker befähigen, so einen hervorragenden Intellekt, eine anziehende Persönlichkeit und eine gute Familien-tradition. Der Vater des jetzigen Premiers wurde von der Regierung zur Zeit der Meiji-Dynastie aus den talentiertesten jungen Männern ganz Japans ausgewählt, um als einer der ersten in Amerika zu studieren. Der Premier selbst machte sein Abschlußexamen auf der Kaiserlichen Universität in Tokio als Dritter. Aber der Premier hat nicht alle Fähigkeiten, um ein guter Politiker zu sein. Da sind gewisse Charakterzüge, die wohl für den Menschen der Straße sehr gut sind, aber für einen Politiker sehr tragisch werden können. An erster Stelle ist da seine Leichtgläubigkeit zu erwähnen, dann das Fehlen eines starken Willens und ein Hang zur Bequemlichkeit. So kann man wohl sagen, er ist sich selbst der größte Feind. Seine politische Karriere begann er mit 32 Jahren. Im Alter von 4t Jahren wurde er Erziehungsminister in zwei Regierungen. Hatoyamas Mißgeschick in der Zeit nach dem Krieg läßt sich zurückführen auf seine erste Begegnung mit Yoshida in London. Yoshida war damals Gesandter in England. Angeregt durch die Gleichheit der Gedanken über die Weltlage, kam es zu einer Freundschaft zwischen beiden, wenigstens von seiten Hatoyamas. Niemand anderer als Hatoyama war es auch, der entgegen mancher Widerstände Yoshida bewog, in die Politik zu gehen. Hier sollte Yoshida so lange wirken, bis das für Hatoyama von den Amerikanern ausgesprochene Verbot der politischen Betätigung aufgehoben werde. Anfangs zögerte Yoshida, auf dieses einzugehen, sagte aber am Schlüsse doch zu. In den folgenden zwei, drei Jahren hatten Yoshida und Hatoyama öfter nächtliche Zusammenkünfte, und es schien, als wären die beiden gleich Brüdern — bis Yoshida begann, weniger Interesse für Hatoyama zu zeigen. Hatoyama bekam nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages wieder seine politische Freizügigkeit zurück. Doch Yoshida hielt an seiner Position als Premier und Haupt der Liberalen Partei fest. Er hatte Geschmack an der Macht gefunden. Hatoyama ging sofort daran, eine eigene Partei zu gründen, die sogenannte Splitter-Liberalpartei. Die Regierung Hatoyamas wird nicht die Regierung eines einzigen Mannes sein, wie es Yoshidas Regierung war. Die Frage der Dauer Hatoyamas Regierung ist, ob er gelernt hat, nicht immer allen möglichen Schmeichlern und Schmarotzern Gehör zu schenken, sondern mit starkem Willen das richtig Erkannte auch durchzuführen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!