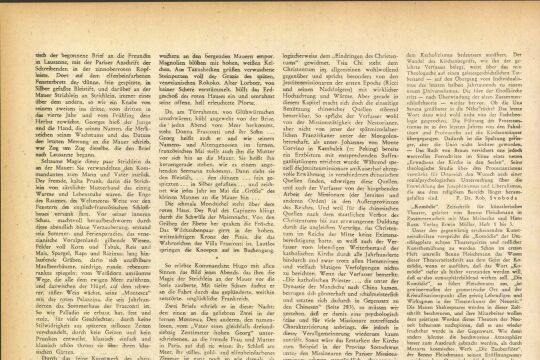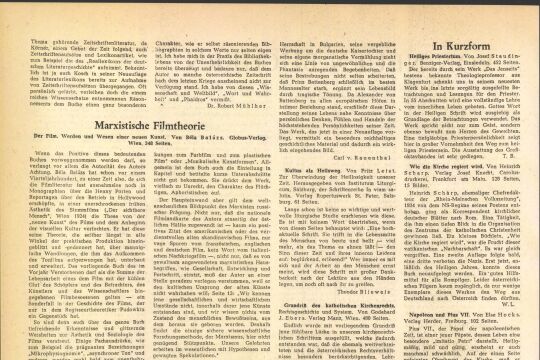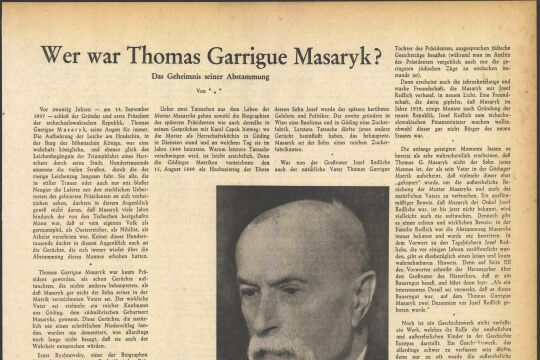Reizend und aufreizend
Kleine Geschichte Frankreichs. Von Friedrich Sieburg. Verlag Heinrich Schettler, Frankfurt a. M. 192 Seiten, Preis 7.80 DM
Kleine Geschichte Frankreichs. Von Friedrich Sieburg. Verlag Heinrich Schettler, Frankfurt a. M. 192 Seiten, Preis 7.80 DM
Berühmt als Verfasser jenes „Wie Gott in Frankreich“, das gar manchen rückschauend der Auftakt zum spateren Werben versuchender Teufel um Frankreichs Seele schien, hat uns nun Friedrich Sieburg dieses reizende und aufreizende Büchlein geschenkt, in dem uns kaum eines der geflügelten Worte und der längst flügellos am Boden schleifenden Anekdoten geschenkt wird, die in der Vorstellung des Durchschnittsgebildeten zu Gallien gehören, wie das Gulasch, der Paprika und die Zigeuner zu Ungarn, der Heurige und die Gemütlichkeit zu Wien, das Phlegma, die Perfidie und das Geld zu Albion. In dieser mit hin- und herreißendem Schmiß erzählten Vi e quelque peu romancee der Person Frankreich stecken viel Witz, einiges, was an Esprit gemahnt, zu viel Schnoddrigkeit, doch auch, Gott in Frankreich sei Dank, ein Gemisch aus tiefer Kenntnis und hohem Verkennen des französischen Wesens. Loben wir das Bemühen um die Erfassung entscheidender Züge dieser Art: des immer wieder Neuerung begehrenden, doch nie seiner Ursprünge uneingeden-ken Konservativismus, des Gemenges aus harter, erdnaher Bauernschlauheit und liebenswürdigem Leichtsinn, des Pathos ohne Distanz und der nicht einmal sich selbst ernstnehmenden Ironie. Erfreuen wir uns an ein paar mit knappen Strichen meisterhaft gezeichneten Porträts, an glücklichen Formeln und vordringlich an den mit lateinischer Klarheit herausgearbeiteten Grundlinien einer Entwicklung, bei der, vom Deutschen Sieburg offenkundig in verstehend-verzeihender Haßliebe bewundert, Jacques Bainville und Gaxotte stärkeren Einfluß geübt haben, als die sonst dem Autor weltanschaulich verwandteren linksbürgerlichen Lavisse und Seignobos. In den Schlußkapiteln, den weitaus besten des Buches, bewährt Sieburg reichlich seine Einzelkenntnisse und seine Urteilskraft. Am schwächsten sind die Anfänge geraten. Wenn da auf zwei Seiten über ein Halbjahrtausend gallischer und gallo-römischer Geschichte hinwegvolti-giert wird, zudem und vordem ein anderes Halbjahrtausend, durch die Archäologie schön aufgehellter, Vor- und Frühgeschichte mit einem Vorwand unter der Bewußtseinsschwelle versinken, dann finden wir darin eine unverzeihliche Abwandlung des „G r a e c a sunt, non leguntur“. Der geschätzte Biograph von Madame la France erklärt deren Vorgeschichte für „unerheblich“, da von ihr kaum Zeugnisse und keine Einrichtungen geblieben sind. Frankreichs Geschichte habe mit dem Erscheinen der Römer in Gallien eingesetzt. Girade das Gegenteil ist wahr. Alle Elemente des späteren französischen Werdens sind in jeher durch Camille Jullien, Grenier und andere Historiker in ■glänzenden Synthesen dargestellten Frühzeit, ja zum Teil schon in der von Breuil und seiner Schule, von Montandon oder Wartburg durchleuchteten Vorzeit enthalten. Man sollte nicht so einfach über jene Ur-Epochen hinweg. Auf wenigen Seiten könnte, sollte mehr, und jedenfalls anderes gesagt werden, als etwa die Boutade, die Gallier seien „schnauzbärtige Gesellen“ gewesen, die „in rauhhaarigen Hosen staken“, „also unruhige und kriegerische Barbaren“. Es gehört ferner zu den, schon von Anbeginn her deutlichen, Mängeln des Werkchens, daß die religiösen Aspekte zu kurz kommen. Die „G a 11 i a Christian a“, Voraussetzung künftiger, von Sieburg ein wenig voltairia-nisch, ein wenig marxistisch und überhaupt oberflächlich behandelter „Gesta Dei per Fran-e o s“, ist kaum mit dem einen Satz: „Das Christentum kam schon im 2. Jahrhundert ins Land und schuf sich Sitze in Lyon und Vienne“, zu erledigen. Wir vermögen natürlich nicht, Sieburg auf alle Eilzugstationen seiner Blitzfahrt durch eineinhalb Jahrtausende französischer Vergangenheit kommentierend und kritisch zu begleiten. Stichprobenweise sei angemerkt, daß die „Gründe, die dazu führten, daß Karl den Kaisertitel annahm“, keineswegs so unklar sind, wie das der Autor behauptet. Sieburg berührt mit keinem Wort die so wichtige Frage, warum den Merowingern die Karolinger, und diesen die Kapetinger gefolgt sind: nämlich infolge genealogischer Verknüpfung und eines heute vergessenen Prinzips, der Gleichberechtigung des Mannesstamms mit dem weiblichen. Er meint irrig, daß die theoretisch fortdauernde Wählbarkeit des französischen Königs schon unter Hugo Capet abgekommen sei. Er sieht nicht recht ein, was sich an schwerwiegenden sachlichen Motiven hinter dem Zwist birgt, zu dem die Liebesabenteuer der schönen Eleonore von Poitou den scheinbaren Anlaß boten. Doch dafür werden wir durch eindrucksame Sätze, über die mittelalterliche Geistigkeit Frankreichs in den Tagen der Kathedralenerbauer, entschädigt.
Leider haut das Richtschwert des Verfassers wieder daneben, wenn es Bonifaz VIII. den angeblich zu eigensinnigen Kopf posthum abhaut und er sieht die Templerangelegenheit als unverwüstlicher Rationalist. Sehr schön danach die Schilderung aus der Herbstpracht des Mittelalters. Etienne Marcel und die Burgunderherzoge haben es, jedesmal aus voneinander verschiedenen Ursachen, Sieburg angetan. Jacques Coeur dagegen vermag dessen künstlerisch reizsame Phantasie weniger anzuregen. Die Zeilen über Froissart sind ein Kabinettstück, die über die meisten Episoden des Hundertjährigen Krieges nicht minder. Jeanne d'Are, Ludwig XI. werden etwas schablonengemäß gezeichnet, doch mit den Farben einer nuancenreichen Palette. Diese funkeln in dem Sang vom italischen Abenteuer der späten Valois, im Gemälde aus der französischen Renaissance der galanten Damen und der ritterlichen, nicht weniger galanten Herren.
Des Verfassers Sympathien schwanken gegenüber Veranstaltern und Opfern der Bartholomäusnacht, doch er huldigt dem sehr streitbaren Heinrich IV. mit einer Begeisterung, deren die kühle Verneigung vor dem säkularen Genie und der sittlichen Größe eines Richelieu darbt. Auch mit Mazarin und mit Ludwig XIV. ist Sieburg eher verstandmäßig denn herzlich verbunden. Er zeigt mit sichtlichem, übel-behagendemWohlbehagen „l'E nvers du Grand S i e c 1 e“, was man sogar ganz wörtlich mit der „Rückseite“ des großen Jahrhunderts übersetzen mag. Für das Wesen des Barock fehlt ihm der Sinn, weshalb er es eigentlich als Unsinn betrachtet.
Sehr weise verdammt Sieburg den kapitalen Irrtum, der in Frankreichs Abkehr von Oesterreich ihrer Gedrängtheit. Aus den blendenden Croquis vom Hof Napoleons III. geht nicht genugsam hervor, daß jenes Zweite Kaiserreich nicht nur ein gefährliches Abenteuer, sondern auch der Spielball gewissenloser Abenteurer war, die mit Frankreichs Größe Schindluder trieben.
In der- virtuos bemeisterten Geschichte der Dritten Republik stört ein leiser antiklerikaler Zug, samt dem Verschweigen des so bedeutsamen Renouveau catholique, dann die Tendenz, Frankreichs deutschfeindliche Gefühle mit überlegener Nachsicht als im Grunde törichte Hysterie abzufertigen. Sonst aber weiß Sieburg wirklich mit vollendeter Sicherheit die Hauptpunkte der Entwicklung herauszufinden. Leon Blum ist aber doch zu günstig abkonterfeit, über die Ursachen des deutschen Angriffs von 1939 schreitet der Autor zu schnell an die, sehr nachsichtige, Beurteilung des Vichy-Regimes, wobei Petain und Laval zu Unrecht einander gleichgestellt erscheinen. Das Buch mündet in eine vortreffliche Silhouette de Gaulles und in eine zutreffende Analyse der heutigen Lage der Vierten Republik. Der Rationalist mit dem für Frankreich warm schlagenden Herzen verbeugt lierung hervorzuheben. Sorgfältige Korrekturlesung hat zu dem erfreulichen Ergebnis geführt, daß sämtliche Titel und Namen (mehrere hundert) richtig gedruckt sind.
Den auf den ersten Blick undankbarsten und trockensten, in Wirklichkeit aufschlußreichsten und interessantesten Teil, „Die Oper in Zahlen“, hat das Direktionsmitglied der Volksoper, Dr. Otto Fritz beigesteuert. Er umfaßt eine Darstellung der Verwaltung und der rechtlichen Stellung der Bundestheater, ein Verzeichnis und die Charakteristik der Generalintendanten, Leiter und Operndirektoren von 1867 bis zur Gegenwart, ferner genaue Tabellen und Verzeichnisse der Aufführungen von Opern, Singspielen, Operetten und Balletten seit 1869, außerdem — alphabetisch nach Titeln geordnet, mit Angabe der ersten und letzten Aufführung sowie der Zahl der Vorstellungen — die Ur- und Erstaufführungen, gesondert bis 1944 und von 1945 bis 1953. Die Spitze hält Wagner mit insgesamt 3713 Vorstellungen, dann folgen Verdi mit 2648, Mozart mit 1885, Puccini mit 1748 und Richard Strauss mit 1077 Vorstellungen. Keineswegs- entmutigend sind die Aufführungszahlen einiger moderner Werke während der letzten Jahre: Menottis „Konsul“ zum Beispiel konnte sechzehnmal, Honeggers „Jeanne d'Arc“ dreizehnmal und Hindemiths Ballett „Nobilissima visione“ zwölfmal gespielt werden. Unerklärlicherweise fehlt in zwei Verzeichnissen „Dantons Tod“ von Gottfried von Einem. Charakterisierungen wie die von Franz Schalk („Das größte musikalische Genie des 20. Jahrhunderts an der Spitze der Wiener Staatsoper“) gehören nicht in ein historisches Werk. Warum Franz Schreker konsequent mit ck gedruckt wurde? Auf Seite 279 stehen neben fünf Operntiteln falsche Komponisten.
Imposant ist auch das Verzeichnis der Sonderveranstaltungen und Gastspiele der Staatsoper Hocherfreulich der Ausweis der Statistik, daß der Tiefpunkt in den Besucherzahlen überwunden ist und daß sich die Kurve wieder den Höhepunkten der Nachkriegskonjunkturzeit nähert. Der Textteil schließt mit einem Verzeichnis jenftt Firmen, die am Wiederaufbau des Opernhauses am Ring beteiligt sind, dem die Sorgen aller Kunstfreunde galten nnd dem sich nun alle hoffnungsvollen Wünsche zuwenden.
Die Kirche im Frühmittelalter. Von Henry Daniel-Rops. Aus dem Französischen übersetzt von Martha Fabian und Hilde H o e f e r t. Abendländische Verlagsanstalt, Innsbruck 1953. 840 Seiten. Preis 120 S.
Die Regelmäßigkeit, mit der Rops die Bände seiner Kirchengeschichte erscheinen läßt, zeichnet auch die deutsche Ausgabe aus, von der jetzt der dritte Band vor uns liegt. Der deutsche Titel läßt vielleicht nicht sofort vermuten, daß in diesem Band die sogenannte „finstere“ oder „barbarische“ Periode vom 5. bis zum 11. Jahrhundert behandelt wird. Rein äußerlich gesehen, ist es eine chaotische Zeit, der die Völkerwanderung, Kämpfe zwischen Rom und Byzanz, Cäsaropapismus, Irrlehren, Schisma, Germanenbekehrung und Sittenverfall ihren Stempel aufgedrückt haben. Es gibt ohne Zweifel Perioden der Kirchengeschichte, die großartiger wirken. Trotzdem ist es Rops gelungen, von dieser unruhigen und gärenden Zeit ein zusammenhängendes Bild zu entwerfen, was an erster Stelle seinem Bemühen zu verdanken ist, die Kirchengeschichte tatsächlich als He'ilsgeschichte darzustellen. Ohne eine Apologie zu schreiben, hat Rops den Weg gefunden, trotz der vielen Schatten-auch die Lichtseiten hervorzuheben.
Der Verfasser zeigt sich auch hier wieder gut informiert, da er für seine Vorarbeiten die besten Werke benützt hat. Daß er dabei manchmal mit sogenannten „Klischeeurteilen“ auskommen mußte, ist bei diesem umfassenden Werk begreiflich. So erscheint uns seine Analyse des augustinischen „Gottesstaates“ weniger geglückt; dasselbe gilt für die Charakteristiken des Pseudo-Dionys, des Bonifatius und des Gerbert. Auch wird die karolhv gische Renaissance etwas überbewertet, auf Kosten der merowingischen Zeit, deren Verdienste Dopsch und Patzelt ans Licht gezogen haben. Die Bemerkung (S. 332), man müsse erst beweisen, daß das Wort „presbuteroi“ älter sei als „kleros“, ist unangebracht, da ja diese Priorität nicht angezweifelt werden kann.
In der Neuauflage könnten folgende Ungenauig-keiten vielleicht berücksichtigt werden: Dionysius Exiguus und Johannes Diakonus statt Verdeutschung (Paulus Diakonus wurde ja auch beibehalten), die beiden Viktoriner statt Viktorinus (S. 72), episcopatus (509), consensus evangeliorum (27), siehe auch 355. Anmerkung und 797 s. v. Gilson; Corbie (501), Hirsau (750), der Galli-kanismus tritt schon vor dem 19. Jahrhundert auf (509). Die Uebersetzung, die wieder von M. Fabian und H. Hoefert besorgt wurde, ist eine sehr gute Leistung, vor allem dadurch, daß in den bibliographischen Angaben deutschsprachige Werke berücksichtigt wurden. In dieser Beziehung könnte man sogar von einer Bearbeitung sprechen. Hervor“ zuheben ist die schwierige, aber richtig durchgeführte Transkription der byzantinischen Eigennamen.