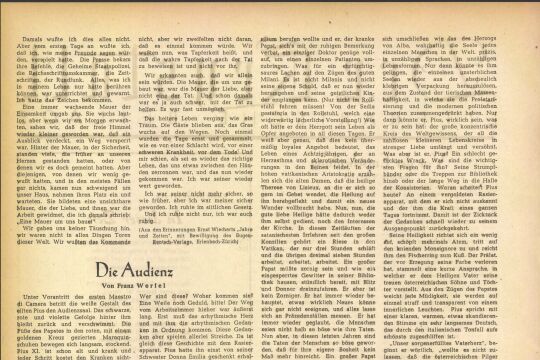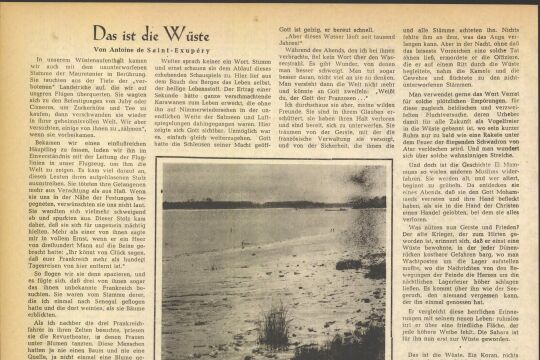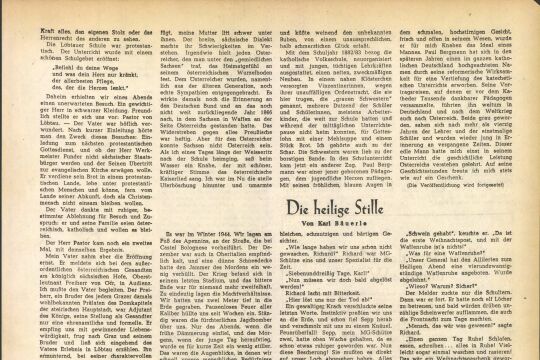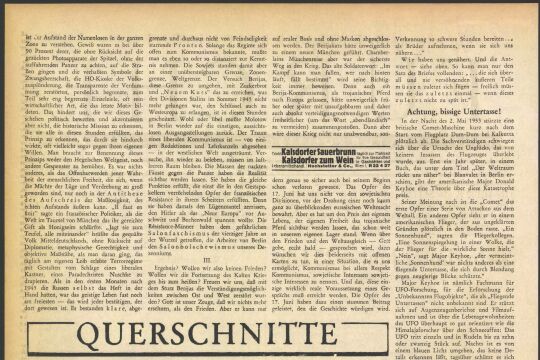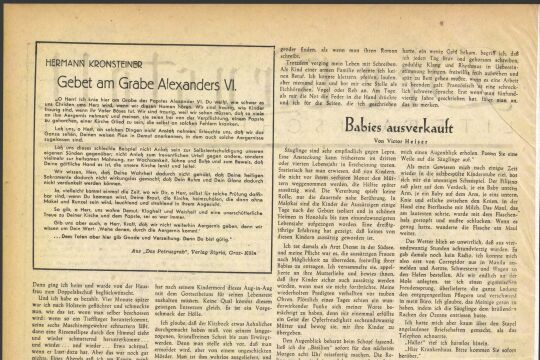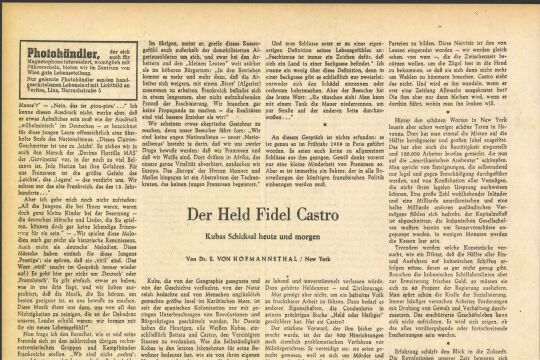Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
REPORTAGE
VALLEGRANDE. — Daß sieben Monate später hier die Hölle los sein würde, ahnten die beiden Schwestern Valentina Schlautmann und Antonia Maria Freude im März 1967 nicht. Damals waren sie hergekommen, um den „Sefior de Malta” zu übernehmen, das trostlos primitive Krankenhaus des 8000 Einwohner zählenden Garnisonstädtchens im Südosten Boliviens, das über Nacht Weitberühmtheit erlangen sollte. Das erste, was die beiden Schiulschwestem brachten, waren Ordnung und Sauberkeit. Trotzdem fand das 43-Betten-Hospital wenig Zuspruch.
VALLEGRANDE. — Daß sieben Monate später hier die Hölle los sein würde, ahnten die beiden Schwestern Valentina Schlautmann und Antonia Maria Freude im März 1967 nicht. Damals waren sie hergekommen, um den „Sefior de Malta” zu übernehmen, das trostlos primitive Krankenhaus des 8000 Einwohner zählenden Garnisonstädtchens im Südosten Boliviens, das über Nacht Weitberühmtheit erlangen sollte. Das erste, was die beiden Schiulschwestem brachten, waren Ordnung und Sauberkeit. Trotzdem fand das 43-Betten-Hospital wenig Zuspruch.
Noch am 12. August klagte Schwester Antonia Maria: „Schon seit Wochen haben wir immer mir sieben bis neun Patienten. Hoffentlich wird es nicht so bleiben.”
Es blieb niicht so! Die Wende kam schlagartig, als im Gebiet um Vallegrande Ende August Regierungstruppen und Guerriileros aufeinanderprallten.
Der Dschungel in den bolivianischen Vor-Aniden war ein ideales Terrain für die Angriffe der Rebellen. Vier Fünftel von ihnen seien Kubaner, so hieß es. Ihre Hauptmacht war ein faszinierender Naime: „Che” Guevara! Er, der einstige — seit 1965 spurlos verschwundene — Kampfgefährte Fidel Castros, war ihr Führer. Dennoch waren die Chancen der Guerriileros gering. Viele Bolivianer glaubten nicht einmal an ihre Existenz, geschweige denn an die Gegenwart des „Ohe”, auf dessen Kopf die Regierung — tot oder lebendig — 50.000 Pesos (17.000 Mark) ausgesetzt hatte.
Zu den Zweiflern zählte auch der 36jährige Kaplan Leo Schwarz, eirizi- ger Seelsorger im Dorf Muyupampa:
„Bis zum Ostermorgen (26. März 1967) hatte ich gespottet und alle ausgelacht. Als dann die ersteh Soldaten fielen, müßte ich es leider glauben. Urplötzlich tauchten die Guerriileros auf, überfielen eine Polizei station oder erbuteten einen Lastwagen und verschwanden ebenso spur- und lautlos, wie sie gekommen waren. Niemand wagte mehr einen Schritt nach draußen.” Als die Zahl der Gefallenen im Gelände von Muyupampa anstieg, sagte sich der Kaplan: „Einer muß mit den Guerriileros verhandeln! Es darf nicht noch mehr Blut fließen!”
Er holte seinen Geländewagen heraus, befestigte ein weißes Laken über der Motorhaube und fuhr zusammen mit einem Arzt und dem Präfekt von Muyupampa los. Als der Pfad die Dschungelzone erreichte, gingen sie zu Fuß.
„Keinen Schritt weiter! Was wollen Sie?” Plötzlich waren sie umzingelt von lauter Fidel Castros mit schußbereiten Gewehren und Revolvern in den Händen.
Einer klopfte den Kaplan nach Waffen ab. Er hatte keine.
Man befahl den dreien, auf den Chef zu warten. — Endlich kam er.
„Gestern abend hätten wir Muyupampa angegriffen, aber wir wollten die Zivilbevölkerung schonen”, begann der. „Wir sind die .Anonymen der Welt. Wir führen die große Revolution weiter. Wir ergeben uns nicht und fürchten niemanden.” Das war die Sprache „Che” Guevaras!
„Haben Sie denn keine Augen im Kopf, Padre? Sehen Sie doch das Elend dieser Hütten. Wer hilft denn?”
Der Kaplan erzählte etwas vom Bemühen der Kirche.
„Ja, das wissen wir schon. Aber was ist mit den anderen? Mit denen, die diese Hilfe nicht haben? Wir werden kämpfen, bis diesen Leuten geholfen wird!”
Kaplan Schwarz kehrte erfolglos nach Muyumpampa zurück.
Der Dschungelkrieg ging weiter.
Jedem siegreichen Gefecht Guevaras folgte die Niederlage auf dem Fuß. Nach sechs Monaten war der verlorene Haufen am Rande seiner Kräfte — verfolgt von bolivianischen Flugzeugen, gejagt von indianischen Rangers, verraten von gefolterten Gefangenen.
Dann kam der 31. August. Von da an brauchte Schwester Valentina in Vallegrande nicht mehr über Arbeitsmangel im Hospital „Senor de Malta” zu klagen:
„Was wir an diesem Tag erlebten, war grauenhaft. 27 Soldaten waren mit einem Lastwagen abgestürzt. Eine ganze Nacht hatten wir schon durchgeartbeitet. Dann brachten uns die Militärs am Morgen sieben tote Guerriileros und einen Gefangenen ins Haius. Ein Campesdno (Bauer) hatte den Soldaten die Stelle verraten, an der die Guerriileros immer den Rio Grande 6 Guapay durchquerten. Bei günstiger Gelegenheit — zehn Guerriileros und eine Frau waren gerade mitten im Wasser — eröffneten die Soldaten das Feuer. Fast alle Guerriileros wurden erschossen. Die drei oder vier, die man lebend gefangennahm, ließen sich später freiwillig erschießen. Sie wollten lieber sterben, als irgendwelche Aussagen machen. — Um auch die letzten Zweifler zu überzeugen, wurden die Leichen im Hof unseres Hospitals öffentlich ausgestellt. Das sensationslüsterne Volk kam in Scharen gelaufen und konnte sich kaum sattsehen an den langen schwarzen Bärten, an den bis auf die Schultern • herabhängenden Haaren, an den von Schüssen zerfetzten Leibern, die von der Hitze und von dem verschluckten Flußwasser auf- gequollen waren — ein scheußlicher Anblick!”
Aber das war erst der Auftakt.
Schwester Borgia führt Tagebuch:
„8. Oktober 1967. — Heiße Kämpfe bei Pucarä. Bis zum Abend haben wir Betten für die Verwundeten fertiggemacht. Dauernd sind Flugzeuge über uns. Hubschrauber holen die Opfer nach hier. Die Kinder spielen nur noch Guerriileros und Soldaten …”
„9. Oktober 1967. — Über uns pausenlos Flugzeuge. Erbitterte Kämpfe zwischen Soldaten und Guerilleros. Auf beiden Seiten Tote und Verwundete. Im Krankenhaus ist Hochbetrieb. Wie lange soll das noch dauern?”
Es dauerte keinen Tag mehr!
„Wo der Tod uns erreicht, ist unwichtig. Er sei willkommen, solange unser Schlachtruf auf offene Ohren trifft”, hatte Guevara aus dem Untergrund an die Lateinamerikanische Solidaritätskonferenz in Havanna geschrieben.
Der Tod erreichte den „gefährlichsten und intelligentesten Führer der lateinamerikanischen Revolution” am heißen Nachmittag des 9. Oktobers, 50 Kilometer von Vallegrande entfernt. — 182 bolivianische Rangers, von den USA gedrillt, hatten den auf etwa 40 Rebellen zusammengeschrumpften Trupp in der Nähe der Ortschaft Higueras eingekeilt. Eine Maschi nengewehrgarbe machte dem Leben des 39jährigen „Che” ein Ende.
Der Dschungel, in den er sich festgebissen hatte, mußte drei Stunden lang mit der Machete bearbeitet werden, bis endlich der Hubschrauber für den Abtransport landen konnte. Dann wurde der Leichnam nach Vallegrande geflogen.
Wieder Schwester Borgia:
„Es gab schulfrei, damit alle unbehindert zum Flugplatz laufen konnten. Von morgens früh bis nachmittags um 5 Uhr wartete ganz Vallegrande auf den Augenblick, wo der Hubschrauber den toten Guerilla- Führer brachte. — Allein sieben Flugzeuge aus anderen Ländern waren da. Und — Auftos! Autos! Autos! So etwas hat unsere Stadt noch nie erlebt! .Vallegrande — Hauptstadt der Nachrichten für die ganze Welt’, sagte ein Reporter zu mir.”
Der tote Guevara hing zwischen den Landekufen des Hubschraubers in einer abgerissenen, bluitver- schmierten grünen Uniform, Lederfetzen an den Füßen. Im Rucksack hatte man auch sein Kriegstagebuch gefunden. Wenige Tage später bot ein Verlag 100.000 Dollar dafür …
Wie eine Jagdtrophäe wurde der Leichnam in der Waschküche des „Senor de Malta” ausgestellt: Hals, Brust und Leisten waren von Kugeln durchbohrt. Die Beine hatte eine MG-Garbe fast vom Rumpf getrennt.
Ärzte, Militärs, Journalisten und CIA-Agenten warteten schon darauf, die Leiche zu identifizieren. Die Photographen knipsten das unverwechselbare Gesicht. Man hatte seine Augen nicht zugedrückt. Für alle, die „Che” Guevara vor 1965 persönlich gesehen hatten, gab es keinen Zweifel mehr: Der Held der Dritten Welt war tot!
„Das Schicksal unserer Generation ist hart” hatte er 1965 in seinem Abschiedsbrief an Fidel Castro geschrieben, „es lautet: Revolution machen. Daher ist vorerst ein glückliches Leben nicht möglich. Solange junge Menschen sterben, weil sie eine Theorie, die ich für richtig halte — den Guerillakrieg — falsch anwenden, darf ich nicht aim Schreibtisch sitzen.”
Er hätte es im Leben bequem haben können wie kaum ein anderer. Aber er verzichtete auf Ämter, Macht und Familie, um „ein zweites und ein drittes, ja viele Vietnam zu schaffen”.
Er hat es nicht geschafft. Durch seinen Tod wurde er zum Märtyrer und zum Mythos für die Revolution. Und das bedeutet viel in „einem Kontinent, wo erst der Mann und dann die Idee zählt” (Die Zeit).
Im „Senor de Malta” ist es wieder ruhig geworden. Die Autos sind verschwunden. Die Welt der Nachrichten hat das kleine Hospital im Südosten Boliviens längst wieder vergessen. Aber die Schwestern arbeiten weiter, Tag für Tag: Sie trösten, sie verbinden Wunden und geben schmerzstillende Spritzen — bereit, jederzeit zu helfen: in den turbulenten Tagen des Guerillakrieges Soldaten und Guerriileros. Jetzt wieder ihren vertrauten Indios von Vallegrande. Denn die Sorgen des Menschen sind die gleichen. Und auch seine Schmerzen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!