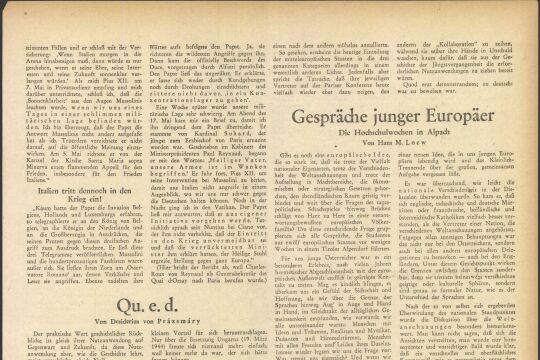Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Republikfeier
In dem Bestreben, ein fruchtbares Gespräch zwischen den Generationen zu fördern, veröffentlicht die „F u r c h e“ zum dreißigsten Jahrestag der Republikgründung den Beitrag eines Angehörigen jener Generation, die in der ersten Republik in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen aufgewachsen ist.
Die Schulfeier zum 12. November bereitete unserem Gymnasialdirektor stets erhebliches Kopfzerbrechen. Schon die Programmgestaltung, die Auswahl der Gedichte, Sprüche und Lieder war nicht einfach. Patriotische Themen aus der österreichischen Vergangenheit wurden von links her leicht als Verherrlichung der vergangenen Monarchie auf Kosten der gegenwärtigen Republik gedeutet, die Betonung des Sprachlich- Nationalen riß die deutsch-österreichische Problematik auf, ein Verweilen bei dem ja erst einige Jahre zurückliegenden Ereignis der Entstehung der Republik führte bedenklich nahe an die Gegenwartspolitik dieser Nachkriegszeit heran. Noch schwieriger war die Auswahl der Festredner. Die Professoren, zum Teil außerhalb der gegenwärtigen Staatsgrenzen geboren und aufgewachsen, trugen teils als Erinnerung das Bild der Donaumonarchie, teils als Zukunftshoffnung das eines geschlossenen Nationalstaats im Herzen. Sie waren gewiß keine Staatsfeinde, sondern verläßliche Staatsdiener, die einst dem Kaiser gegeben hatten, was des Kaisers war, und die jetzt auch der Republik das Ihrige nicht verweigerten. Aber zu einer begeisternden Festrede am Geburtstag der Republik reichte diese pflichttreue Alltagsloyalität eben doch nicht aus. Für viele von ihnen, die im Felde gewesen, war zudem der Gedanke an jene Novembertage um- düstert von der Erinnerung an bitterste Erlebnisse, an Zusammenbruch und Auflösung. Als dann einmal ein Lehrer, der den November 1918 in Wien miterlebt hatte, in seiner Festrede vielleicht etwas zu lange bei gewissen Auflösungserscheinungen im Offizierskorps des Hinterlandes bei Kriegsende verweilte, fühlten die Offizierskinder, vor allem die Kriegswaisen unter den Schülern, die Ehre ihrer Väter angegriffen und es regnete Proteste aus Eltern- und Schülerkreisen.
War es da ein Wunder, daß die Feier uns nie wirklich einen tiefen Eindruck hinterließ und wir, wenn die schöne, getragene, aber eben auch weder begeisternde noch ergreifende Bundeshymne „Deutsch-Österreich, du herrliches Land!“ erklang, mit den Gedanken schön bei den sportlichen Wettkämpfen waren, die den Festtag beschlossen?
Was wir sonst an jenem Tage in den Straßen Wiens sahen, war auch nicht dazu angetan, eine umfassende Staatsgesinnung zu wecken. Denn die herrschende Partei benutzte den Republikfeiertag zu einer machtvollen Parteidemonstration, die wir je nach der politischen Einstellung unseres Elternhauses positiv oder negativ, nie aber als eine die Gesamtheit der Staatsbürger angehende Kundgebung beurteilten. Das Elternhaus aber wirkte schließlich oft am stärksten der Ausbildung einer echten Staatsgesinnung entgegen, und zwar gerade in jenen Kreisen, in denen die Pflege von Staatstreue und Staatsgesinnung zur Familientradition gehörte: zumal in den altösterreichischen Beamten- und Offiziersfamilien, bei Lehrern und öffentlichen Angestellten, überall dort, wo eine persönliche Bindung an die alte Monarchie bestanden hatte. Denn die feindselige Haltung vor allem der linken Parteiführer gegenüber allem, was mit der österreichischen Vergangenheit zusammenhing, verstärkte hier nur die mißtrauische Einstellung gegenüber der jungen Republik, Das noch allzu nahe Beispiel der Vergangenheit forderte ja immer wieder zum Vergleich mit der Gegenwart heraus — und dieser Ver- gleidi konnte besonders in den Augen jener Kreise, die mit dem Zusammenbruch der Monarchie zugleich Lebensstellung und Vermögen verloren hatten, eben nie zugunsten der Republik ausfallen. Es war eine gefühlsmäßige Distanz, die durch keinerlei Gedanken an eine legitimistische Restauration, sondern eben nur durch die Erinnerung an die Vergangenheit bedingt war, und die in der Ignorierung der neuen Bundeshymne durch den größter! Teil der Bevölkerung ihren sinnfälligsten symbolischen Ausdruck fand.
Für uns Jüngere ergab sich damit eine schwierige Situation. Manche erlagen der gegenwartsabgewandten Atmosphäre des Elternhauses so sehr, daß sie in dieser von ihnen nie selbst erlebten Vergangenheit ein seltsames Traumleben führten. Diejenigen in der jungen Generation aber, die ihr Antlitz bewußt der Gegenwart und Zukunft Zukehrten, gerieten in Gefahr, die Brücken zur eigenen Vergangenheit abzubrechen, sie wurden heimatlos in der eigenen Heimat, Revolutionäre im luftleeren Raum, die doch den Schritt in ein von marxistischer Doktrin und Klassenkampfparolen beherrschtes Lager nicht vollziehen konnten und nicht vollziehen wollten.
So sind wir in einer Art „Traditionslücke“ aufgewachsen. Die Fäden, die sonst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden, schienen für uns hoffnungslos zerrissen. Vergangenheit oder Zukunft — das war die Entscheidung, vor die wir uns gestellt sahen. Als junge Menschen, die das Leben vor sich wußten, wählten wir meist die Zukunft, ließen die Verbindung zur Vergangenheit fahren.
Erst später haben wir, oft auf seltsamen Wegen, jeder für sich die zerrissenen Fäden wieder angeknüpft. Das Erlebnis der Heimat uftd ihrer Menschen, das war ein Weg. Ein anderer die Reisen in die Fremde, die uns die Erkenntnis des eigenen Wesens brachten, vor allem die Fahrten in die Nachfolgestaaten, wo wir mit stolzer Freude die Spuren des Werks unserer Väter entdeckten. Ein dritter das Studium, das uns die großen Leistungen der österreichischen Vergangenheit auf allen . Gebieten menschlicher Tätigkeit, in Rechtsprechung und Verwaltung, in Wissenschaft und Kunst näherbrachte.
Die entscheidende Erkenntnis des eigenen Wesens vollzog sich dann für die meisten von uns viel später bei der Begegnung mit den verschiedenen deutschen Stämmen im Großdeutschen Reich und in der Wehrmacht.
Gewiß haben viele den Anschluß begrüßt, andere, gerade aus der ererbten Staatsgesinnung sich mit der vollzogenen Tatsache zunächst abgefunden. Um so eher, als die Zugehörigkeit zu einem Kleinstaat, nicht wie etwa in der Schweiz in jahrhundertealter Tradition erwachsen, als das Ergebnis einer Niederlage, eines Zusammenbruchs empfunden worden war. Nun gehörte man wieder einer Großmacht an und hoffte, daß die besten Überlieferungen der alten Monarchie sich in der neuen Form durchsetzen würden. Als die Erkenntnis kam, daß diese Hoffnung trügerisch war, hatte uns bereits der rasende Wirbel des Weltbrands ergriffen und uns an alle Fronten des zweiten Weltkriegs geworfen.
Dann sind wir heimgekehrt. Skeptisch, enttäuscht, auch etwas müde. Gewiß, ohne große Begeisterung, aber gewillt, nach besten Kräften beim Wiederaufbau des Vaterhauses mitzuwirken. Der äußere Rahmen ist derselbe, den wir in Kindheit und früher Jugend gleichsam als ungewolltes Ergebnis einer Niederlage, als Provisorium empfunden hatten. Und doch hat sich etwas Grundlegendes geändert. Die Erkenntnis der österreichischen Aufgabe in einem kranken Europa, die Einsicht, daß dieses Land, das in einem vom Nationalismus zerfetzten Europa als letzter Rest einer übernationalen Ordnung übriggeblieben — „Der Rest’ ist Österreich“ hieß es einst höhnisch bei der Aufteilung der Monarchie —, daß dieses Land im Herzen des Kontinents seine Unabhängigkeit nicht verlieren darf, dieses neue Bewußtsein einer verpflichtenden Aufgabe ist die wertvolle Frucht der bitteren Jahre.
Die äußeren Umstände sind womöglich noch ungünstiger als zu jener Zeit, da wir noch die Schule besuchten. Vieles, was damals selbstverständlich gesichert war, ist heute, im dritten Jahr der vergeblichen Hoffnung auf’ den Abschluß des Staatsvertrags, erst ein Ziel, das erreicht und erkämpft werden muß. Die Kinder von heute sind durch die verschiedenen totalen Umbrüche vielleicht noch ärger verwirrt und gefährdet, als wir es waren. Aber wir haben heute den teuer erkauften Vorteil, daß wir wissen, was auf dem Spiele steht. Wenn wir daher in diesen Tagen der dreißigsten Wiederkehr der Republikgründung gedenken, soll aller Streit, Hader und Irrtum jener Jahre uns nur eine Warnung sein. Das Trennende tritt zurück, die verschiedenen Abschnitte unserer Geschichte fügen sich zu einem in die Zukunft weisenden Bogen zusammen. Die „Traditionslücke“ schließt sich, die Österreicher, einst die „letzten Europäer", erkennen ihre Aufgabe, die ersten Europäer zu werden. Denn wir wissen, worum es geht. Unsere Pflicht aber ist es, dieses Wissen an die neue Jugend weiterzugeben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!