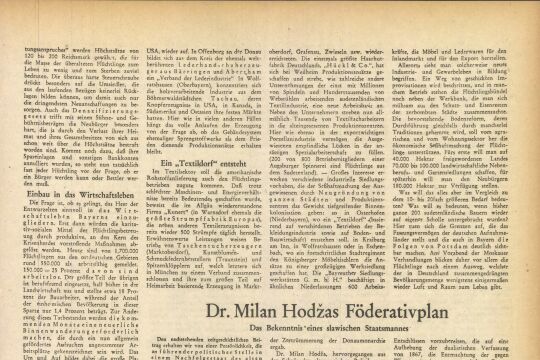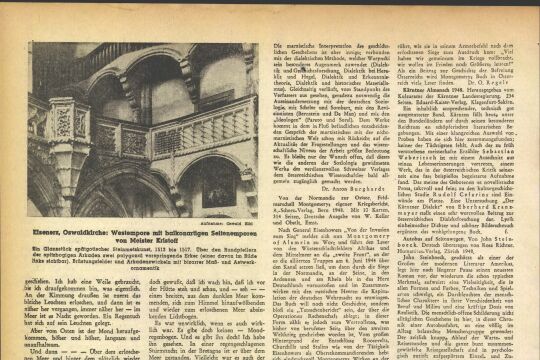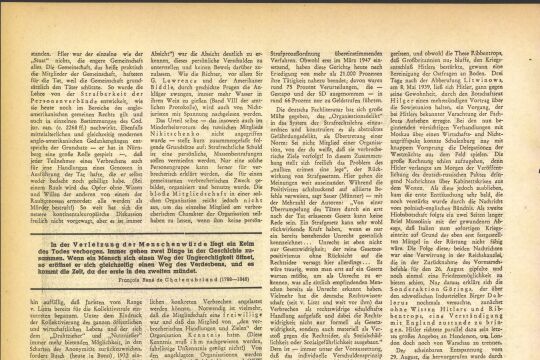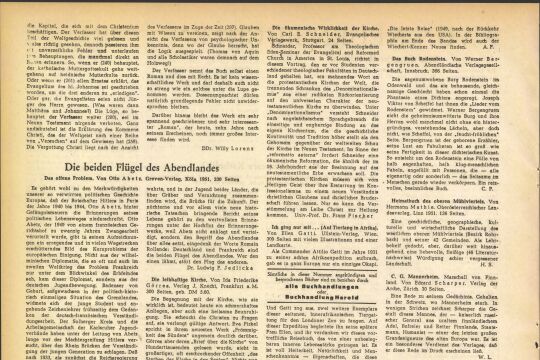Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
RF.VIJE TM AUSLAND
Das Gedenken des 200. Geburtstages Goethes, welcher am 28. August gefeiert wird, hat in Deutschland zu einer seltsamen Fragestellung Anlaß gegeben: zu der Frage, ob die größte Dichtung des größten deutschen Dichters — der „Faus t“ — der heutigen deutschen Generation noch etwas zu sagen habe, ja, ob sie überhaupt noch „aktuell" sei. Das Augustheft der „Schweizer Monatshefte“ gibt einen kurzen Querschnitt der Antworten, die Deutsche auf diese Frage fanden:
Reinhold Schneider stellt diese Frage iij zwei kleineren Arbeiten, um sie überraschenderweise mit dem Argument zu verneinen, nicht „das Faustische“, sondern die Botschaft des Himmels am Ende und Anfang des Goetheschen Dramas berührten uns heute, und um diese Botschaft zu vernehmen, brauchte man nicht den „Faust“ aufzuschlagen.
Es ist keine dreißig Jahre her, so behauptete Oswald Spengler das Gegenteil. Wer hat recht? Ist „Faust", wie Schneider glaubt, der „große Held der Untergänge“, ein „scheiternder Verderber“, das „Lebensdrama eines Besessenen“ und damit „geschichtlich begrenzt", oder ist „Faust“ nicht vielmehr gerade infolgedessen, nämlich infolge seiner Zwielichtnatur, seines Zauderns zwischen Licht und Nacht hochaktuell, aktuell allen Zeiten, die nicht mehr im fraglos-göttlichen Geheimnis aufgehoben sind wie die mittelalterlichen, die vorfaustischen?
Es ist bezeichnend, daß im heutigen Deu tschland die klassische Dichtung in dem Maße bejaht wird, als sie sich als Rettungsanker im Chaos der Kultur eignet: Ernst Beutler wollte Goethe aus dieser Sachlage heraus (in seinem Vortrag über Goethes Christlichkeit) fürs Christentum retten, Schneider will wenigstens die christlichen Elemente von Goethes Hauptdrama als' ethischen Fixpunkt bejahen — aber alle diese an sich verständlichen Bemühungen übersehen — meint der Kritiker in den „Schweizer Monatsheften“: „daß Goethe nicht insofern zählt, als er Ethiker, sondern insofern er Dichter ist."
Das Kunstwerk im Wiederaufbau
Zu den vom Krieg am härtesten getroffenen deutschen Städten gehört Köln. Die Katholiken verloren von 87 Kirchen 67, darunter weltberühmte Kunstwerke, wie St. Gereon, Groß-St.-Marien, St. Apostel, den Protestanten blieb von 18 Kirchen gar nur eine einzige erhalten. Bereits im Kriege begann eine lebhafte Diskussion über die Fragen des Wiederaufbaues der zerstörten Kirchen und die dabei zu verfolgenden Pläne. Die Schweizer Monatsschrift „C i v i t a s" veröffentlicht in der Nummer 49 einige Kernsätze aus diesen Diskussionen, die die Spannweite des ganzen Fragenkreises anzudeuten vermögen.
„In der Schönheit der alten Steine ist etwas von dem fortwirkenden, inkarnierten Leben der Religion", meinte ein Dr. Schmitt ab freier Autor. „Aber sind wir nicht vollends verloren, wenn man die beschädigten Gotteshäuser dem Historismus überantwortet, der eine vielleicht peinlich genaue, aber quälend tote Kopie hervorbringen wird?" fragte Lützeier, der Kunstwissenschaftler, der sich sonst nicht etwa als sehr modern gibt, und Dombaumeister Ing. Weyers warnte eindringlich: „Man muß sich hüten, in eine Anbetung der alten Steine zu verfallen. Es kommt uns ja nicht auf Repräsentation an ... nachdem die Fassade unseres Jahrhunderts so jämmerlich zerschlagen ist, dürften wir für einige Zeit wohl genug von jeder Maskerade haben.“ In der gleichen Richtung sprach schon am ersten Abend ein Mann von der schöpferischen Kraft eines umfassend denkenden modernen Künstlers, Architekt Rudolf Schwarz, das ahnungsvolle Wort: „Wer die Rekonstruktion fordert, hat keine Ahnung, was die constructio gekostet hat.“ Und etwas weiter zurück meinte er: „Unsere Kirchen verzehrte das Feuer, aber das ist nicht das Schlimmste, was ihnen widerfahren konnte." Dann eine weitere tiefe Erkenntnis, die über Köln hinaus ein ganzes Zeitalter trifft, so wie Dr. Verbeek als Historiker es aussprechen kann: daß es die Menschen seien, „in deren Herzen die Kirchen verlorengegangen waren, ehe sie zerstört wurden“.
Rommel contra Hitler
Zur gleichen Zeit, da in Deutschland der ehemalige Generalstabschef Haider in einer Broschüre ein vernichtendes Urteil über Hitler als militärischen Strategen fällt, erscheint in der Freiburger Halbmonatsschrift „D ie Gegenwart" eine Reihe von Artikeln aus der Feder des ehemaligen Generalstabschef Rommels, Generalleutnants Dr. Hans Speidel, die neues Licht auf die innerdeutschen Verhältnisse des Jahres 1944 werfen und insbesondere die scharfe Opposition des berühmtesten deutschen Feldherrn des zweiten Weltkrieges gegen seinen „Führer“ darstellen.
Rommel hatte sich am 1. April 1944 von Hitler am Obersalzberg verabschiedet, um das ihm übertragene Oberkommando der Heeresgruppe B im Westen anzutreten. Rommel, der zum Unterschied von Hitler die Invasion der Westalliierten klar voraussah, war überzeugt, daß damit der entscheidende Punkt des Krieges eintreten werde. Wie diese neue Phase des Krieges für Deutschland verlaufen müßte, war ihm kurz nach Eintreffen bei seinem neuen Kommando klar: es standen damals bereits 17.000 alliierten Flugzeugen erster Linie nur 500 deutsche gegenüber, davon 90 Bomber und nur 70 Jäger. Rommel kam zur Überzeugung, daß der Krieg beendet werden müsse, ehe die unausbleibliche Katastrophe jede Verhandlungsmöglichkeit abschneiden müßte. Der von General von Falkenhauscn, damals Oberbefehlshaber in Belgien, geforderte „Aufbruch des Gewissens“ vollzog in Rommel die Schwenkung zu den Kräften des deutschen Widerstandes. Als Ergebnis seiner vorbereitenden Beratungen mit Beck, Gördeler, Rundstedt und Stülpnagel wurde ein „Mobilmachungskalender“ für den Umsturz festgelegt. Der Plan ging auf einen Waffenstillstand mit den Generalen Eiser.hower und Montgomery ohne Beteiligung Hitlers aus. Festsetzung Hitlers. Hitler nicht durch einen Anschlag beseitigen, sondern ihn durch deutsche Richter aburteilen lassen. Sturz der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Vorläufige Übernahme der Regierungsgewalt in Deutschland durch die Widerstandskräfte. Keine Militärdiktatur. Versöhnung im Innern.
Im Osten; Weiterführung des Kampfes, hiezu Halten einer verkürzten Ostfront. Die Ausführung dieses Planes war noch nicht begonnen, als am 6 Juni, 5.30 Uhr, die Invasion einsetzte und die Pläne Rommels zunichte machte.
In einer Unterredung, die Rommel am 17. Juni in Margival bei Soissons in Gegenwart von Rundstedt mit Hitler hatte, wies er in aller Offenheit auf die katastrc phale Lage der Invasionsfront hin.
Hitler sah aber trotz dieser Beurteilung der Feindlage und der täglich absinkenden Kampfkraft nicht die Wirklichkeit und prophezeite in einer seltsamen Mischung von Zynismus und Intuition in endlosem, autosuggestivem Redefluß „die kriegsentscheidende Wirkung“ der V-Waffe gegen England, deren Einsatz am 16. Juni begonnen hatte. Er unterbrach die Besprechung und diktierte dem Vertreter des Reichspressechefs persönlich den Wortlaut für die Bekanntgabe des ersten V-Einsatzes in Presse und Rundfunk. Das von beiden Feldmarschällen mit großen Erwartungen begonnene Gespräch erstickte in einem abseitigen Monolog Hitlers.
Die gemeldete Annäherung feindlicher Fliegerverbände machte die Verlegung der Abschlußbesprechung in einen Luftschutzraum notwendig. In diesem waren nur Hitler, die beiden Feldmarschälle mit ihren Chefs und noch ein General anwesend. Rommel legte schonungslos die verzweifelte militärische und auch die politische Lage Deutschland dar, aber Hitler schnitt nach wiederholtem Redewechsel das Gespräch mit den Worten ab; „Kümmern Sie sich um Ihre Invasionsfront!“ Das Ergebnis dieser „Führerbesprechung“ war militärisch, politisch und menschlich niederschmetternd. Die Lage nicht nur im Westen, sondern auch an allen übrigen Fronten wurde ständig bedrohlicher. Angesichts dieser Verschlechterung bat Rommel Hitler erneut, ihm und Rundstedt eine Aussprache zu gestatten. Am 28. Juni wurden beide Feldmarschälle nach Berchtesgaden zur Berichterstattung befohlen. Die Besprechung fand im großen Kreise statt. Hitler beantwortete aber nicht die von den beiden Oberbefehlshabern gestellte Aufforderung, auf Grund der Gesamtlage eine Beendigung des Krieges herbeizuführen, sondern erging sich wieder in weitschweifigen Phrasen über den Einsatz neuer „Wunderwaffen“. Die Ausführungen verloren sich in Hirngespinsten und die beiden Feldmarschälle mußten unverrichteter Dinge Berchtesgaden verlassen.
Am 15. Juli endlich sandte Rommel eine drei Maschinenseiten umfassende Denkschrift als KR-Blitzfernschreiben an Hitler. Der Inhalt war kurz der, daß die Lage verzweifelt sei und die dünne Front nodi höchstens 14 Tage halten könne. Das Schreiben schloß mit den Worten: „Ich m u ß S i e bitten, die Folgerungen aus dieser Lage unverzüglich zu ziehen. Ich fühle mich verpflichtet, als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe dies klarzumachen." Nach der Absendung des Telegramms äußerte sich der General: „Ich habe Hitler jetzt die letzte Chance gegeben. Wenn er keine Konsequenzen zieht, werden wir han- d e 1 n."
Es kam nicht dazu. Denn am 17. Juli, auf der Heimfahrt von der Front, traf die Geschoßgarbe von Tieffliegern den Wagen des Generals. Der Chauffeur war sofort tot, der Feldmarschall so schwer getroffen, daß man zunächst auch ihn tot wähnte.
„Der Feldmarschall war in Wahrheit in der Stunde ausgeschaltet, in der ihn Heer und Volk am wenigsten entbehren konnten; alle aber, die mit ihm den Weg in eine neue, bessere Zukunft suchten, fanden sich schmerzlich ihrer Mitte beraubt", schließt der Bericht von Rommels Generalstabschef. Wie bekannt, wurde Rommel, der nach wochenlanger Krankheit langsam genas, am 14. Oktober im Aufträge Hitlers von zwei deutschen Generalen — Burgdorff und Maisei — gezwungen, Selbstmord zu verüben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!