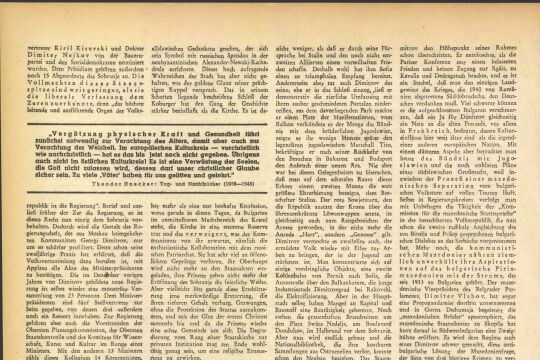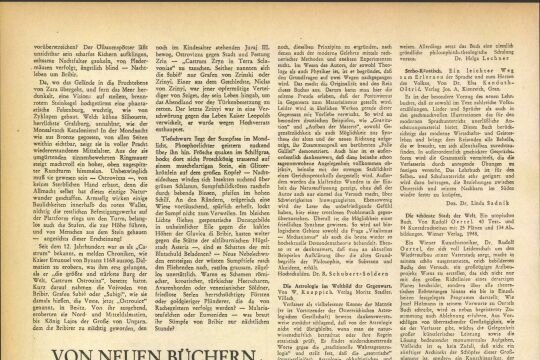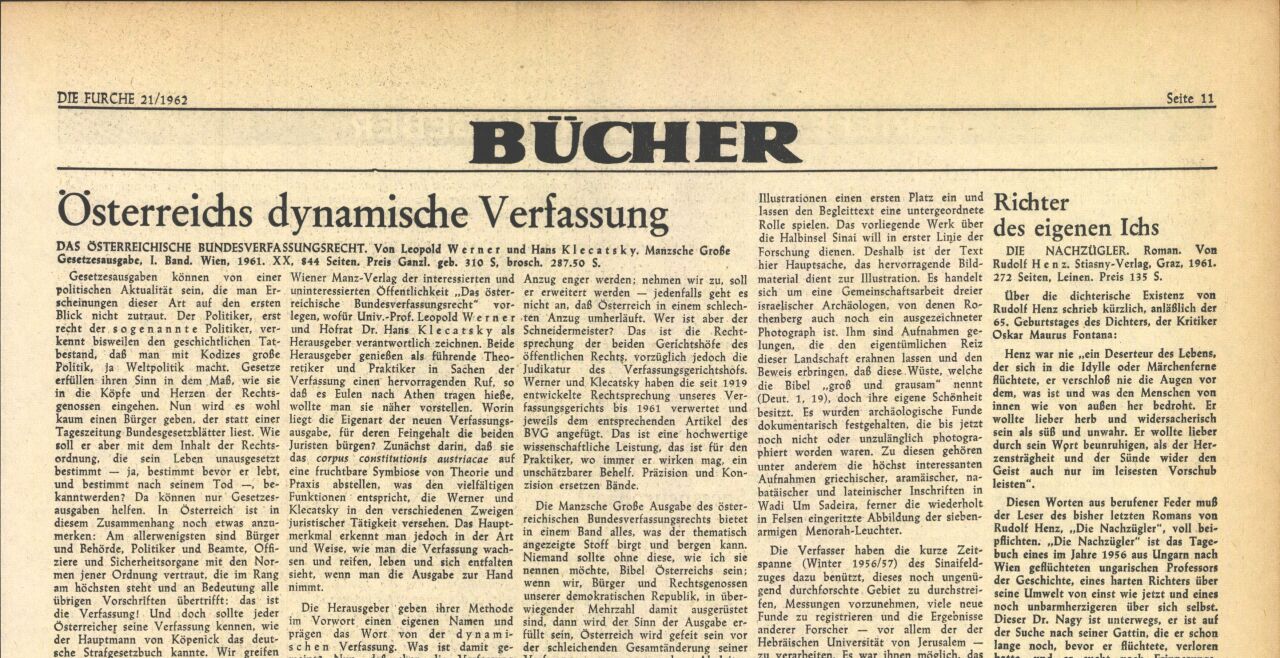
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Richter des eigenen Ichs
DIE NACHZÜGLER. Roman. Von Rudolf Henz. Stiasny-Verlag, Graz, 1961. 272 Seiten, Leinen. Preis 135 S.
Über die dichterische Existenz von Rudolf Henz schrieb kürzlich, anläßlich der 65. Geburtstages des Dichters, der Kritiker Oskar Maurus Fontana:
Henz war nie „ein Deserteur des Lebens, der sich in die Idylle oder Märchenferne flüchtete, er verschloß nie die Augen vor dem, was ist und was den Menschen von innen wie von außen her bedroht. Er wollte lieber herb und widersacherisch sein als süß und unwahr. Er wollte lieber durch sein Wort beunruhigen, als der Herzensträgheit und der Sünde wider den Geist auch nur im leisesten Vorschub leisten“.
Diesen Worten aus berufener Feder muß der Leser des bisher letzten Romans von Rudolf Henz, „Die Nachzügler“, voll beipflichten. „Die Nachzügler“ ist das Tagebuch eines im Jahre 1956 aus Ungarn nach Wien geflüchteten ungarischen Professor) der Geschichte, eines harten Richters über seine Umwelt von einst wie jetzt und einei noch unbarmherzigeren über sich selbst. Dieser Dr. Nagy ist unterwegs, er ist auf der Suche nach seiner Gattin, die er schon lange noch, bevor er flüchtete, verloren hatte, und er sucht nach Erinnerungsbrocken, hadert mit sich und mit seinem einstigen Ich, auf daß er sein ihm abhandengekommenes geschieh tsphilosophi-sches Werk irgendwann einmal, in der „ersten reinen Stunde“, neu schreiben kann. Die Sehnsucht nach dem späten Glück treibt ihn auf abenteuerlichen Wegen immer vorwärts, die Suche nach dem eigenen Ich, nach Selbstbestätigung, zieht ihn immerfort zurück, zu längst verlassenen Weggabelungen. Er hat, zusammen mit seinem Manuskript, mit diesem rückwärts projizierten Land Utopia, das er vermutlich nie betreten hat und kaum je betreten wird, seinen einzigen Sohn in Ungarn zurückgelassen, seinen Sohn, den er verleugnet, den er nie wirklich gekannt hat und dessen tragisches Schicksal schließlich ihm zur letzten Krise und Läuterune verhilft.
Dieser Dr. Nagy, dessen verlorenes Manuskript den Titel „Die Nachzügler“ getragen haben soll, sagt an einer Stelle von sich selbst, er kultiviere seit Jahren -den-,>IacIuügIrkomplej(“^Jn einer hastig hingeworfenen j, Selbstdiagnosa beJHWptet er, er zeige eine „krankhaft kritische Einstellung gegen den freien Westen“. Er halte nämlich die „Nachzügler“ in der östlichen Welt für weniger gefährlich als die im Westen. „Dort leicht erkennbare, einheitlich ausgerichtete, deklarierte falsche Begriffe ... Im Westen ein totales Durcheinander von falschen und echten Begriffen.“ In dieses „totale Durcheinander“ von Gut und Böse, von menschlicher Güte, Betrug, halb lächerlicher, halb schädlicher Geschäftigkeit „christlich-abendländischer“ Manager, von Geheimagenten und Bürokraten stellt Henz die verlorene Schar seiner Ungarnflüchtlinge hinein. Der Schauplatz ist Österreich, die Zeit: jene Jahre. Man erkennt Wien. Mariazell, man glaubt, vielleicht irrtümlich, bekannten Gestalten des öffentlichen Lebens auf die Spur — und auf die Schliche zu kommen. Man erkennt sie nach ihren Gesten, Redewendungen und noch mehr nach dem, was sie sagen. Aber es sind doch wohl nur Zufälle.
Was jedoch das Ganze betrifft: es stimmt. So war es, so waren wir damals, Gäste und Gastgeber, Verfolger und Verfolgte, Denker und „Menschen der Tat“, Ehepaare, junge und alte, Professoren, Schüler. Nach einer Verfolgungsjagd voll skurriler Szenen findet der unbeholfene Professor seine Frau und vielleicht auch sich selbst — das wird aber am Ende nur noch angedeutet.
Offen bleibt die unausgesprochene Frage nach dem „Wir“. Die bittersten Zeilen des Buches sind gegen dieses Wir gerichtet. Christen, Österreicher kommen an die Reihe. Wahrheit vermengt sich mit Halb-wahrheiten, mit krassen Übertreibungen, im bunten Wechselspiel der Reden am Biertisch, im Zimmer des Sanatoriums, in Eisenbahnabteilen, im bürgerlichen Heim. So verlangt es die Technik des Romans, so will es der Autor selbst.
Das Gespräch mit den Menschen von drüben ist zugleich immer auch ein Gericht über sich selbst. Die Fürsprecher der Ost-West-Kontakte sind oft viel zu sehr mit der Frage beschäftigt, wie man die verhärteten Fronten „auflockern“ könnte. Rudolf Henz ist keiner von diesen schlauen oder, bestenfalls, naiven Pragmatikern. Er zeigt den Lesern seines Romans den schwierigeren Weg menschlicher Begegnungen. Einer, der um „Kontakte“ bemüht ist, müßte zuerst wissen, wo er steht, woran er wirklich glaubt. Da heißt es auf den letzten Seiten: „Da muß einer doch innerlich an die Ordnung glauben ...“ Und, als Schlußwo-t: „Wir dürfen heute nur das Nocherruchbare erbitten, das Allernächste.“ Näher besehen, das sind nicht Worte eines Nur-Pessimisten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!