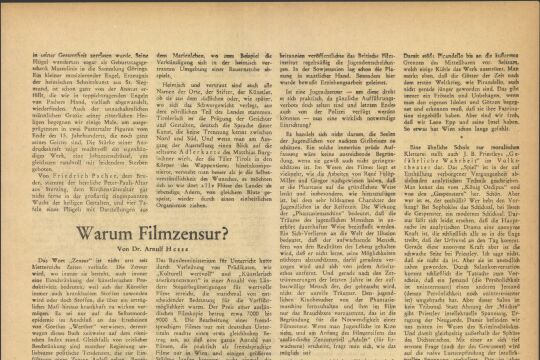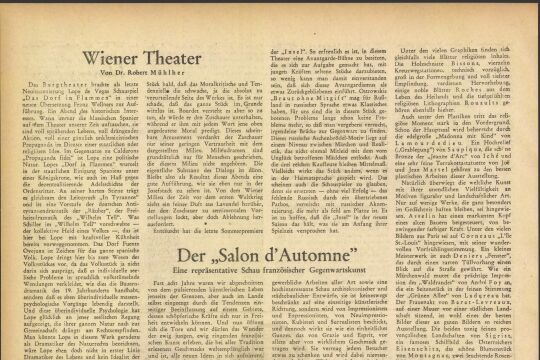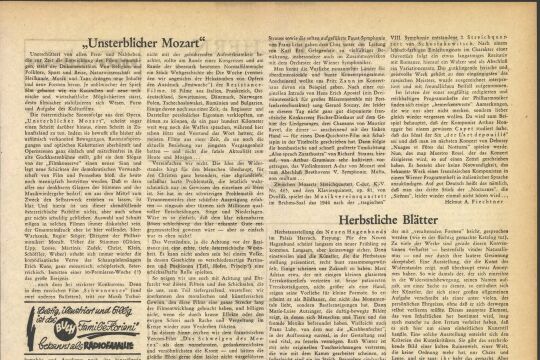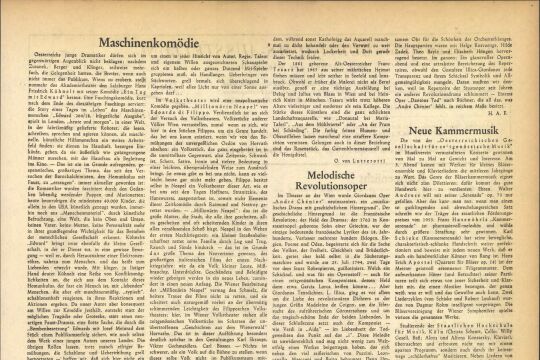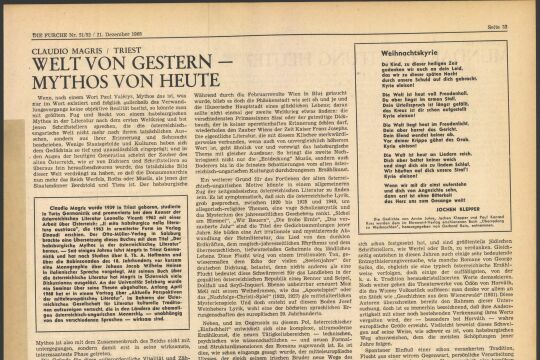Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Scherz und Ernst im Lustspiel
Die Wiener Theaterdirektoren, scheinen eine glückliche Hand für das Lustspiel zu haben — was man ihnen in anderen Bereichen der dramatischen Kunst nur schwerlich nachsagen kann. Die Tatsachen und die Erfolge stehen aber fest. Nestroys „Talismann“ brachte es in der Josefstadt zu fünfzig Aufführungen; die ebenso moralische wie köstliche Geschichte von der inneren Wandlung eines allseitig verspotteten „Rotschädls“, dem sein Talismann, eine Perücke^ erst Glück bringt, als er sich endgültig von ihm trennt, vereinigt Scherz, Ernst, Satire und Ironie in tieferer Bedeutung in jenem Maße, welche dem Wiener Publikum bekömmlich und erträglich ist. Hier feiert jener oft zu Unrecht verkannte Humanismus des „Volkes“ der „einfachen“, der „kleinen Leute“ Triumphe, die ihm gerade unsere Zeit nicht vorenthalten sollte. Dieser Wiener Volkshumanismus, in vielen Zügen Erbe österreichischer Barockkultur, sucht die Not der Zeit, die oft brutale Übermacht gesellschaftlicher Verhältnisse, die- Herbheit der Herzen und die spröde Schärfe enger Geister — also „das Leben“ — dadurch zu überwinden, daß er das Menschliche menschlich nimmt. Jede Epoche, jede Zeit hat ihre Fehler, ihr Schönheitspflästerchen ist fast immer, wenn man näherzu hinsieht, nicht ein niedliches kleines schwarzes Mal, sondern ein großer, mehr oder minder geschickt angelegter Verband, der auf einer tiefen, oft eiternden Wunde aufliegt. Das Entscheidende ist aber nicht die Wunde — nicht auf sie richtet sich ausschließlich der Blick unseres „humoristischen“ Dichters, sondern die Tatsache, daß diese Wunde einem menschlichen Antlitz anhaftet: die große und wahrhaft humanistische Bedeutung des Wiener Volksschauspiels alten Stils, seiner Dichter und Schau-pieler ruht eben in diesem ganzheitlichen Vermögen: den Menschen und das heißt hier das Individuum, die „Person“ so zu nehmen, wie sie ist — fhn also letzten Endes mit all seinen Fehlern, Schwächen und Eigenheiten zu bejahen.
Wien hat nun gegenwärtig Gelegenheit, an ihrem Humor die Völker und Zeiten kennenzulernen! Das Volkstheater bringt Ostrowskis Ein junger Mann macht Karrier e“, das Studio der Josefstadt Molieres „George D a n d i n“ und, in einer Nachdichtung des genialen und unglücklichen J. M. R. L e n z, di antike Komödie des Plaut us „Miles glori'osus“ als „H auptmann Großmau 1“. Vielleicht offenbaren die Völker ihr Wesen stärker im Komischen als im Tragisdien; wenn wir hier von der tief inneren Verwandtschaft dieser beiden Bereiche des Dramatischen absehen wollen — gleiten sie doch, wie ein antiker Januskopf oder ein modernes Gesicht Picassos, ständig ineinander über —, dann dürfen wir sagen, daß gerade das Komische und Humoristische tiefe Wesenszüge des Nationalen aufzeigt. Hier aber erweist sich wieder ein beachtlicher Unterschied zwischen dem Komischen und dem Humoristischen: letzteres ist oft oberflächlicher und tiefer als das erstere! Beweis dafür die Tatsache, daß die Witze anderer Nationen meist unübersetzbar sind — was etwa dem Engländer humoristisch erscheint, zeigt sich dem Kontinentalen als farblos oder gar als fatale Grimasse — und umgekehrt. Der Humor eines Volkes lotet eben in Tiefen hinab, welche nur der Betroffene, der Verwandte erspürt und er gleitet, leicht spielend über Oberflächen hinweg, deren Glanz und Brüchigkeit nur der Träger zu würdigen weiß. Anders die große Komödie der Völker: sie hebt Eitelkeit, Narrheit und Aberwitz einer Epoche ins Zeitlose hinauf, und zwar gerade durch das ihr eigentümliche Vermögen, die Sonderheit als Sonderlichkeit zu entlarven und das Maskenspiel der Geschichte heimzuholen in die ewige Kinderstube des Menschlich — allzu Menschlichen! Deshalb können wir in diesem zwielichtigen Vorfrühling 1947 lachen über die Fabelgestalten eines Plautus, Moliere, Ostrowski und Nestroy! Lachen, jawohl, aber nicht nur das — wir können auch die tiefen Unterschiede des Nationalen und Zeithaften gerade in der Komödie nachdenklich beobachten. Und wenn wir dies besehen, dann rücken plötzlich, in erstaunlicher und bedeutsamer Weise der Franzose und der Russe, einerseits und zum anderen der spätantike Römer und der Wiener zusammen! Bei Moliere und Ostrowski steht die Gesellschaft und die Kritik an ihr im Vordergrund, bei Plautus und Nestroy das Individuum und sein persönliches Schicksal! George Dandin ist nicht nur die Geschichte eines „reichen Landmannes“, der von seiner adeligen Frau und deren Sippschaft betrogen wird, sondern ein kulturpolitisches Manifest des „Dritten Standes“ gegen den „Zweiten“ — der empörte Aufschrei des um seine „Menschenrechte“ betrogenen Bürgertums gegen die Herrschaft eines Adels, dem sein Noblesse oblige zum Schild sehr unadeliger Gelüste dient. Moliere unterstreicht es mit jeder höfischen Handbewegung seines Adelsherrn und mit jedem hilflosen Händeringen seines Bürgers: der wahre Adel ist bei dem armen Hahnrei, der sich mit nichts verteidigen kann als mit einem reumütigen, offenherzigen Bekenntnis seiner früheren Fehler.... Auch bei dem Russen Ostrowski steht die Gesellschaft im Vordergrund; nur ist hier ein bedeutsamer Unterschied zu Moliere: dieser zaristischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts gehören alle an; sie alle, General, Minister, vornehme Damen, Bäuerin und der junge Mann, der in dieser Gesellschaft Karriere macht, sind Spieler derselben Torheiten und Eitelkeiten, mischen dieselben Karten der Verblendung, der Lüge und Korruption! Gelassen — froh blickt der Dichter auf seine Puppen — er weiß, e r ist noch nicht der Sturm, der diese Gesellschaft hinwegfegen wird — er wird diesem aber den Weg bereiten durch . seine literarischen und künstlerischen Arbeiten: die Rolle des russischen Intellektuellen im 19. Jahrhundert, welche dieser bewußt und unbewußt zu spielen übernommen hat. Moliere und Ostrowski stehen sich also, trotz beachtlicher Unterschiede und Gegensätze, im Innersten nah: genau so wie die französische Revolution von 1789 und die russische Revolution von 1917 sich nahestehen! Anders die Welt des
Plautus. Hier sind Zeit und Gesellschaft nur Kulisse für das Spiel der Intrigen und Amouren einzelner Personen; in Vordergrund stehen durchaus dieser stutzerische Pyrgopolinikes, diese klug-schöne Philo-komasion, die sehr genau weiß, was sie will und nicht zuletzt die bald schlauen, bald tölpischen Bedienten. Auf die Zeichnung der Sklaven Palästrio und Skeledrus verwendet Plautus — Lenz meh- Liebe und Sorgfalt als der Russe auf seine Generale und hohen Damen. Der Russe und der Franzose beleuchten durch ihre F i-g u r e n die Gesellschaft ihrer Epoche, der Römer und der Wiener beleuchten durch das Zeitkolorit ihre Personen! Diese innere Verwandtschaft kam nicht uneben sogar im Kostüm zum Ausdruck. Der Adel Molieres mußte seine Allongeperücke, der russische General mußte seine Uniform tragen, bei Plautus aber konnten, ohne störend zu wirken, die Personen antikisch-hellenistisch und empire-biedermeierlich gekleidet erscheinen — Nestroys Rotschädl könnte auch einen zeitlosen Kuttenrock tragen.
Um beim Kostüm zu bleiben: in der Uraufführung der dramatischen Skizze „G e-gen Agamemnon“ von Kurt Radlecker im Studio der Hochschulen erscheinen Agamemnon in Hose und Stiefel eines Offiziers der Wehrmacht, Klytemnestra im Pelz, Iphigenie im modernen Jungmädchenkleid, der Seher Kal-chas im grauen Straßenanzug mit Feld-predigerpelerine. Der Melder wird mit dem Fahrrad weggeschickt, der Seher hört im .Rundfunk die Frontberichte vom trojanischen Kriegsschauplatz ab, man vernimmt das Donnern der Granaten und das Wummern einschlagender Bomben. Schauplatz also: Europa 800 vor Christi und 1914, 1939 und 1947. Agamemnon ist ein sehr strebsamer Offizier, den gewisse sentimentale Anwandlungen und Familienrücksichten nicht hindern, Kind und Volk seiner Eitelkeit, welche er mit schöner Scham „Vaterland“ nennt, aufzuopfern. Ein Stück gegen den Krieg also: gegen den Krieg, wie er immer wieder aus dem Herzen der Machtsüchtigen und den Hirnen der Besessenen aufbricht. Uber die dichterische Dichte und Qualität des Stückes kann man geteilter Meinung sein. Nicht jedoch sollte man dies sein über die erfreuliche und nachdenkenswerte Tatsache, daß junge Menschen, heute Studenten, gestern selbst noch Soldaten, etwas, das „Es“ des so gerne namenlos-notwendig sich gebenden Krieges, zu einem Vorspiel gestalten möchten, das viel zu vielen — Älteren und Größeren und Mächtigeren — immer noch als ein Vor-, Zwischen- und Nachspiel erscheint, das sie auf der Bühne ihres Lebens nicht missen mögen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!