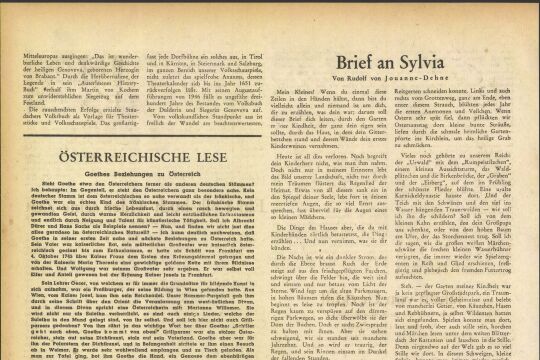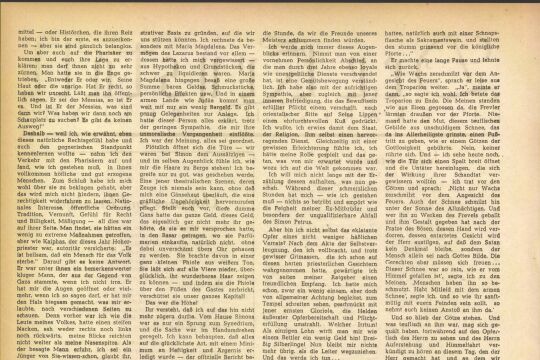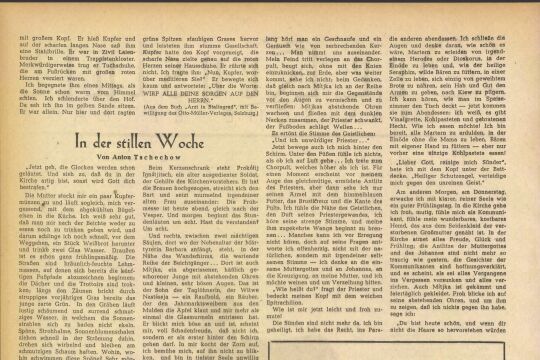Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
SONNTAG IN FREMDEN STADTEN
In manchen fremden Städten habe ich den Sonntag erlebt. In einer polnischen Kleinstadt, die inmitten der Ebene mit den hineingeduckten, strohbedeckten Hütten der Dörfer liegt, aus denen die Zwiebeltürme der Kirchen wie schmerzliche Träume aus dunkler Vereinsamung aufsteigen — in diesem Städtchen war alles selbstbewußt, die Apotheke mit geschlossenen, verrosteten Eisentüren, der Griff einer Ziehglocke neben der Tür eines Hauses mit keck geschwungenem Giebel, die verstaubte Akazienallee, in der am Abend im spärlichen Gaslicht der Eisenkandelaber, von denen der grüne Lack abbröckelte, jung und alt beisammensteht oder hin und her schlendert, nicht zu weit, denn die Allee verläuft sich ins Dunkle, ins flache, gestaltlose Bauernland, das wie eine lebenslängliche Verbannung ohne Hoffnung ist. Wie gut lebt es sich in dem Städtchen, man darf hier froh und stolz sein.
Oder ein Sonntag in Pisa, nach einem kurzen, warmen Frühlingsregen. Der Rasen im mauerumschlossenen Geviert des Campo Santo ist unterm Zusehen grün geworden, ein Grün, sanft wie für Engelfüße; der weiße Marmor des Doms verströmt einen warmen Duft, aber er ist herb wie die Linien der Architektur. Unterm schiefen Turm geht ein Leichenzug vorüber, er eilt, die Laternen, welche die Ministranten tragen, schaukeln in den Gabeln an den Stangen wie in einem unspürbaren Wind; die schwarze Soutane des Priesters ist aufgeregt vor den raschen Schritten der Füße in den derben Schuhen; die lamentierenden Weiber schnappen nach Luft, so rasch geht alles vor sich.
Ein Sonntagnachmittag im bulgarischen Warna. Morgenländische Glut des Lichtes, ein Zittern in der Luft, das Schwarze Meer in barbarisch ungestümen Farben schimmernd. Ein uralter Mann in seinem Kaffeeladen hält ein Messingkännchen in eine Mauernische über glimmende Holzkohlen. Männer im Turm schlagen mit Hämmern gegen die Glocken, als wollten sie den Metallmantel zerschlagen.
Ein Sorintägmörgen in'einem südfranzösischen Städtchen, das im grellen Licht noch schläft. Die Fensterläden an den Steinmauern sind geschlossen; ihr Grün ist wie altes, weißbestaubtes Laub vor einem Stamm mit dicker, grauer, rissiger Rinde. Eine Katze putzt sich auf der Türschwelle und kauert sich dann in den Winkel, da ihr niemand öffnet — sie hätte so gern die Ratte gezeigt, die sie durch einen geschickten Biß ins Genick getötet hat, so daß kein Tröpfchen Blut zu sehen ist. Da liegt die Ratte, ein schönes, sauberes Tier, als schliefe sie wie die Mademoiselle de la nuit nach ihren dunklen Abenteuern. Kirchenglocken beginnen zu läuten, viele und wohlgestimmt, aber kein Laden, keine Tür öffnet sich.
Ein Sonntagnachmittag im dänischen Städtchen Ribe. Die Gasse zwischen den weißgekalkten Häusern, die vom langen Dastehen in die Erde gesunken scheinen und wie Spielzeughäuser aus einem Märchen von Andersen anmuten — die mit Katzenköpfen gepflasterte Gasse ist leer. Hinter einem der niedrigen, kleinen Fenster bewegt sich eine schneeweiße Gardine und schiebt sich eine Handbreit auseinander. Das blütenweiße Haar einer Greisin ist vor dem roten Samt eines hohen Stuhls zu erkennen. Aus dem pergamentenen Gesicht schauen zwei neugierige Augen auf den Spiegel — zwei davon sind, schräg gegeneinander gestellt, blank geputzt, am Fensterrahmen angebracht. In diesen „Spionen“ läßt sich alles, was auf der Straße vorgeht, beobachten, ohne daß man selber gesehen wird.
Von vielen Sonntagen in fremden Städten könnte ich erzählen. Alle haben etwas Gemeinsames, der Sonntag verwandelt in allen Ländern auf dieselbe Weise: er entrückt. Auch die Fremde tut es. So ist der Sonntag in einer fremden Stadt eine doppelte Entrückung, eine Verzauberung, aber auch etwas Spukhaftes. Man ist da und lebt, und alles und alle, die man nicht kennt und von denen man nicht gekannt wird, sie leben auch, aber man weiß nichts von dem langen Vorher und wird auch von dem Nachher nichts erfahren, man erhascht nur den Augenblick eines Tages aus der Lebenszeit der Stadt und ihrer Menschen, und vor allem: man gehört nicht dazu. Es sind wie zwei verschiedene Leben, das eigene und das aller anderen. Man sieht das fremde Leben wie — ja, wie sieht man es nur? Vielleicht wie ein Toter, der wiederkehren durfte, ein Revenant.
Man promeniert mit den Polen und Polinnen unter den verstaubten Akazien auf und ab, man spürt den staubigen Geruch der Straße und den weißen Duft der Blüten, man hat selber Bangigkeit vor dem Land, dahin die baumlos gewordene Straße weiterläuft wie in etwas, wo es kaum noch einen Trost gibt.
Der Leichenzug in Pisa weht wie ein Spukbild dahin, man staunt über das kreischende Gebaren der Klageweiber, unbekannt und wesenlos ist einem der, welcher zu Grabe getragen wird, ja der Tod selbst.
Der Greis in dem Kaffeehaus in Warna, der die fremdländischen Badegäste bedienen muß, dieser Greis, dessen lederbraune, zittrige Hände das Kännchen am Griff über die glühenden Holzkohlen hielt, trug doch einen Turban? Hatten die Türken, als sie vor zweihundert Jahren abziehen mußten, ihn als Knaben hier vergessen? Weiß er gar nicht, daß seine Glaubensgenossen nicht mehr hier sind? Für ihn sind sie noch da. Wenn die Christenmänner mit dem häßlichen Lärm des Glockenläutens aufgehört haben werden,wird in der silberweißen Abenddämmerung der Muezzin seine Gebetsstunde vom Minarett herab ausrufen.
Der Schlaf, den das südfranzösische Städtchen bis tief in den Tag hinein ausdehnt, selbst dieser Schlaf mutet in einer fremden Stadt fremd an. Man ist mit dem Frühzug angekommen, aber man ist nicht müde, nur traumverloren, und geht wach und auch munter durch die noch schlafende Stadt — und erschrickt plötzlich. Wird sie überhaupt erwachen? Geht man nicht als einziger Lebender durch eine abgestorbene Stadt?
Wie eine unveränderliche Figurine in einer Puppenstadt sitzt die Greisin von Ribe hinter den Gardinen des Fensters, nur ihre Augen leben, staunen, mißtrauen, daß zu dieser Stunde ein Mensch durch die Gasse kommt. Sie hält es nicht für möglich, sie schiebt die Gardine zurück, der Fensterspiegel könnte ihr etwas vorgetäuscht haben. Sie kann sich nicht erinnern, daß zu dieser Stunde am Sonntag nach dem Mittagessen, da alles daheim bleibt und ausruht, je ein Mensch durch die Gasse ging, und ihre Erinnerung reicht weit zurück. Wie spät kann es überhaupt sein? Sie lauscht, eine Stunde schlägt vom nahen Kirchturm — der Fremde zählt sie nicht, er ist an keine Zeit gebunden. Nach dem Stundenschlag klingt es wie das Röcheln eines alten Menschen, den schon die wenigen Worte angestrengt haben. Dann klingt das Glockenspiel, ein heiseres, verstimmtes Trällern, als sänge eine einfältige Greisin, und sie singt mühsam und falsch. „Ein Fremder“, stellt die Greisin fest. „Wie kommt ein Fremder in unsere Stadt?“ Es ist wie ein Vorwurf. „Was will er hier zu so ungewohnter Stunde? Man muß sich ihn merken, wenn morgen vielleicht in der Zeitung stünde...“ Sie schiebt verdrießlich die Gardine zu, lehnt sich in den Stuhl zurück und erwischt das letzte Zipfelchen ihres unterbrochenen Mittagsschlafes.
Oft erlebte ich den Sonntag in fremden Städten, nicht einen bestimmten Sonntag, dessen Datum sich festlegen ließe, denn es. war immer der Sonntag. Und niemals erlebte ich die Fremde so richtig wie am Sonntag.
... Ich hätte das mit dem Sonntag in fremden Städten wohl wie so vieles vergessen. Jetzt aber ist es mir gegenwärtig bis in jede Kleinigkeit, vor allem in der seltsamen Entrücktheit. Ich lebe jetzt in einer kleinen Stadt, von deren Existenz ich vor wenigen Jahren nicht die geringste Ahnung gehabt hatte. Voraussichtlich werde ich bis zum Tode hier leben. Nach der Vertreibung aus meiner Heimat bin ich in diese kleine Stadt verschlagen worden. Ich kenne keinen Menschen, und niemand kennt mich. Ich bin da und lebe, und alles und alle, die ich nicht kenne, leben auch, aber man gehört nicht zu ihnen. Man lebt nicht mit dem Leben der anderen. Ich merkte das unlängst, als ein Leichenzug an mir vorüberkam, langsam, totenstill, feierlich. Ich blieb, wie ich es von daheim gewohnt bin, stehen, trat zur Seite, nahm den Hut ab, um den Toten zu grüßen, und ließ den Zug an mir vorübergehen. Ich fühlte hier dasselbe wie damals in Pisa. Daheim, da hätte ich gewußt, wen man zu Grabe trug, hätte sein Leben gekannt, hätte die Leidtragenden gekannt, wäre wohl selber im Leichenzug mitgegangen. Hier aber glitt alles fremd an einem Fremden vorüber, eben wie am Sonntag in einer fremden Stadt. Diesen Sonntag in einer fremden Stadt habe ich jetzt immer, an allen Tagen der Woche. Das entrückt auf stille und schmerzliche Weise, macht die Stadt und die Menschen und das Leben in ihr ein wenig gespensterhaft, und man selber fühlt sich plötzlich selbst als Fremden und unwirklich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!