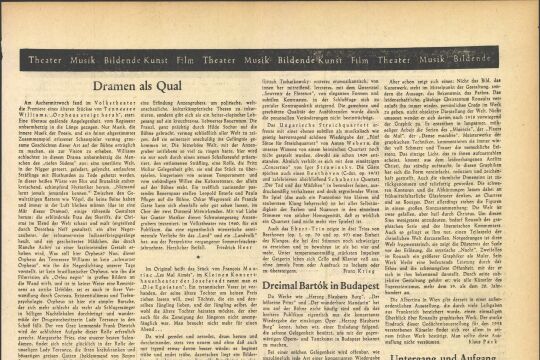Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Spielbeginn ohne Ereignis
Da sitzen sie nun wieder an den Stätten der gewerbsmäßigen Täuschung, nachdem sie ein paar Wochen lang Wald-, See- oder Meeresluft geatmet und verdrossen diesen Sommer der vielen Tiefs und Zwischenhochs über sich haben ergehen lassen, sitzen im verdunkelten Zuschauerraum, bereit, sich ergreifen und verzaubern zu lassen. Nach der langen Ferienpause ist mehr Theaterkraft denn je dazu nötig; die Sinne sind geschärfter, die Erwartungen größer: Laßt sehen, was ihr uns bereitet habt!
Vom Thema her wäre das Schauspiel „Der Tag es Zorns“ des Polen Roman Brandstaetter, eines zum Katholizismus konvertierten Juden, ein großes Unterfangen. „Die Leiden der Juden sind die Leiden Gottes. Die Tragödie der Juden ist die Tragödie Gottes“, klärt der Handwerker Emmanuel Blatt in der Auseinandersetzung mit dem Prior des Klosters, in das der von der SS gehetzte Jude aus Angst geflüchtet ist. Und die polnischen Mönche läßt der Dichter rezitieren: „Das gotische Refektorium unseres Klosters / Ist ein Bildnis der Zeit. / In diesem Bild sind umschlossen / Der Mensch durch Gottes Hilfe / Und Gott, durch die Mithilfe des Menschen.“ Das Ringen des Menschen um Gott, vor dem er sich beim Jüngsten Gericht, am „Tage des Zorns“ wird verantworten müssen, die Verlagerung der Apokalypse in das von der SS heimgesuchte Polen, das Schicksal des jüdischen Flüchtlings in der Nachfolge Christi, wenn ihm der satanische SS-Sturmbannführer Born ein Stück Stacheldraht wie eine Dornenkrone aufs Haupt drückt und die Mönche höhnisch auffordert, dem Gepeinigten zu huldigen — alles das, religiöses Mysterium und Zeitgeschichte, zusammen-zuzwingen, geht über die Möglichkeiten eines Bühnendramas oder verlangt zumindest nach einem dramatischen Genie.
Der Dramatiker Roman Brandstaetter (der sich gern einen „Christen des Alten Testaments“ nennt und der in seinem Schauspiel kühn behauptet, daß nur der als vollgültiger Jude gelten könne, der Christus als wahren Gott erkennt) stellt jedoch bedenkenlos die lyrische Hymnik der Mönche („Laßt uns hineilen zu den Wunden Christi wie die Hirsche zur Tränke“) neben den platten Straßenjargon der Dirne Julia („Gott sitzt ruhig im Kaffeehaus, raucht Seine Zigarre und tut, als ob nichts wäre“). Gefährlicher, weil zu Mißdeutungen Anlaß gebend, eine andere Unvereinbarkeit: Der Zynismus des SS-Offiziers wird zur Dämonie des gefallenen Engels aufgewertet und die Ungeheuerlichkeiten der Hitler-Leute damit erklärt, daß sie ihr böses Ich in die Juden projiziert und so auf den Rosten gewissermaßen nur ihr eigenes Sein, den Haß gegen sich selbst verbrannt hätten. Man wird Brandstaetter eine oft beeindruk-kende Bildkraft seiner Sprache (die auch in der Ubersetzung von Gerda Hagenau erhalten bleibt) und einen bewunderswerten Mut inmitten einer nicht immer toleranten politischen Umwelt nachrühmen müssen. Aber Uberzeugung und Bekennermut reichen nicht hin für ein Bühnendrama.
Regisseur Wolfgang Liebeneiner hat leider, wie die Aufführung im Burgtheater (nach der Uraufführung in Bregenz) zeigt, nur wenig dazu getan, die dramatischen Schwächen zu überbrücken. Die Sprechchöre der Mönche lassen viel zu wünschen übrig. Von den Hauptdarstellern können nur Josef Meinrad in der kreatürlichen Angst des jüdischen Flüchtlings und Erich Auer als würdig-ernster und standhafter Prior überzeugen, weniger Hans Moog als zu klischeehafter Bösewicht und Blanche Aubry als Sünderin Julia. Sehr eindrucksvoll das Bühnenbild von Lois Egg mit dem riesenhaften, weit in den Raum ragenden Kruzifix und dem stilisierten Davidsstern an der Decke. Der Autor konnte höflichen Achtungsbeifall entgegennehmen.
•
Vielleicht findet sich einmal ein Regisseur, dem es gelingt, Grill-parzers „Sappho“ völlig dem alten Burgtheaterstil zu entreißen. Die Tragödie des künstlerischen Menschen (hier der Dichterin, als Gegenstück zu Goethes „Tasso“ gestaltet) reicht aus dem Pseudogriechentum weit ins Moderne hinein. Nicht mehr Tragödie oder gar Tragikomödie der alternden Frau (meist waren die Darstellerinnen dieser begehrten Rolle zu bejahrt), sondern schicksalsmäßiges Sondersein des Künstlers inmitten des einfachen Glücks der anderen (verkörpert durch Phaon und Melitta) — so dem Persönlichen entrückt, entfaltet Grillparzers Dichtung erst ihre ganze reizvolle Objektivität.
Regisseur Josef Gielen fand in Judith. Holzmeister eine Darstellerin der Sappho, die obiger Auffassung schon sehr nahekommt. Keine Heroine, sondern ein moderner Mensch. Eine schöne Leistung, neben der Jürgen Wilke als Phaon und Helma Gautier als Melitta gerade noch bestehen. Um sie herum ist freilich noch viel „altes BurgDer Enthusiast Zeichnung: Gerard Hoffnung theater“. Das Bühnenbild von Clemens Holzmeister: ein wuchtendes Quadermassiv vor blauem Griechenhimmel, scheint uns fast zu vordrängend für das subtile Drama auf der Bühne. Starker Beifall vor allem für die Hauptdarsteller. •
„Jeden Mittwoch“ betrügt John, wohlhabender, schon etwas bejahrter Busineßman, seine etwas geschwätzige, aber lebenskluge Frau Dorothy mit Ellen, einem etwas hausbackenen, doch sonst sympathischen Gänschen, in dem der Firma gehörigen und daher von der Steuer abzuschreibenden Landhaus. Gestört wird diese Gepflogenheit durch einen jungen Geschäftsmann, der den Älteren, trotz dessen „Scharfblick und der angeborenen Rücksichtslosigkeit eines Adlers“, bei dem jungen Mädchen schließlich aussticht. Diese am Broadway überaus erfolgreiche, jedoch ganz zu Unrecht als Komödie deklarierte Nichtigkeit wird in der Josefstadt (Regie Edwin Zbonek) von Vilma Degischer und Hans Holt als älteres, Elfriede Irrall und Hans Holmann als junges Paar virtuos gespielt. Das hübsche Bühnenbild steuerte Gaby Niedermoser bei. Das Publikum schien sich gut zu unterhalten.
Um eine Spur problematischer, wie immer, geht es im Kleinen Haus der Josefstadt im Konzerthaus zu. Die beiden Einakter des Amerikaners Murray Schisgal waren ebenfalls am Broadway erfolgreich, doch ist ihr etwas schwärzlicher Humor verschlagener als die harmlose Heiterkeit im Ehestück seiner Landsmännin. „Der Tiger“ ist ein sich als „Ubermensch“ gebärdender Briefträger, der eine harmlose Passantin auf der Straße überfällt und in seine Behausung schleppt, um an ihr einen Lustmord zu begehen. Aber die junge Dame, mit College-Halbbildung vollgepfropft, verwickelt den Mann in ihr überwältigendes Geschwätz und bringt ihn schließlich, selbst eine Tigerin, zur Strecke.
In Schisgals „Die Ttppser“ („The Typists“) sitzen ein verheirateter jüngerer Mann und ein unverheiratetes älteres Mädchen im Büro einander gegenüber und tippen Adressen. Vereinsamt, unglücklich, demonstrieren sie in Monologen und dialogischen Szenen den Leerlauf der Gefühle und das lebenslange, trostlose Warten auf etwas.
Was die Texte an Situationskomik hergeben, ist vor allem den Schauspielern zu danken. In der Tigerparodie brillieren Ursula Schult und Rudolf Rösner, im Büroalltag Helli Servi und Michael Toost. Regie führte Erich Winterstein. Beide Stücke gefielen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!