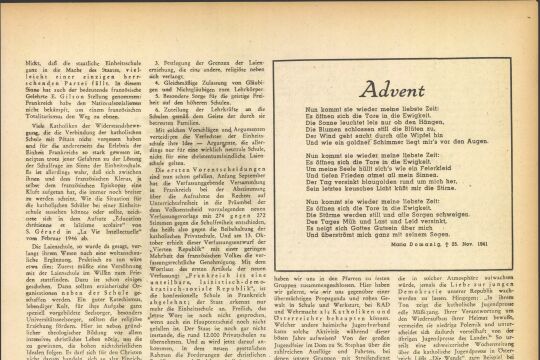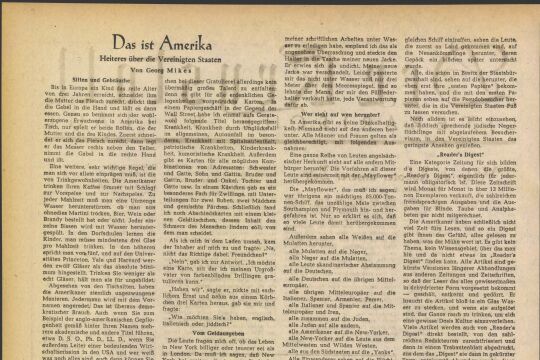Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Spinn, spinn, o Tochter mein“
FRÜHER NACHMITTAG, sieben Kilometer nordöstlich von Wiener Neustadt. Aus dem Fabriktore strömen Frauen. Wenige Männer sind darunter. Arbeitsschluß? Ja und nein: eine Partie kommt, eine geht — es ist Schichtwechsel. Um die volle Beschäftigung der wertvollen Fachkräfte sicherzustellen und um eine rationelle Auswertung des gerade im Ostteil unseres Landes so schwer getroffenen und mühevoll aufgebauten Maschinenparks zu ermöglichen, drehen sich in Oesterreich von 6 Uhr bis 22 Uhr in zwei und drei Schichten 630.000 Spindeln, rattern 13.800 Webstühle, darunter 5400 modern automatisierte. Mit 28.000 Beschäftigten stellt die Baumwollindustrie die stärkste Gruppe der Textilfabrikation Oesterreichs dar. Im vergangenen Jahr erzeugte der Baumwollsektor 42.000 Tonnen Garne und 151 Millionen Meter Gewebe.
Die Schicht hat begonnen. Der Werkmeister neben uns antwortet auf die Frage, ob eine Automatisierung noch viele der geschätzten Facharbeiter wird einsparen können, mit einem einfachen: „Nein!“ Und setzt, als wir zum Stapelraum gehen, hinzu: „Auch die Automatisierung hat ihre Grenzen. Wir schauen wie die Luchse auf die neuen Maschinen und sind bei jeder technischen Messe hinter ihnen her! Glauben Sie mir, uns entgeht nicht eine noch so kleine Walze, kein Drahtstift. Aber bei uns, sehen Sie, da muß eine feste innere Beziehung zwischen Arbeit und Arbeiter sein. Dort, ja dort diese Frau, das ist schon dritte Generation. Das trägt Geschick und Geschmack mit sich. Bei uns hat sich so etwas wie eine Familientradition ausgebildet. Das ersetzt, das gibt kein Automat. Dort liegen Baumwollstapel. Ja, man könnte sagen, sie erzählen Geschichten. Von gestern, heute und morgen. Man muß sie nur hören. Wir bei den Maschinen hören sie. Die meisten anderen Menschen — die sehen am Ende nur die schönen Stoffe in den Auslagen und reden von den Preisen, denen von gestern, von heute — und von morgen."
IN DER' STAPELHALLE riecht es fast wie in einer Konditorei. Der schwach süßliche Duft ist für diese Lager typisch. Da liegen die Baum- wollballen also. Viele reden davon, manches steht in den Zeitungen. Aber wer hat schon einen Ballen gesehen, weiß, wie er aussieht? Er ist in grobe Jute gepackt, von Metallreifen, sieben bis elf, umschlossen, wiegt über 200 Kilo und ist nicht größer als ein kleiner Schreibtisch. Der Inhalt dieses Ballens aber, einmal aufgebrochen, füllt mit seinem flockigen Inhalt ein ganzes Zimmer. Da die Fracht nach dem Umfang, nicht nach dem Gewicht bezahlt wird, sind die Flockenmassen so fest zusammengepreßt worden, daß man bei dem uneröffneten Ballen nicht einmal ein Messer hineinbringt. Wir zweifelten und versuchten es. Das Taschenmesser war uns mit seiner scharfen Spitze schließlich doch unversehrt lieber. Da und dort sehen wir eine Probe aus den Ballen. Wie soll man nun erkennen, was wertvoll, was weniger wertvolle Faser ist? Das liegt an der Länge der Faser. Die längste hat die ägyptische, die kürzeste die indische und pakistanische Baumwolle; das gebräuchlichste Mittel „1 inch" wird in Nord- und Südamerika angebaut. Schnell einen Baumwollbausch als Erinnerung eingesteckt und auf zum Vorwerk!
IN DEN REINIGUNGSMASCHINEN und dem Vorwerk wird das flockige Gut geschlagen, gerissen, angesaugt und weitergeschoben, über Walzen, die mit haarfeinen Nägeln bestückt sind, und von Flügelrädern gezogen und gewirbelt. Die anhaftenden Schalen der Früchte, die Verschmutzungen vom Felde, wie Sand und Blätter, werden so entfernt, die verfilzten Stellen aufgelockert. In den Mischkammern liegt das „weiße Gold“ — das diesen Namen in Nordamerika erhielt, und eher die Bezeichnung verdient, als das klare Wasser. Aber an Wasser, an einen zarten Wasserfall gemahnt die Karde '’Krempel), das ist die Maschine zum Lösen von Faserbüscheln und zum Parallellegen des Faserflors. Wie ein Schleier fällt er aus den Trommeln und wird bandförmig in Kannen gesammelt lieber die Strecken, zu den Flyern (deutsch auch „Fleiern" geschrieben) geht der Weg. In langen Reihen stehen die Maschinensätze, wie auf Vordermann auseerichfet. An den Lärm muß man sich — obschon geprüfter Großstädter — allmählich gewöhnen Kleine Lämpchen, rot, blau, gelb leuchten nur auf, wenn eine Störung den Arbeitsvorgang unterbricht. Und weil es eine ganze Weile keine gibt, hilft die Arbeiterin neben mir künstlich nach. Sind die Maschinen neuester Fertigung und die elektrischen Kon- trollanlagen dementsprechend, kann eine Arbeiterin zwanzig, ja dreißig Maschinen bedienen. So im Durchschnitt sind es meist ein halbes Dutzend. Wie man eine Störung merkt? „Das spürt man beinahe“, sagt das Mädchen nebenan. Sein Blick ist ruhig, er wandert nicht von links nach rechts, wie jener des Zuschauers bei einem Tennisspiel. Alle Geschwister dieses schwarzhaarigen Mädchens sind „bei der Baumwolle" und, wie es gleich hinzusetzt, „wir tragen sie auch und bekommen sie nicht satt". Das ist also etwas anders als bei den Konditoren, an die wir im Stapelraum erinnert wurden, wo der Lehrling das Süße und so Begehrliche bald sattkriegt. Vom traurigen Liede: „Spinn, spinn, o Tochter mein“ ist hier in diesem tobenden
Wirbel keine Rede. Auch nicht bei den Spinnmaschinen. In langer Reihe sind da die Spindeln aufgesteckt, 400 und etliche mehr. Wie eine Wand ziehen die weißen Fäden, einer dicht neben dem anderen, ihre Bahn von der Vorgarnspule durch den ersten Zylinder über die immer schneller laufenden zwei und drei weiteren Walzenpaare. Wenn einer dieser Fäden reißt,
muß die Spinnerin flink das Ende fangen und wieder an die sich unentwegt drehenden Walzen anlegen („andrehen“ heißt es fachlich). „Probieren Sie es einmal“, fordert die Aibeiterin den Besuch auf. Ach, der Versuch fiel jämmerlich aus. Die Fabrik käme mit mir nicht auf ihre Rechnung. Wer. der die herrlichen Decken, die Hemden, die Pyjamas, Badeanzüge, die Tischtücher in den Auslagen unserer Geschäfte bewundert, wer, der täglich den Waschlappen einseift und das Frottierhandtuch schwingt, ahnt auch nur ganz wenig von der Mühe, die es einer dieser wieselflink hin und her huschenden Spinnerinnen einmal gekostet hat, bloß einen gerissenen Faden anzudrehen. Es gibt, wie der hinzutretende Meister erzählt, Frauen die mit doppelt soviel Lebensjahren die Hilfskraft eines jungen Mädchens sind. Diese Arbeiterinnen — das sieht man an ihren Mienen — lieben ihre Tätigkeit. Hier lebt etwas ganz Irrationales, Unterbewußtes. Die Großmutter brachte schon den leicht süßlichen Geruch der Bauwolle mit der Arbeitskleidung heim, er umfloß die Mutter und begleitete die Tochter. Es ist ein Leben und Werden aus und mit der Arbeit. Und diese Arbeit der Generationen hat der österreichischen Textilindustrie und speziell wieder der Baumwolle ihre Resonanz verschafft. Wer Arbeit als Lebenssinn, Art der Arbeit als Ausprägung eines Charakters schätzt und begreift, der braucht nur in unsere Spinnereien zU‘ gehen. Wenn auch — und gerade weil — Radio, Illustrierte und Wochenschau von diesen Menschen hier nichts zu berichten haben.
DIE BAUMWOLLINDUSTRIE ÖSTER- PvEICHS hatte große Schwierigkeiten zu überwinden. Von den Kriegs- urid Nachkriegsfolgen sprachen wir schon. Die totale Liberalisierung beengte dann den Inlandsmarkt. 1954 wurden 747 Tonnen Baumwollgarne im Werte von 68 Millionen, 1956 bereits 1460 Tonnen im Werte von 105 Millionen Schilling eingeführt. Baumwollgewebe kamen 1954 1365 Tonnen, 1956 aber 3281 Tonnen Von auswärts. Dazu ist in Rechnung zu ziehen, daß die angestammten Ost und Südostmärkte, die vor dem Kriege 86 Prozent der Garaausfuhren und rund 53 Prozent der Gewebeausfuhren aufnahinen, nach 1945 durch die geänderten politischen Verhältnisse praktisch aiftfielen. Es mußte von Oesterreich die Suche nach neuen Absatzmärkten gegen die schärfste Auslandskonkurrenz begonnen werden. Den Exportbestrebungen ist zwar ein Erfolg in den Jahren 1954 und 1955 zuteil geworden, aber im Vorjahre gab es einen Rückschlag. Es ist daher Aufgabe vorsorglicher Handelspolitik, Aufgabe sozialer Betreuung. Aufgabe der Werbung, in erster Linie den Inlandsmarkt aufzuschließen. Da trifft es sich wie gewünscht, daß vor kurzer Zeit ein „Oesterreichisches Baumwollinstitut" mit dem Sitze in Wien ge- gründet wurde. Hier werden sich Marktforschung, Fachkunde und soziale Gesinnung vereinigen können, und es ist anzunehmen, daß sowohl bei der im Herbst stattfindenden 7. Wiener Damenmode-Woche wie auf der für 25. September in Venedig angesetzten internationalen Konferenz der Federation of Cotton and Allied Textile Industries, wobei eine überstaatliche Baumwollmodeschau veranstaltet werden wird, der Name Oesterreich beachtlich in Erscheinung tritt. Unsere Volkswirtschaft kann vom Baumw'ollsektor wertvolle Kräftigung erwarten. Bei uns belief sich der Jahresverbrauch an Baumwolle und Kunstfasern auf 4.5 Kilogramm je Kopf der Bevölkerung, während die Quote in England 10,4 und in den USA sogar 17.4 beträgt. Man begnüge sich also nicht an verantwortlicher handelspolitischer Stelle mit der Leierkastenmelodie der „ungeschwächten Konjunktur“, sondern sehe dort nach, wo Garantien bestehen, daß eine Markterweiterung sozialpolitische Gewinne verheißt. Für die nächste Zeit ist eine Einschaltung der öffentlichen Meinungsforschungsinstitute zu erwarten. Daraus können wertvolle Schlüsse gezogen werden. Fingerzeige; den festen Handgriff aber, gleich dem der Arbeiterinnen und Arbeiter draußen vor den Toren Wiens, müssen wir alle tun, oben und unten, rechts und links. Auf der Heimfahrt durch die Dämmerung, während in der Ferne die Lichter der Fabrik versinken, gehen mir die Worte der Arbeiterin immer wieder durch den Kopf, jener Frau, die jetzt bald dreißig Jahre an der Maschine steht und sagte: „Als der Krieg aus war, hab ich zuerst den Schutt sortiert und brauchbare Maschinenteile herausgeklaubt. Ja, ich hätt’ leicht eine besser bezahlte Arbeit gefunden. Aber wo ich einmal gestanden bin, dort bleib’ ich."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!