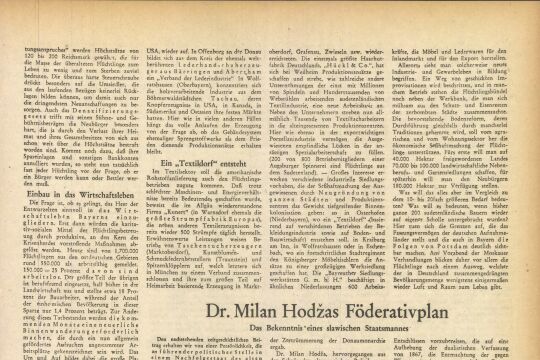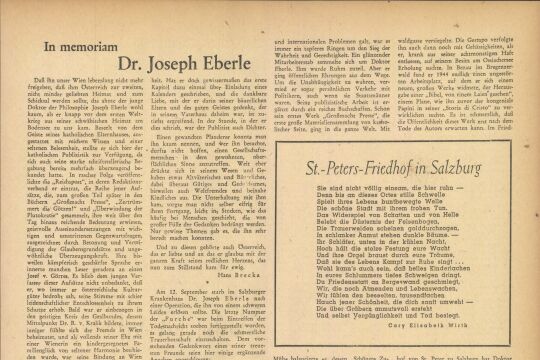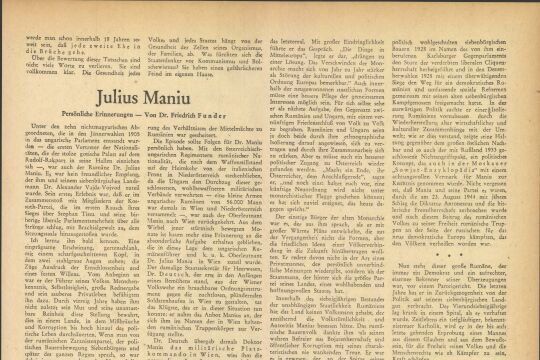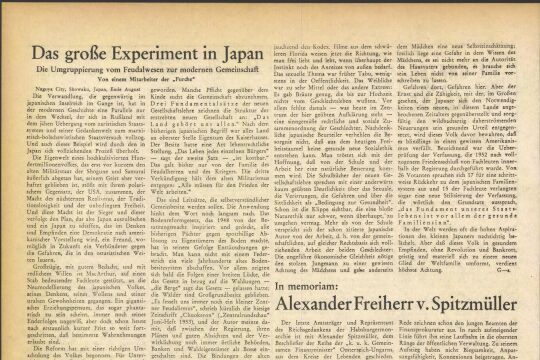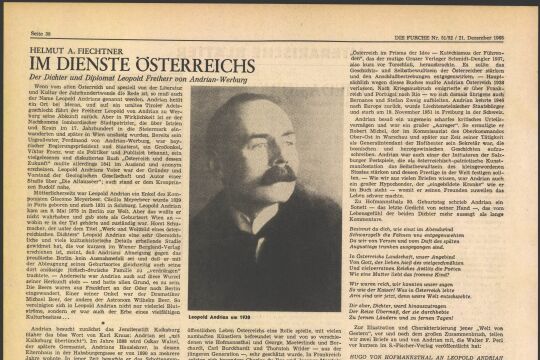Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Stephan Ludwig Roth
Ich zweifle nicht an der Zukunft — aber noch viele Zähren werden auf die verwüstete Erde fallen, ehe glückliche Menschen an den Früchten sich nähren werden, die unsere blutige Zeit in die Furchen streut.“
Ich zweifle nicht an der Zukunft — aber noch viele Zähren werden auf die verwüstete Erde fallen, ehe glückliche Menschen an den Früchten sich nähren werden, die unsere blutige Zeit in die Furchen streut.“
Stephan Ludwig Roth, 1848
Als St. L. Roth im Jahre 1796 zu Me- diasch in Siebenbürgen als Sprosse im Land eingesessener alter deutscher Kolonistengeschlechter geboren wurde, gehörte Siebenbürgen schon 100 Jahre lang, seit dem Karlowitzer Frieden, zu Österreich. Das Bewußtsein, Österreicher und Bürger eines europäischen Großstaates zu sein, hat seinem ganzen Leben die Note gegeben. Die Hauptstadt des Reiches lernte er zum ersten Male 1817, also zwei Jahre nach dem Wiener Kongreß, kennen. Sie war damals Sitz der „Siebenbürgischen Hofkanzlei“, durch die der Monarch das entfernte Kronland regierte, beherbergte in ihren Mauern aber auch eine beträchtliche Anzahl sieben- bürgisch-sächsischer Intellektueller, die dem jungen, mit dem Großstadtleben noch nicht vertrauten Studenten gerne an die Hand gingen.
Allein nicht Wien, etwas ganz anderes sollte dem jungen Siebenbürger bei seiner ersten Ausfahrt in die Welt zum großen Erlebnis weirden: die österreichische Landschaft.
Das Reiseziel Roths hieß gar nicht Wien, Es lag sehr viel weiter. Da er, in die Fußtapfen seines Vaters tretend. Theologie studieren wollte, Österreich aber damalj keine protestantischen Fakultäten besaß, mußte er ins Ausland gehen. Seine Wahl war auf Tübingen gefallen. Nun sagte ihm aber gar nicht zu, den langen Weg dorthin in der Postkutsche zurückzulegen. Schon in Linz verließ er sie und entschloß sich, zu Fuß einen weiten Umweg über das Gebirge zu machen.
So durchwandert er Oberösterreich, das Salzkammergut, Salzburg, das Berchtesgadener Land und einen Teil Bayerns und wird unter dem Eindruck des im Gegensatz zu seiner siebenbürgischen Heimat so überaus wasserreichen Alpenvorlandes mit seinen Schönheiten und seiner urtümlichen Bevölkerung zum — Schriftsteller. In den ersten Tübinger Monaten entsteht aus mitgebrachten Tagebuchaufzeichnungen sein Erstlingswerk „Gemälde einer Reise …“ Es enthält saubere Schilderungen österreichischer Städte- und Landschaftsbilder, ernste und heitere Reiseerlebnisse und tiefsinnige, für den 21jährigen Jüngling erstaunlich reife Betrachtungen. Manche Teile des Buches weiten sich zu novellistischen Erzählungen aus. Das kleine Werk verrät das Stil- und Sprachgefühl des geborenen Künstlers und liest sich noch heute gut und genußreich. Es darf zu den Köstlichkeiten österreichischer Reiseliteratur gezählt werden.
Nach seiner Heimkehr aus Deutschland und der Schweiz, wo er besonders in Pestalozzis Erziehungsreformen tiefen Einblick genommen hatte, versuchte Roth seine dort erworbenen Kenntnisse in den Dienst seines österreichischen Vaterlandes zu stellen. Er stieß dabei nicht immer auf Verständnis. Die damalige Ablehnung ausländischer Einflüsse trug ihr Teil dazu bei. Überhaupt bereitete ihm Österreichs vormärzliche Entwicklung zuweilen Sorge. „Sobald der Staat alles nivelliert“, schreibt er einmal, und uns ist, als spräche die Erfahrung unseres eigenen Jahrhunderts aus seinen Worten, „trägt er gleichsam alle Hügel und Berge ab und erzeugt eine Fläche, welche man zwar leichter übersehen kann, wo aber zugleich jedes Lüftchen, ohne einen Gegenstand zu finden, der Widerstand leiste, zu einem boden- auswühlenden Sturme wird. Nivellierung und Zentralisation ist eins. Jede Erschütterung im Zentro wird im ganzen Umfang empfunden. Denn Befehlen ist dann zugleich befolgen. Wird dann ein Fehler gemacht, so geht er ins Große und Ungeheure.“
Von staatspolitischer Bedeutung wurde Roths Versuch, von dem großen deutschen Auswandererstrom, der in den vierziger Jahren nach Amerika unterwegs war, wenigstenseinen Arm nach den europäischen Südosten abzulenken. Er versprach sich davon nicht nur die Stärkung und Kräftigung der dort bereits seit Jahrhunderten bestehenden deutschen Ansiedlungen, sondern auch, in Anlehnung an diese, die Bewahrung des deutschen Volkscharakters der Auswanderer, die er in Amerika nicht gewährleistet sah. Er reiste deshalb nach Württemberg, warb in Wort und Schrift für seinen Plan, führte schwierige Verhandlungen mit den Regierungen, leitete die Reise der Einwanderer und ihre Seßhaftmachung in der neuen Heimat und wurde so zum letzten österreichischen Kolonisator größeren Stils, der die fruchtbaren Landstriche an der unteren Donau in eine organisch-volkliche Verbindung mit dem Westen des Reiches zu bringen strebte. In seinen hochgespannten Erwartungen bestärkte ihn die gerade damals aufkommende Donaudampfschiffahrt, die er im Zusammenhang mit seinem Siedlungswerk einmal sogar „die Fahrt nach dem Goldenen Vließe der Deutschen“ nannte.
Wieviel Verständnis Roth für die nichtdeutschen Nationen des österreichischen Staates besaß, geht vor allem aus seinen ‘ sozialen Forderungen hervor, die fast ausschließlich nichtdeutschen Völkerschaften zugute kommen sollten. „Der Adel muß herunter zu uns — der Untertan (Leibeigene) muß hinauf zu uns. Dem Bürgertum gehört die ganze Zukunft der Welt.“ In diesem Ausspruch sind seine Gedanken zur notwendig gewordenen Gesellschaftsumformung auf das knappste geprägt. Er wirbelte Staub auf bis an die .Stufen des Thrones; die „Siebenbürgische Hofkanzlei“ maßregelte ihn. Aber das hielt ihn nicht ab, auch fernerhin offen gegen soziale und politische Ungerechtigkeit zu kämpfen. So trat er als erster Politiker Siebenbürgens für die Gleichberechtigung der rumänischen Sprache als Verkehrs- und Amtssprache neben der deutschen und magyarischen, wie überhaupt für die Anerkennung der rumänischen Nation als solcher ein.
Die aufziehenden Gewitter des Jahres 1848 mit ihren voraussichtlichen Folgen für den europäischen Südosten erkannte und deutete er mit seherischer Voraussicht. Als die großen politischen Auseinandersetzungen dann tatsächlich eintraten und Österreich bis in die Grundfesten erschütterten, hatte er zu ihnen bereits längst Stellung bezogen. Er hatte sich, ungleich manchen anderen, keinen Augenblick vom Scheine trügen lassen, ein Ungarn Kossuths vertrete im Streite mit dem österreichischen Kaiserhaus das freiheitlichere Prinzip. So viel er auch für nationale Gefühle übrig hatte — nationale Unduldsamkeit haßte er; ihre Auswirkungen kannte er aus eigener Erfahrung. Daher war es für ihn selbstverständlich, in dem blutigen siebenbürgischen Bürgerkrieg der Jahre 1848/49 alle seine Kräfte für den Sieg der österreichischen, mittlerweile nun auch konstitutionell gewordenen Monarchie einzusetzen. Er bestärkt die Rumänen darin, an der Seite der Sachsen für Österreich Partei zu ergreifen, er betreibt die Bewaffnung der sächsischen Nation, er übernimmt es sogar, sich als „kaiserlich bevollmächtigter Pazifikationskommissär“ vom österreichi- Oberkommandierenden, FML Puchner, in die gefährdete Kokelburger Gespanschaft schicken zu lassen, um dort die Ruhe wieder herzustellen, was an Gefahr beinahe einer Frontdienstleistung gleichkam. Obwohl er dabei vorbildlich verfuhr, sein Ziel ohne irgendein Blutvergießen erreichte und gerade auch dem gegnerischen ungarischen Adel unersetzliche Werte rettete, wurde er später, als sich das Kriegsglück vorübergehend wendete, von den Ungarn gefangengenommen und nach kurzem Verhör am 11. Mai 1849, also vor nun hundert Jahren, erschossen.
Selten hat ein heldenmütiges Sterben so weitreichende Folgen gehabt wie jenes in der Zitadelle von Klausenburg. Die Ernüchterung auf ungarischer Seite setzte alsobald ein. Sie rüttelte an den Gewissen bis hinauf in die höchsten Regierungskreise. Sie säte Zwietracht unter den ungarischen Führern. Im sächsischen Lager ließ der Verlust des unersetzlichen Mannes seinen Wert erst richtig erkennen. Sein Tod machte ihn zum Volkshelden. Auf österreichischer Seite blieb der Dank nicht aus. Schon am 24. August 1849, also wenige Tage nach der ungarischen Waffenstreckung bei Vilagos, entschloß sich Kaiser Franz Joseph „das Andenken des unglücklichen Pfarrers St. L. Roth aus Meschen im Siebenbürger Sachsenlande, welcher e i n Opfer der Treue seines Monarchen fiel, in einen unversorgten Kindern zu ehren“, indem er jedem von ihnen bis nach erlangtem 24. Lebensjahr einen Erziehungsbeitrag von jährlich 200 Gulden aus dem Staatsschatz „verwilligte“. Der kaiserliche Dank kam den fünf Vollwaisen Roths, die im Alter von ein bis zehn Jahren standen, und innerhalb weniger Monate beide Eltern verloren hatten, zugute. Die sächsische Nation aber durfte sich in dem Andenken Roths mitgeehrt fühlen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!