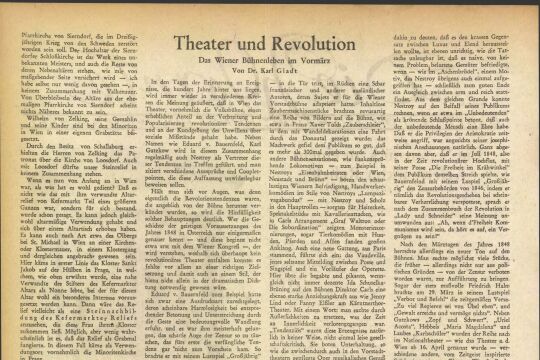Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Torozko einmal „in unserem Besitz“
Um; wieviel leicbtetiattp^s eutvpejHjer,, , inaler der Böhne Bflgfif vorM*m, paar Jalu! zehnten, wenn er nach Modellen zum Thema „Österreich schlechthin“ Ausschau hielt. Zwar bestand die alte Donaumonarchie auch damals schon nicht mehr, als Otto I n d i g zwischen den beiden Welt-kriegen seine Komödie „Die Braut von Torozko“ schrieb. Aber die eben dem „Völkerkerker“ entkommenen und in die neuen, kleineren Käfige noch nicht eingezogenen Völkerschaften tummelten sich noch reichlich degagiert im Leben umher. Zudem gab es auch in Wien ein breites Publikum, das wußte, wo Torozko (ungefähr) lag, was ein Obergespan darstellte und was „schickern“ heißt. Trotz des Mangels aller dieser Voraussetzungen tat Emil F e 1 d m a r recht daran, sich gerade dieses Stück zu seinem 55jährigen Bühnenjubiläum auszusuchen und es in jenem etwas altmodischen Theatersaal in der Josefsgasse zu inszenieren, in dem er seine eigene Laufbahn begonnen hatte. Freiwillig oder unfreiwillig fanden die Darsteller allesamt jenen Stil und Ton, in dem man einst solche Stücke sowohl in Brünn wie auch in Agram, in Troppau wie in Czernowitz gespielt hat. Ein bisserl Herz, ein bisserl Tränendrüse, ein bisserl Temperament, ein bisserl Outrierung. Und so stellt er das etwas gewaltsame Auf und Ab im Leben der schönen Klari dar, die durch konstante Geburtsscheinverwechslung einmal zur Jüdin, dann wieder zur NichtJüdin erklärt wird, bis sie schließlich ihren vorbestimmten Bauernbräutigam bekommt (Annemarie Eckhoff machte dies sehr temperamentvoll verständlich). Um ein Haar wäre sie zwar die Tochter der vornehmen jüdischen Geschäftsfrau geworden (Hansi Prinz erinnerte in Sprache und Gehaben an die Glanzzeit der Helene Thi-mig), aber dann brachte Herschkowitz, der Gastwirt, alles doch wieder ins Lot. Und dieser Herschkowitz, eine Gestalt zwischen dem Nathan und dem Pfefferkorn aus dem „Rastelbinder“, heißt Emil Feld-mar. Und der ist eben der Abend, der ist das Stück. In ihm verkörpert sich jenes dank Hitlerischer Gründlichkeit nahezu völlig verschwunden geglaubte altösterreichische Judentum: Josef Roth könnte nach seinem Modell zumindest eine Novelle schreiben...
Um wieviel schwerer aber heute, ein Genregemälde zu schaffen, wie dies Ernst Hagen ohne Zweifel mit seiner in der Tribüne uraufgeführten „Rhapsodie in Rot-Weiß-Rot“ bezweckte. Im Gegensatz zu seinem ersten szenischen Bilderbogen hat er sich diesmal die historischen Reminiszenzen versa '. und sich auf die „Humorigkeit“ der Gegenwart beschränkt. Und das mußte dann eben auch um vieles blasser, lustloser und gewürz-ärmer ausfallen als beim ersten Mal. Wo der Autor und Regisseur Hagen selbst auf der Bühne steht, geht es noch hin. Er hat als sein eigener Interpret die Möglichkeit, den Text mit ein paar Glanzlichtern zu versehen. Bei den anderen wird es trauriger. Nennen wir von den Damen immerhin die wandlungsfähige Ingold Platzer, von den Herren besonders Georg Corten, der ein guter, individueller Komiker ist und es nicht nötig hat, sich (vergeblich) um eine Qualtinger-Kopie zu bemühen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!