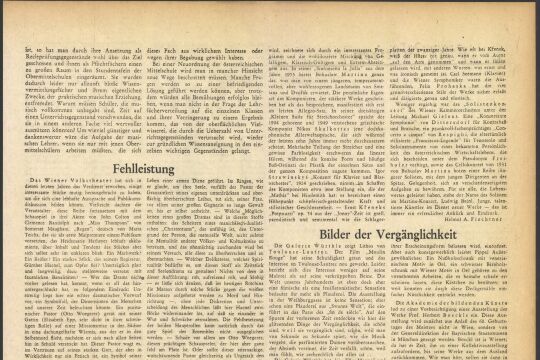Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Turangalila“, Goyo-Ballett und „Columbus“
Großer Konzerthaussaal. Auf dem Podium, links vom Dirigenten, ein Flügel, rechts ein Elektroton-gerät (Ondes Martenots); oben, in der letzten Reihe, zehn Schlagwerker mit Triangel, chinesischen Zimbeln, Tamtam, Tambourin, Marakas, kleinen und großen Pauken, Becken und Röhrenglocken; neben ihnen drei Klaviaturinstrumente: Glockenspiel, Celesta und Vibraphon; dazwischen ein Riesen-symphonieorchester. — Das Stück heißt „Turangalila“ (ein vom Komponisten erfundener Name mit fernöstlichem Anklang), dauert — pausenlos durchgespielt — 75 Minuten und hat zehn Sätze. Hier einige Titel: „Chant d'amout“ 1 und 2, „Joie du sang des etoiles“, „Jardin du someil d'amour“. Diese mystische „Liebessymphonie“ schrieb der in Avignon geborene Sohn einer Südfranzösin und eines Flamen, Olivier Messiaen, der gegenwärtig Organist an St. Trinite in Paris ist, eine Meisterklasse für Komposition leitet und sich eingehend mit fernöstlicher Musik, besonders mit deren hochkomplizierter Rhythmik, beschäftigt hat. — Wir haben anläßlich der ersten Aufführungen von Werken Messiaens nach 1945 an dieser Stelle wiederholt auf die religiöse und mystische Wurzel seines Schaffens hingewiesen, und er selbst bezeichnet seine Kompositionen als „tönende Glasmalereien“. — Das im Auftrag der Kussewitzky-Stiftung gechriebene und 1949 urauf-geführte Monsterwerk stellt wohl die merkwürdigste Mischung von Genialem und Banalem dar, die uns jemals im Konzertsaal begegnet ist. Das musikalische Niveau schwankt zwischen dem Erhabensten — tönender Ekstase, mystischer Verzückung — und platten Sentimentalitäten, billigen Exotismen ä la „Persischer Viarkt“. Dazwischen gibt es Anklänge an den Rosenkavalier, die „Bilder einer Ausstellung“ und vieles andere mehr. Das ganze Werk ist so unfranzösisch, so unromanisch wie nur möglich. Denn es fehlen dem Komponisten zwei Dinge vollständig: Maß und Geschmack. (Vielleicht darf ein Mystiker und Ekstatiker auf sie verzichten?) Die „Turangalila-Symphonie“ wurde insgesamt sechsmal aufgeführt; dreimal in Amerika und dreimal in Europa. Die deutsche und die österreichische Erstaufführung leitete Rudolf Albert; das Klavier und das Elektrotoninstrument spielten die Geschwister Yvonne und Jeanne L o-r i o d. Ihre Leistung und die des Orchesters der Wiener Symphoniker waren in jeder Hinsicht bewunderungswürdig. Das Publikum war sichtlich beeindruckt
Im Französischen Kulturinstitut spielte Yvonne L o r i o d, die eifrig-ergebene Künderin des Meisters, nach Kompositionen von Debussy und Sauguet Teile aus den „Blicken auf das Jesuskind“ von Messiaen: Blick der Propheten, der Hirten und Weisen, Erste Kommunion der Jungfrau, Blick aus den Höhen, Blick der Engel und Blick der Stille. In diesen breitangelegten, suggestiven Phantasien wird dem Hörer tatsächlich eine neue Dimension erschlossen (ähnlich wie in manchen Sätzen der Bruckner-Symphonien). — Die technischen Schwierigkeiten des letzten Stückes, das Messiaen „Geist der Freude“ nennt, stellt sogar Liszts Tastenzauberstücke in den Schatten.
An drei Abenden zeigte das Kaiserlich-Japanische Ballett in der Volksoper zwei verschiedene Programme. Das zweite umfaßte: einen prunkvoll-repräsentativen Männertanz mit komischen Elementen, eine Liebessoloszene, zwei Tänze nach Jahreszeitengedichten des englischen Dichters Biunden, zwei Tänze mit Tier- und Fabelmotiven und einen Kirschblütentanz aus dem 17. Jahrhundert. Tämami G o y o ist die Leiterin der Truppe und Direktrice einer eigenen Tanzschule. Sechs Musiker, drei zur Rechten und drei zur Linken, sitzen auf der Bühne und spielen gitarreartige Instrumente, eine zehnsaitige Harfe und eine Handtrommel. Hinter der Bühne sind große Trommeln und Gongs postiert. „Bewegung in der Stille — Stille in der Bewegung“ — dieses japanische Wort charakterisiert am besten den Stil des Goyo-Tanzes. Nicht nur die sichtbaren äußeren, immer sehr maßvollen und bildhaften Bewegungen sind streng stilisiert, sondern auch das Gefühl, das sich in ihnen ausdrückt, ist sublimiert und für unsere Vorstellung oft bis zur Unkenntlichkeit „verfremdet“. Die Persönlichkeit der einzelnen Tänzer tritt kaum hervor, hoher Ernst und eine tiefe Bescheidenheit schließen jede Willkür, jeden subjektiven Exzeß aus. Zur Zeit haben diese Menschen und diese Tänze ein anderes Verhältnis, nämlich ein durchaus souveränes. — Die Gewänder sind prunkvoll und bilden einen seltsamen Kontrast zu den strengen Bewegungen. Trotz faszinierender Bildwirkungen sind unsere ästhetischen Kategorien auf diese Kunst nicht anwendbar. Daher steht uns auch kein Werturteil über die künstlerische Qualität des Dargebotenen zu.
Unter der Leitung des Komponisten wurde im Großen Konzerthaussaal die konzertant Fassung von Werner Egks „Columbus: Bericht und Bildnis“ erstaufgeführt. Ursprünglich für den Rundfunk als dramatische Kantate geschrieben, wanderte das Werk über mehrere Opernbühnen und wurde während des Krieges auch an der Wiener Staatsoper aufgeführt. Den Text dieses 1932 komponierten „Jugendwerkes“ hat Werner Egk nach authentischen Dokumenten in zehn Szenen selbst geformt. Neben den fünf gesungenen Haupt- und drei Nebenrollen gibt es auch zwei Sprecher, die die- Handlung dialektisch kommentieren, und einen Herold. Die Diktion der Soli, der großen Chorszenen und Orchesterzwischenspiele ist bewußt volkstümlich und auf Breitenwirkung berechnet. Daher verwendet Egk mehrfach folkloristische spanische und indianische Elemente. Auch heute noch geht von diesem im Al-fresco-Stil geschriebenen Werk eine starke Wirkung aus, die durch die Besetzung der Hauptpartien mit Paul Schöffler (Columbus) und Pierette Alarie (Isabella) sowie durch die unter der routinierten Leitung des Komponisten temperamentvoll musizierenden Ensembles der Symphoniker und der Singakademie noch verstärkt wurde.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!