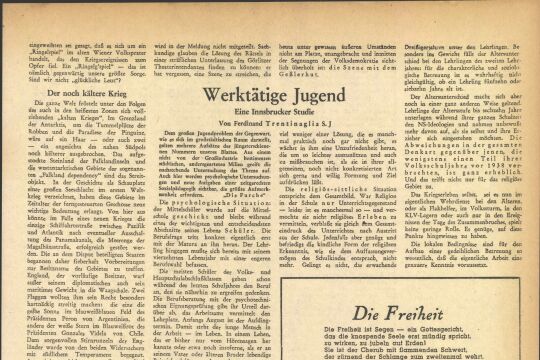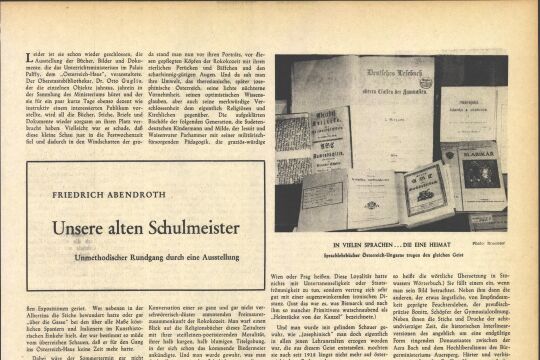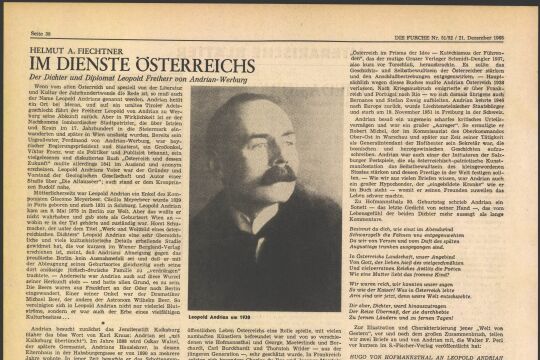Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
... und hobelt alles gleich
IN DER SIEBENTEN SZENE des ersten Aufzugs von Raimunds „Originalzaubermärchen“ in drei Aufzügen, „Der Verschwender“, läßt der Dichter, Sohn eines Drechslermeisters, in einem Duett alle Gewerbe loben, aber kurz vorm Schluß das Kammermädchen Rosa sagen: „Kurzum, ich wend' im Kreis herum vergebens meinen Blick; drum kehr' ich zu dem Tischler um, er ist mein einzig Glück.“ Der Tischler, eine klassische Gestalt der Dichtung — sehen wir von Raimund ab, dessen „Hobellied“ geradezu zum Volkslied wurde — nicht nur der Oesterreicher, auch der Norddeutsche Hebbel hat in seinem Meister Anton der „Maria Magdalena“ diesen Handwerker herausgehoben aus der Masse der Zünfte. In Wien war in dieser Hinsicht übrigens nie von Zünften, sondern von „Zechen“ die Rede. Tischler gab es in Oesterreich schon im 13. Jahrhundert, noch „Schreiner“ genannt nach einem versunkenen Wort der Schriftsprache, das heute fast nur im „Schrein“ dichterisch gebraucht wird. In Wien hören wir von einem Tischler im Jahre 1380. Von einer Zeche, worunter man eine Organisation der Meister verstand, aus der sich im Laufe der Zeit die „Innung“ entwickelte, ist in einer Adresse des Herzogs Ernst 1408 aus Graz die Rede: „Unseren getrewen Lieben v. der Tischler Cech gemainkleich zu Wienn.“
EIN MENSCHENALTER SPÄTER hat der Wiener Stadtrat den Meistern eine Ordnung gegeben, die als Voraussetzungen für den Erwerb des Tischler-Meisterrechts die Vollendung der Lehrzeit, Vorlage eines Leumundzeugnisses, Ehe und Erwerb des Bürgerrechtes festsetzt. In Mitteleuropa steht das Wiener Tischlerhandwerk mit dieser Ordnung zeitlich an dritter Stelle. Wenn in diesen Tagen die Wiener Meister im hochangesehenen Technischen Museum, das Ruhm und Tragik der österreichischen Techniker, Erfinder und Handwerker birgt, eine Jubiläumsschau unter dem Titel „5 50 Jahre jung sein“ bringen, dann mit vollem Recht. Wie auch die Hobelspäne die Jahrhunderte hindurch flogen, welch gesetzliche Wandlungen, soziale Umformungen, technische Neuerungen die Zeit in die Werkstätten brachte, die Meister, Gesellen und Lehrlinge der „reinen“ Zeche (was für ein reineres Gewerbe gäbe es als jenes der Tischler, rein auch im Sinne des geistigen Uebergangs ins Handliche), sie sind immer jung geblieben. Die Wiener Tischler wollen aber nicht nur auf ihre Vergangenheit zurückblicken, von der noch einiges zu sagen sein wird, sie haben auch den Willen, in der Gegenwart zu bestehen. Wie das geschieht, kann man kostenlos jederzeit in der „Wohnkultur“, Mariahilfer Straße 7, nach Herzenslust (und mit stetem Ueberschlag seiner Brieftasche) nachprüfen. Wenn man durch deren Räume geht, ist neben den Entwürfen der Meisterklassen der Professoren Haerdtl und Niedermoser von der Akademie für angewandte Kunst fast immer gruppengemäß ein altes Stück zu sehen. Wann und wo je könnte man so schön, so harmonisch und unbeschwert aus der dicken Haut seiner erlebten Jahrzehnte schlüpfen, dem
Großvater, dem Urgroßvater, nur dem Namen mehr geläufigen Urahnen so nahe sein?
ALLES SCHON DAGEWESEN. Etwa die Gewerbefreiheit, welche man 1361 einführen wollte, später, im 16. und 19. Jahrhundert, wieder mit der gleichen Erfolglosigkeit. Oder etwa die Sozialordnung. Unsere Zeit glaubt, das Wort „sozial“ gepachtet zu haben, unsere zungenfertigen Redner sollen einmal vormittags ins Technische Museum gehen. 1495 — das ist aus einer Gesellenordnung zu entnehmen — gab es schon die ersten sozialen Hilfsmaßnahmen der Wiener Tischler. Wurde ein mittelloser Geselle krank, zahlte ihm die Bruderschaft ein halbes Pfund, gleich 120 Pfennig, vorschußhalber bis zur Gesundung. Eine bestimmte Frist war nicht festgesetzt. Jeder arbeitende Geselle hatte 14täglich einen Pfennig einzuzahlen. 1527 pflegte der Meister die Kranken bei sich. Da wird man schon recht nachdenklich. Ist nicht aus dieser Haltung ein engeres menschliches Verhältnis von Dienstgeber und Dienstnehmer abzulesen als aus der Karteienmaschinerie von heute? Im 17. Jahrhundert zahlten die Zechen bei mehreren
Spitälern ein. 1816 wurde ein Witweninstitut gegründet, seit 1826 erhielten bis zur Mitte des Jahrhunderts in Not geratene Meister eine Unterstützung von fünf bis zehn Gulden, und erst 1889 hören wir von Krankenkassen für Gesellen und- Lehrlinge. Die Gesellen zahlen drei Prozent vom Lohngulden, die Lehrlinge nichts.
Das Krankengeld betrug für Männer einen halben, für Frauen ein Drittel Taglohn. Auf der Fläche des Wiener Bürgerspitals wächst heute Gras. Und Gras sprießt darüber, daß 1680 die Wiener Tischlermeister 40 Gulden jährlich zahlten, um dauernd zwei Betten im Bürgerspital für ihre erkrankten Gesellen bereitzuhalten.
AUS DER GESCHICHTE DER TISCHLER kann man aber nicht nur Sozialwissensahaft studieren, sondern auch Bevölkerungsstrukturen, die allmählich der Reichshaupt- und Residenzstadt jenes eigentümliche Gesicht verleihen, dessen Linien selbst heute noch nicht völlig verwischt sind. Bei den Lehrlingen haben innerhalb von 66 Jahren, hauptsächlich im 17. und 18. Jahrhundert, die heutigen Bundesländer 5 8,3 Prozent, Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn und Krain 7,9 Prozent. Süd-, West-, Mittel- und Norddeutschland 20,4 Prozent gestellt. Die Zuwanderung war hier am stärksten aus der Schweiz. Bei den Gesellen zeigt eine Statistik von zwölf Jahren, daß von 3991 Gesellen — auf das alte Oesterreich bezogen — die Mehrheit von 18,3 Prozent aus den Ländern der böhmischen Krone stammte. Wieder ist die Zuwanderung aus der Schweiz äm stärksten. Es folgen Frankreich, Polen, Dänemark, Schweden, Belgien, Jugoslawien, Rußland, Italien, die Niederlande, Rumänien — und ein Geselle kam gar aus Westindien. Bei den Meistern führte zwischen 1657 und 1774 Wien mit 13 Prozent; das heutige Bundesgebiet stellte 32,1 Prozent, die Länder der böhmischen Krone und Ungarn 8,4 Prozent. Sehr bemerkenswert ist hier die Ausgewogenheit der Struktur: denn diesen rund 40 Prozent der habsburgischen Kronländer stehen 40 Prozent aus den deutschen Reichsgebieten gegenüber. Es zeigt sich, welch weite Ausstrahlung im deutschsprachigen Raum gewerbemäßig die Monarchie bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts ausübte. Wiederum steht bei der Zuwanderung der Meister die Schweiz an der Spitze, gefolgt von Frankreich, Polen und Dänemark.
KAISER FERDINAND III. verfügte 1638 die „Schließung“ des Gewerbes, was aus einer gewissen schwierigen Lage erklärlich war. Im Wiener Stadtbereich hat es damals 20 Meister gegeben. Als Vergleich, ganz interessant, sei angeführt, daß im 14. und 15. Jahrhundert Wien etwa 12 Meister besaß (bei einer Einwohnerzahl von 25.000), das damals ungefähr ebenso volkreiche Nürnberg 10, und Ulm, das damals nur 5000 Einwohner weniger hatte als Wien, 24 Tischlermeister zählte. Man wird oft gefragt, wie es mit dem „Meisterstück“ bestellt war, ein Ausdruck, der geradezu in die Alltagssprache einging. Nun, im Jahre 1445 mußte der Geselle noch drei Meisterstücke liefern: ein Spielbrett, einen zusammenlegbaren Tisch und einen „ingestoßten“ Tisch (vermutlich mit sogenannten „Verkröpfungen“ — verkröpft ist etwa ein Gesims, das um einen Vorsprung herumführt); 1504 verlangte man nur noch zwei Meisterstücke — Gewandkasten und Schreibtisch —, 1638 bloß eines — und jetzt konnte es auch oder sogar ein Himmelbett sein.
7M EISERNEN ZU FALTER und. in, unseren. Tagen, wo die Maschine scheinbar unumschränkt regiert und das Wort „Automation“ auch schon Mittelbetriebe handwerklicher Art umgeistert, ist es ganz lehrreich, zu wissen, daß, je spezialisierter die Produktion wird, die denkende Hand um so nötiger da sein muß. General Electric in den USA hatte vor dem Kriege 2000 Vorlieferanten; heute, nach der Automatisierung, sind es 3 5.000 geworden. Gewiß, das Handwerk, genauer, das Arbeitszeug — und das sahen wir bei einem Besuch in einer Großtischlerei in Meidling —, ist heute weitgehend motorisiert. Da wischt ein Lehrling mit einem sanft surrenden Werkzeug, das an einem Elektrokabel hängt, unablässig über eine Möbelfläche — „wichsen“ nennt man den Vorgang —, mit geringem Kraftaufwand, nicht ganz zehn Minuten. Welche Inanspruchnahme der Muskeln war früher dazu nötig! Dafür gibt es im gleichen Hause auch weibliche Meisterinnen; eine hat sogar mit dem ersten Preis den Kollegen den Rang abgelaufen. Man sagt übrigens — und das bestätigte man mir auch in der Ausstellung in der Mariahilfer Straße — den Mädchen nach, daß sie einen spezifischen Geschmack, eine weitentwickelte innere Beziehung zum Material besitzen. Ob es sich nun um Möbeltischlerei handelt, um die Baubranche, die Gebrauchs- und Luxusgegenstände. Sport-und Spielgeräte, ja sogar Boote, überall kann sich auch der weibliche Geschmack erweisen.
MAN MÜSSTE EINE TISCHLERMEISTERIN heiraten, denkt man, um diese köstlichen Dinge, angesichts derer man im Geiste seine Wohnung entrümpelt und umkrempelt, zu erwerben. Ein Skeptiker meinte neben mir, ein junges Paar, das heiraten möchte, brauchte für den Erwerb einer Eigentumswohnung und der entsprechenden völligen Einrichtung rund 100.000 S. Nun, ich habe diese Kalkulation nicht von Fachleuten überprüfen lassen. Eines steht aber fest: daß die öffentliche Hand, sei es kreditmäßig, sei es im Wege einer entsprechenden Familiengesetzgebung, zuwenig tut. Es ist eine halbe Sache, die Meister, Gesellen und Lehrlinge anzueifern, möglichst rationell zu arbeiten; eine halbe Sache ist die fragwürdige Steuergesetzgebung für Familien, weniger als halb sind die Kreditaktionen für Bombengeschädigte, wenn man nicht eine große Grundkonzeption für das Klein- und Mittelgewerbe hat und in den Innungen nur lästige Mahner sieht, die an Türen klopfen, die sie gemacht haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!