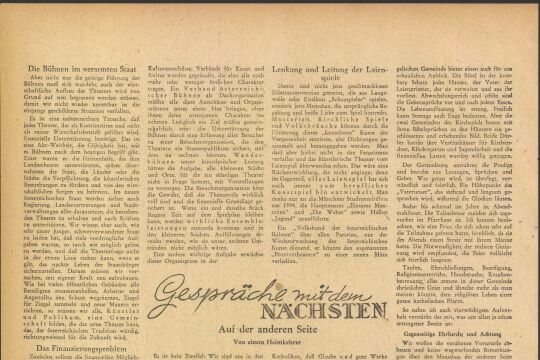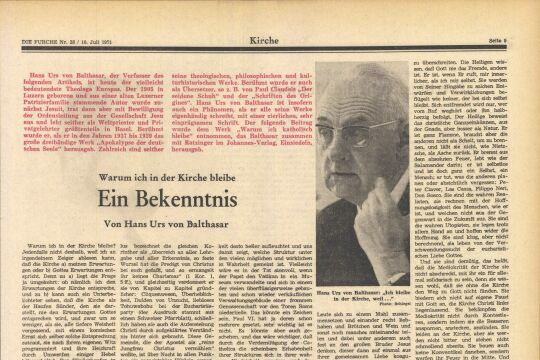Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Und müde lächelt der Weihnachtsbaum
Alle Jahre wieder: Glitzerschmuck und Kerzenschein, ein kommerzialisiertes Christkind und zur Gewohnheit verkommene Bräuche verdecken den zutiefst heidnischen Zug in der christlichen Tradition.
Alle Jahre wieder: Glitzerschmuck und Kerzenschein, ein kommerzialisiertes Christkind und zur Gewohnheit verkommene Bräuche verdecken den zutiefst heidnischen Zug in der christlichen Tradition.
Zwei Seelen leben in unserer Brust. In den Wochen vor Weihnachten erleben wir sie. Gebieterisch bestimmen sie uns. Man ist zugleich Heide und Christ. Man kauft Geschenke, eilt von Geschäft zu Geschäft. Absurde Konstellationen treten zu läge.
Der ökonomische Nachweis, die Nächsten zu lieben, wird zur Last. Es ist ein merkwürdiger Zwang. Er überfällt uns in der dunklen Jahreszeit. Man befolgt ein Liebesgebot, spendet sogar, an Bethlehem denkt man dabei nicht. So erfüllt den 24. Dezember eine sonderliche Ambivalenz. Mit dem Christentum hat man wenig im Sinn und feiert dennoch am Abend. Es vereinigen sich in ein- und derselben Person der Geist des Bekehrens und des Bekehrten.
Für uns Heiden ist Weihnachten ein Brauchtum. Wir sind eben aufgeschlossen und wie alte erfahrene Römer stört uns der Polytheismus der Werte überhaupt nicht. Als aufgeklärte Geister stoßen wir uns keineswegs daran, die Wärme von Kerzenlicht zu schätzen. Die Symbolik hingegen ringt uns ein nur müdes Lächeln ab. Wir haben eben schon seit langem das Spiel durchschaut. Und in jedem Laden hängen Adventkränze. Sie sind wie ein Souvenir aus fremden Ländern. Dunkle Erinnerungen begleiten den Anblick dieser Accessoires. Von ihnen erwarten wir uns nichts.
Als Christ wird man an die Menschwerdung Christi erinnert. Dennoch hat man so seine Zweifel. Großteils rücken wir dieses Ereignis in die Zwischenbereiche von Wirklichkeit und Legende. Da lesen wir dann diese rührseligen Geschichten und Gedichte von Waggerl oder Rosegger. Ein Köhlerglaube kommt auf. Er beruhigt ungemein und versetzt uns in die Idylle, zwischen Armut und Geborgenheit im Winter zu erfahren.
Solche Seelen wohnen in unserer Brust und bilden dieses schizophrene Bewußtsein. Es ist die seelische Physiologie des modernen Menschen.
Einmal erteilte ein Geistlicher mit tiefer Einsicht den klugen Rat, ein frommer Mensch habe sich von der Kirche hinweg zu bekehren. Wie sich der Heide der Botschaft aussetzen sollte, so muß sich der Christ um seine innere Distanz zum Aberglauben bemühen. Kin Wunder darf nicht zur Alltäglichkeit verkommen. Wir kennen ja die frommen Frauen, die sich mit Theologie und dem Bekehren beschäftigen. Ihre aufdringliche Betulichkeit ist mehr als irritierend. Daher fordert der Pfarrer sie auf, diese Wucherungen des Glaubens herauszuschneiden. Er schrie sie an, sie gehe ihm mit ihrem Getue auf die Nerven. Sie war sprachlos. Nach langem Überlegen folgte sie seiner ungewöhnlichen Anweisung. Sie verweltlichte ihr Leben und wurde eine tatkräftige und liebenswerte Tierzüchterin.
Die Geschichte des Pfarrers lehrt, daß es nicht der Sinn der Botschaft ist, wie eine Waffe gebraucht zu werden. Der Glaube soll nicht wie ein Überfall den Nächsten nötigen. Die vormals fromme Frau hatte ihren Frieden gefunden. Sie hatte ihre betuliche Glaubens-, und Kirchensprache ausgejätet.
Ebenso haben wir unseren organisierten Glauben zu begrenzen. Es ist die Voraussetzung des Erwachens. Durch das Gebot des Pfarrers kehrte die Frau in die lebendige Kirche zurück. Es war eine merkwürdige Bekehrung. Sie war von der Überzeugung geleitet, daß im Haus des Vaters viele Wohnungen bereitet sind.
Weihnachten stellt uns jedesmal vor diese Paradoxien. Nicht nur in unserer Zeit leben wir im Widerspruch unseres Heiden- und Christentums. Es ist gleichzeitig vorhanden und zerrt an unseren Nerven. Es muß uns erst gesagt werden, daß Christus als Laie geboren wurde. Es ist unsere Welt, in der wir bei ihm sind. Damit könnte sich die Paradoxie lösen, und es gibt Tausende Beispiele hiefür. So erkennen wir, wieviele Bekehrungen es gibt, geben kann und geben wird. Sie sind sehr unterschiedlich. Immerhin mit Christus sind sie als neues Ereignis in die Welt eingetreten.
Wir können nicht begründen, war-, um wir eine Fichte kaufen, tun es dennoch und stellen sie ins Wohnzimmer. Es ist eine unsinnige Handlung. Gleichzeitig bekennen wir darin, mit diesem Symbol aus dem Wald ein Zeugnis abzulegen: Es gibt eine von Christus erfüllte Welt. Mit Sorgfalt stellen wir eine Krippe auf. Wir bestätigen einen Kinderglauben. Also nehmen wir nicht wahr, wie blaß unsere Beziehung zu dem Ereignis der Geburt in Bethlehem ist. Dem Stern würden wir erst gar nicht folgen.
Die Schlußfolgerungen der Paradoxien liegen auf der Hand: In den Lebensformen ist der Keim des Christentums ebenso präsent wie in Kirchenbänken. Im Kaufhausrummel verendet zwar ein Rest von Christentum trotz „Stiller Nacht”, jedoch ein Bettler lehrt uns, Christ zu sein. Ein agnostischer Sozialarbeiter erfüllt die Botschaft unbewußt. Er ist mitten unter den Alkoholikern, Arbeitsscheuen und Kriminellen. Die Frage, warum er es tut, kann er nicht hinreichend beantworten. Er würde nicht von Nächstenliebe reden ohne rot zu werden.
In der stillen Zeit, die so lärmend geworden ist, kann man über jeden Konfessionalis-mus hinweg das Entstehen von Glaubenserkenntnissen beobachten. Nach Weihnachten verschütten wir sie wieder und graben sie ein. Sollten wir es nicht tun, erleben wir an uns die überraschende Wiederkehr des Weihnachtswunders.
Die Ausgesetztheit des Kindes in Bethlehem belehrt uns vielleicht einmal, unzählige Etiketten opfern zu müssen. Das ist schwierig und unangenehm. Wir sind eben Heiden und Christen in einer Person. Daher laufen wir fortwährend Gefahr, die Seele, die Gottes ist, auszuschließen. Den Heiden schließen wir hingegen in uns ein. Diese Spannung hat das Christentum über uns verhängt.
Seitdem wir auf den Namen Christi hin getauft wurden, sind unsere Namen und sozialen Bangordnungen bedeutungslos geworden. Heute ist die Kraft dieses neuen Namens schwach. Namenstage feiern wir kaum mehr, die Tauftage überhaupt nicht. Es sollte uns zu denken geben, daß vor mehr als tausend Jahren unsere Vorfahren um des Namens Christi willen ihre heidnische Identität opferten. Sie wollten eines Namens werden und versammelten sich sichtbar um das Kreuz.
Die Reformation erweiterte den Sinn dafür, ”daß der Glaube nicht von Reliquien und Kathedralen abhängig sein darf. Vermutlich fordert die Moderne von uns eine vergleichbare Reformation. Wir müssen unseren unbegründeten Stolzund diese hochmütige Selbstverständlichkeit, Christen zu sein, opfern.
Wir formulieren unser Credo ohnehin schon in der Tonart der Hoffnung: Ich hoffe zu glauben. Es ist das bedrängte Bekenntnis eines Bekehrens. Gleichzeitig spricht diese zaghafte Umschreibung unmißverständlich aus, daß die von uns unverstandene Liebe Christi, der Glaube an den
Herrn, durch die Hoffnung auf den Geist gestärkt werden müsse. So schlecht es auch um die Voraussetzungen der Hoffnung bestellt sein mag, rückt Bethlehem als sichtbares Zeichen vor unsere Augen.
Wir tun uns schwer dabei dank unserer grandiosen Lehranstalten, der desorientierenden Lehrer — Theologen miteingeschlossen. Trotzdem konnten uns die Beste der Hoffnung nicht geraubt werden. Sie wurde nur ärmer, denn wir begannen, sie mit Illusionen zu verwechseln. Nicht einmal die häßlichen Installationen unserer kulturbcflissenen Stadtverwaltung und die schamlose Gier unseres löblichen Handelns (8. Dezember) vermochten schließlich diesen kleinen Hoffnungsschimmer zu rauben. Mit ihr besitzen wir noch ein echtes Werkzeug unseres Denkens.
Da wollen wir die Wirklichkeit nicht so belassen, wie diese so oft menschenunwürdig um uns ist. Es kann der Glaube schon so verschwunden sein wie es das Publikum rund um die Punschbuden im Vorgefühl des Festrausches bezeugt, doch die Hoffnung gibt uns Zeit, auf die Bückkehr des Glaubens geduldig zu warten. Es gibt die Frohbotschaft von den klugen und törichten Jungfrauen. Und es gibt die überraschende Ankündigung von Isaias, die uns kein Philologe stehlen kann. In der Kraft des Bekenntnisses von Athanasius, der das Credo mit Hoffnungen beschließt, liegt zugleich die Überzeugung, daß mit dem Christentum nicht nur die Kirche hiefür einsteht. Seit Bethlehem haben die unzähligen Inkognito-Dienste ihre Besonderheit und gewährleisten die Fortdauer des Glaubens.
Dem Fluch der Modernen haben sich schon längst unetikettierte Handlungen und praekonfessionelle Gruppen entzogen. Sie1 setzten Wendepunkte. So fremd sie auch erscheinen mögen, sehen sie doch wie diese armseligen Hirten aus, die rund um Bethlehem lagerten. Sie leben zuweilen schon wie Mönche oder Nonnen, ohne es institutionell sein zu wollen. Sie üben sich in der Buße für unseren Stolz, seit jeher und ohnehin Christen ohne Christus zu sein - was auch immer das sein mag. Deren unbeachtete Bekenntnisse bewahren unsere Christlichkeit. So entgehen wir letztlich der Zerstörung unseres halbverrotteten Christentums. Es hat den Anschein, daß wir es mit einem namenlosen Christentum zu tun haben. Das hatte bereits Hans Urs von Balthasar befürchtet. Da es wahr zu sein scheint, leben wir erneut in der Zeitspanne, ehe der Namen Christi wieder genannt wird und er wiederkommt. Es sind eigenartige und verschlungene Wege. Sie führen kreuz und quer durch die Straßen zur heiligen Nacht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!