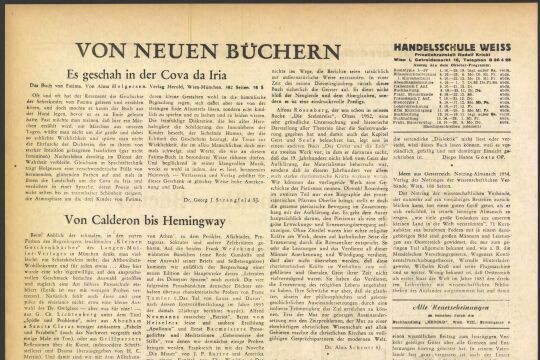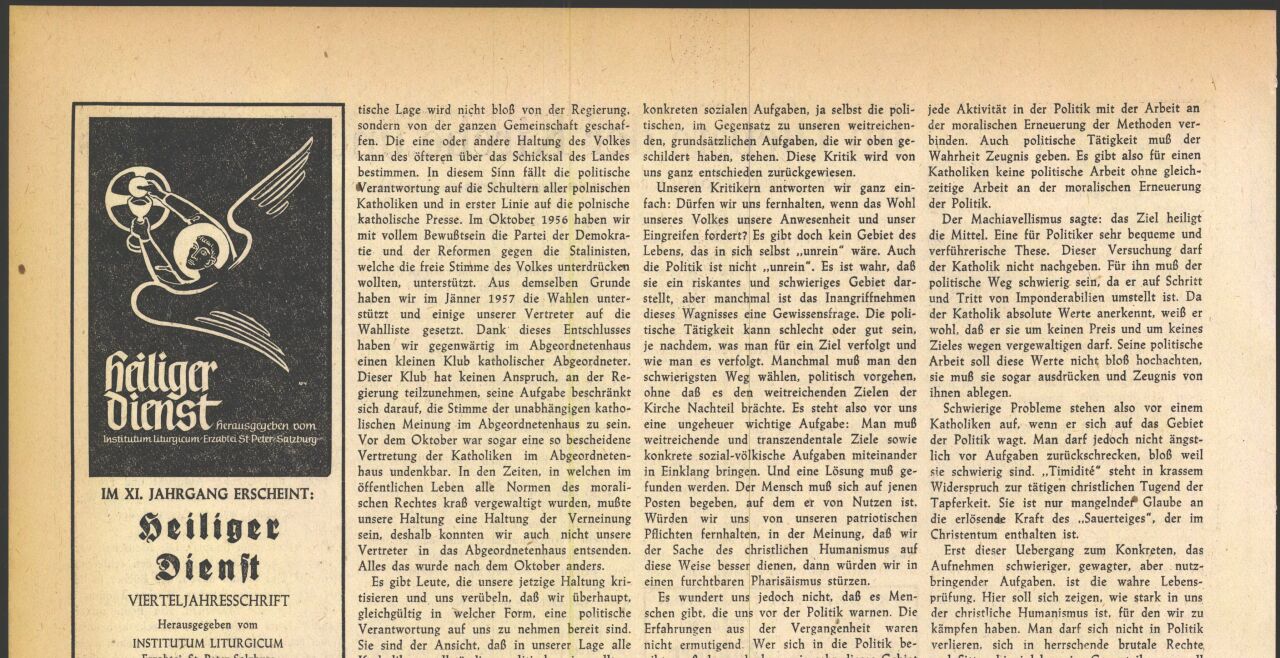
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Unsere große Sorge: der Leser
Der Analphabetismus ist in unseren Breiten überwunden, jeder kann heutzutage lesen und schreiben. Aber eine eigentümliche Paradoxie der Kulturgeschichte will es, daß das geschriebene Wort im gleichen Augenblick an Wert und Interesse verliert, daß sich das Bild — und zwar in seinen banalsten Formen — wieder in den Vordergrund schiebt. Illustrierte Blätter, Fernsehen und Film beherrschen jetzt die Szene. Es ist bezeichnend, daß die verbreitetste Boulevardzeitung der Bundesrepublik „Bild“ heißt.
Diese--Entwicklung hat ganz bestimmte, sehr tiefgreifende Folgen und Auswirkungen. Sie zeigen sich schon bei der Auswahl der Themen. Es gibt nun einmal Probleme und Sachverhalte, die sich nur mit den Mitteln des diskursiven Denkens, der Analytik der logischen
Entfaltung, der Differenzierung, der Argumentation, der systematischen Darlegung in einigermaßen zulänglicher Weise behandeln lassen. Diese Themen scheiden für die „optische“ Darreichung von vornherein aus. Sie lassen s ch weder in Reportagen zerlegen noch „verfeatu- ren“ (sprich „verfitschern“), wie das in seiner Scheußlichkeit treffende Wort im Journalisten- Rotwelsch heißt.
Die Folgen zeigen sich aber auch bei der Methode der publizistischen Behandlung. Wer es sich beispielsweise vörnimmt, eine politische Auseinandersetzung nicht mit Hilfe des Wortes, sondern Vorzüglich durch Bilder zu bestreiten, wird mehr oder weniger zwangsläufig ins Persönliche, ja sogar ins Intime abgedrängt. Gedanken und Programme lassen sich nicht
photographieren und verfilmen, wohl abc. Schlafzimmer mit zerwühlten Betten. Zuträger, die „etwas wissen“, Freunde und Feinde des Opfers, das Opfer selbst in einem besonders anti-photogenen Moment usw.
Natürlich ist an alldem nicht das Bild schuld; im Gegenteil. Eine Gewissenserforschung der europäischen Intelligenz würde mit Gewißheit ergeben, daß unsere Sprachen (oder besser: unser Reden und Schreiben) in den letzten zwei Jahrhunderten des Rationalismus viel zu abstrakt, viel zu bildlös gęworden sind. Man braucht noch nicht eirimäl ätrf Freude großartige Entdeckung des Werts von Bild und Symbol zurückgreifen. Jede unbefangene menschliche Erfahrung lehrt schon, daß die jahrhundertelang unterdrückte, von legitimen Erfüllungen ungestillte Sehnsucht nach Bild und Symbol nun anderswo, an illegitimem Ort, sich zu befriedigen sucht Es hat also keinen Sinn, den „Drang zum Bild“ zu verketzern und zu bekämpfen. Er muß. nicht nur als Tatbestand, sondern auch als Wertstreben, ernstgenommen und vom verantwortlichen Publizisten in die Gewissensrechnung eingesetzt werden.
Das Verhältnis des Schreibenden zum Leser ist ein Ich-Du-Verhältnis wie das des Arztes oder des Seelsorgers, freilich nicht in der Unmittelbarkeit des leiblichen Gegenüber, der
mündlichen Aussprache, des physischen Kontaktes. Aber es hat doch dialogischen Charakter. Das zeigt sich schon darin, daß jede profilierte Zeitung im Lauf der Jahre „ihre“ Leser, jeder profilierte Zeitgenosse „seine“ Zeitung findet. Wie aber, wenn die Profile sich verwischen? „Die sensationell übersteigerte Presse kleistert die Gehirne zu und enthebt sie eigenen Urteils, die nihilistische Presse verdirbt und verdreht die Urteilsfähigkeit und die Glaubenshaltung derer, die als .geistige Führer' heranwachsen“, sagte Professor Emil Dovifat auf dem Kölner Katholikentag 1956. Die nihilistische und die Sen- rationspresse entstehen und gedeihen aber auf dem Humus den Gesellschaft, die sie duldet, liest, fördert, ernst nimmt und sich von ihr beraten
läßt. Sie wird zu dem, was sie ist, weil der Mensch im Zeitalter der massenhaften Bewegungen, unter der Wirkung akustischer und optischer Dauerreize, unter dem fortwährenden Herabrieseln und Einsickern von Tönen und Bildern immer stumpfer und — sagen wir es offen — dümmer wird, weil er es sich leichtmachen kann, weil er nicht gestört, picht beunruhigt, nicht mit der strapaziösen Arbeit des Denkens behelligt werden will.
Diese Phänomene bestehen natürlich nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Zivilisationswelt. Aber sie besitzen in Deutschland eine besondere Augenfälligkeit und Dringlichkeit. Auf die „Jahre der schönen Not", wie ein zynischer Betrachter die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg genannt hat, ist der wirtschaftliche Aufschwung gefolgt, zu rasch, zu unerwartet, zu sehr alle Volksschichten bereichernd, als daß er sogleich geistig und moralisch hätte bewältigt werden können. An die Stelle der vielen, um ernsthafte Probleme bemühten Zeitschriften, die auf grauem Papier schlecht gedruckt und noch schlechter eingebunden waren, sind für die Masse der Leser oder Bildkonsumenten jene auf satiniertem Papier und in prächtigen Farben gedruckten Hefte getreten, in denen so gut wįę fjjiehts Ernsthafte ., mehr steht. Das ist freilich eine; einseitige SchiJ-, derung; denn substanzhaltige Zeitschriften und Zeitungen haben sich daneben nicht schlecht entwickelt. Aber das äußere Bild und leider auch das Denken und Fühlen der breiten Masse bestimmen sie nicht.
Das erscheint schon schlimm genug, wenn man die Situation der Publizistik und der öffentlichen Meinung ganz allgemein im Auge hat. Es ist noch schlimmer, wenn man die Dinge unter dem spezifischen Aspekt der christlichen Publizistik betrachtet. Jede seriöse Publizistik muß, um mit einem Wort von Joseph Görres zu sprechen, das Große groß und das Kleine klein nennen. Wenn aber nur noch die stärksten Töne, die grellsten Farben, die schauerjichsten Zusammenhänge bis zum Bewußtsein vordringen und dort haftenbleiben? Wenn nicht mehr Gedanken, sondern nur noch Plakate die Hirne erreichen — wo bleibt da ,die Möglichkeit seriöser Publizistik? Wenn öffentliche Meinung, wie Pius XII, sagt, ein „Echo ist, das im Bewußtsein
der Gesellschaft spontan erwacht und hervor- ' bricht“, wo sind dann heute Spontaneität, Bewußtheit und aktives Antworten einer Gesellschaft, deren Hirne verkleistert sind?
Was dem christlichen Publizisten als Auftrag gegeben ist, die Verkündigung der Botschaft des Evangeliums in der Sprache der Zeit, ihre Anwendung auf die Nöte und Probleme der jeweiligen Gegenwart — das alles hat mit geistigen Fragen zu tun. Geistige Probleme, religiöse und kirchliche Fragen sind meist alles andere als primitiv, plakathaft, banal. Sie entziehen sich einer Behandlung, die nur das Gröbste vermittelt. Sie können, ihrer Natur nach, nur in der heute so wenig gefragten, so wenig geübten, so wenig attraktiven Weise des analytischen und diskursiven Denkens einigermaßen zutreffend dargestellt werden.
Das ist die spezifische Schwierigkeit jeder christlichen Publizistik in der Welt von heute. Sie lösen, heißt freilich nicht nur, ein Berufsproblem der Presseleute lösen. Wer sich darum bemüht, die christliche Botschaft verständlich zu machen, tut damit — vom Religiösen, vom Apostolat und vom Ethischen einmal ganz abgesehen — dem Zeitgenossen auch einen vorzüglich humanen Dienst, denn er arbeitet der Verf jįjuįg,. unjjL yštfūhrfearkeit.. ,d,er Menschen,įį entgegen, die. wenn sie das eigene Analysieren, Denken und Urteilen erst einmal eine Zeitlang unterlassen haben, dieser Fähigkeiten über kurz oder lang ganz verlustig gehen.
Daher steht, wo immer christliche Publizisten heute zusammenkommen, um über ihren Beruf zu sprechen und einander Rat und Hilfe zu geben, die Sorge um den Leser im Vordergrund. Sie hat nichts zu tun mit Konkurrenz und Geschäft. Es geht nicht darum, dem Rivalen Leser abzuziehen und sie für sich zu gewinnen. Es geht um den Leser überhaupt, um die Fähigkeit und den Willen zum Lesen, um die Kunst des Lesens, die etwas anderes ist als die T e c h- nik des Lesens. Hier zeigt sich der feine Riß in der eingangs erörterten Paradoxie: der allgemeinen Verbreitung der Lesetechnik entspricht das Absinken der Lesekunst. Ohne diese aber ist geistige Kultur nicht denkbar. Ein Volk, das aufhörte, ein Volk von Lesern zu sein, hätte auch den Anspruch verwirkt, als Kulturvolk bezeichnet zu werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!