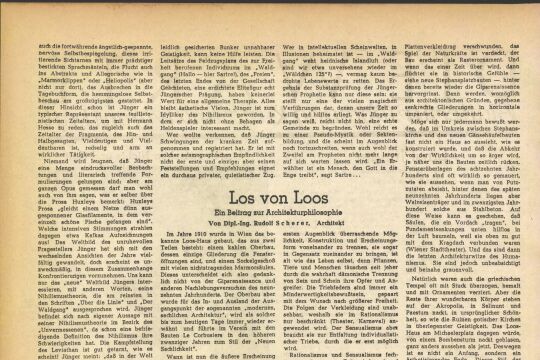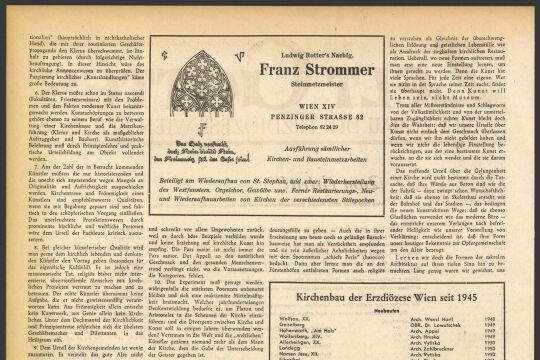Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
UNSERE STADT UND WIR
Wie sehen eigentlich wir Wiener heute unsere Stadt? Und wie hat sie der Wiener, der in ihr vor hundert Jahrein lebte, gesehen? Sah er das, was sich um ihn so schön türmte und kuppelte, als selbstverständlich Gewohntes, oder war er mehr oder weniger sogar mitschaffend an dieser Schönheit durch seine Aufnahmebereitschaft? Ich möchte fast glauben, daß damals auch noch der einfache Bürger eine Beziehung zur Architektur seiner Stadt hatte. In den Palais wohnten die Adeligen, ein als Symbol eines Höheren beachteter Stand, und die vielen Bürgerhäuser mit ihren Fenstern und Baikonen, ohne überflüssiges Beiwerk, waren eindeutig Häuser, in denen man wohnte, ohne zu repräsentieren, dafür gab es aber Türme, die wirklich in den Himmel wuchsen, wie den Stephansturm oder die Türme der Barockkirchen, die in ihrer ausschwingenden Fruchtform, der Zwiebel, sich in spielerischer, fast behaglicher Grazie darstellten, und dann — die schönen großen Kuppeln, die. das Himmelsgewölbe so heiter ertragen. Diese Formen und Baustile der Architektur, wenn auch noch so verschieden voneinander, gaben eindeutig klar ein Zeugnis für die hohe geistige Forderung und das Sich- bescheiden im Alltäglichen der damaligen Zeit.
Heute ist diese Ganzheit gestört, es gibt eine solche Mannigfaltigkeit der Baustile, daß sich der Wiener gar nicht mehr zurechtflnden kann. So schwärmt er, wenn er überhaupt schwärmt, für die Votivkirche, das Rathaus und übersieht die vielen, in fast jedem Bezirk noch vorhandenen anmutigen Häuser aus den fünfziger Jahren, die auch meistens ungepflegt und fast baufällig sind. Nicht übersehen kann er den Stephansturm, und von dem weiß er ja auch aus einem alten Wiener Lied, daß er „lächelnd auf uns niederschaut“ und in einem heutigen Lied bereits „.schmunzelt“. Das Rathaus imponiert ihm und die vielen anderen Häuser aus den achtziger und neunziger Jahren, sie erwecken in ihm ein Gefühl der Fülle, und er wird sich vielleicht seiner Kindheit erinnern, als er damals darüber pachgrübelte, ob in diesen tollen Türmchen geheimnisvolle Dinge vor sich gehen oder — nur Wäsche aufgehängt wird.
Die Zeit aber um die Jahrhundertwende, sie dürfte für den Wiener, der die damalige neue Bewegung in der Architektur noch als Junger miterlebt hat, sich hauptsächlich im Klang des Wortes „Säzäson“ zusammenfassen, welches Wort der Straßenbahnschaffner bei der Haltestelle des Aus- stelrlungsgebäudes der Sezession ausrief. Der heutige junge Wiener aber ist gewohnt, diesen Stil seit seiner Kindheit zu sehen, und er wird sich- kaum viele Gedanken darüber machen.
Und die Gemeindebauten? Ja, an denen könnte der Wiener so manches sehen. Vor allem an dem Karl-Marx-Hof und auch an den anderen Höfen. Sie alle haben einen gewissen lebensvollen Ausschwunig der Formen, Bogenführungen und große, interessante Glaskeile als Fenster, doch dazwischen zu kleine, allzu kleine Fensteröffnungen, die bestimmten Notwendigkeiten dienen. Aber vielleicht gefallen ihm auch diese als Ornament in der Mauerfläche und er übersieht dabei, daß er gerade diese Fensteröffnungen sich besonders groß wünschen sollte. Allerdings waren diese Fensteröffnungen auch in früheren Zeiten immer zu klein gewesen, nur. waren sie damals nicht an dėjį Frphtseite des Hajises zu bemerken.
Und’die schönen al?en Päliäfe?'Šie füii en"hÄ?6 ceifi vollkommen übersehenes Dasein, sind meistens an Büros vermietet, und ein Neureicher würde kaum in einem solchen Palais wohnen wollen; für heutige Ansprüche sind sie nicht praktisch genug, und daran können auch die Titanen, die so hilfreich die Balkone stützen, nichts ändern. Auch die schönen Genien, die oben auf den Bögen lagern, sie können noch so zauberhaft ihre Köpfe über die Schulter heben: den eilenden Großstädter, achthabend auf die heranbrausenden Autos, werden sie wohl kaum charmieren können.
Dafür draußen an der Peripherie der Stadt, da gibt es wieder für den Wiener Gelegenheit zu spontaner Teilnahme und Entzücken an den vielen Privatvillen, die vom Gemüt ihrer Besitzer zeugen. Da gibt es die romantisch Veranlagten, die ihr Herz an hohe Giebeldächer verloren haben, oder ganz im Gegensatz dazu die mehr praktisch Interessierten, die — vielleicht ein wenig zu abrupt — dem Schädel ihres Hauses das Dach aufgesetzt haben. Jedenfalls ein lustiges Nebeneinander der Baustile, in welchen sich die Freude der Be sitzer an ihren Häusern und so verschiedener Geschmack ausdrückt.
Diese Unordnung in der Vielfalt einer Übergangszeit dürfte sich gerade in Wien besonders bemerkbar machen. Dieses Wien, das einstmals das Zentrum der Monarchie gewesen, bis diese in mehrere Teile auseinanderfiel und Wien als Kern geblieben ist, inmitten seiner deutschsprachigen Bundesländer. Ob nun von den früheren verschiedensprachigen Völkern, teils mythischen, teils hochdifferenzierten Völkern, etwas im Wesen des heutigen Österreichs verblieben ist? Und darum vielleicht der Anprall der Zeitwende in den kulturellen Gebieten, wie zum Beispiel der Architektur, sich problematischer auswirkt? Während Völker anderer großer Länder, weniger belastet vom Erlebnis einer hohen Architektur, in die neue Bauzeit stürmen und in ihren Hoch- und Glasbauten von 40 bis 80 Stockwerken schwelgen und das Maß, die Proportion zum Menschen und zum Himmelsgewölbe, nicht mehr gilt. Welch letzteres Maß in allen Genie- bauten der Architektur, ob Tempel oder Turm, so wunderbar sich erweist.
Doch kann das heutige, keiner Größe entsprechende Maß auch etwas Überwältigendes an sich haben; ich erinnere mich meines eigenen Überwältigtseins, als ich im Hafen von New York einfuhr und aus dem Nebel die Wolkenkratzer auftauchten, die auf mich wie Burgen der Dschin und Dschans aus den Märchen von „Tausendundeine Nacht“ wirkten.
Ja, das Überwältigenkönnen! Als Gabe beigestellt dem wahren Genie, ist es eine wirklich köstliche Gabe, denn sie hilft dem schöpferischen Gestalter, die vielen, die ohne eigentliches Verständnis sind, zu glücklichen Empfängern umzubilden. Das werden aber immer nur die Ausnahmen sein in den Zeiten, denn allzu schnell wird man eben vom Unmaß, dem Monströsen, überwältigt, und dieser Möglichkeit sind schließlich auch unsere Großstädte immer mehr ausgeliefert. Sie quellen auseinander, das Zentrum verschiebt sich, es gibt womöglich schon mehrere Zentren, und daran mögen auch die neuen motorisierten Verkehrsmöglichkeiten ihren Anteil haben. War man noch vor 50 Jahren mit Pferden am schnellsten aus der Stadt in die Prater Hauptallee gelangt, kann man heute fast ebenso schnell mit Autos, Autobussen und Motorrädern auf den Semmering kommen und von dort eine zauberhafte Sicht gewinnen. Und vielleicht liegt in dieser Gewinnung der Weite das positiv Neue der künftigen Baugestaltung der Großstädte. Das aber dürfte für den heutigen naiven Betrachter kaum von Bedeutung sein, da ihm vor allem nur interessant ist, wie sein Motorfahrzeug sich in der Weite erlebt und benimmt.
Wir anderen aber, die wir noch eine hohe Vergangenheit der Architektur, ungemindert in ihrer Gültigkeit, immer wieder erleben, für uns wird eine Stadt wie Salzburg bereits zu den lieblichsten Wundern der Schönheit gehören. Wie diese Stadt, heute noch ein in sich geschlossenes Ganzes, so organisch an den Bergeshängen sich breitet und in ihren Bauten, Edelstein an Edelstein, zum Ring einer Krone schließt und über allen, hoch oben, die Festung diese Krone schützt. Vielleicht am erstaunlichsten aber . kid die profanen Bauten, die Wohnhäuser, die ohne jeglichen Überschwang der Form — sei es Turm oder Kuppel — einen- Adel des selbstverständlich Gegebenen aufweisen, eben das Ereignis der geglückten Proportion.
Erst draußen an der Peripherie der Stadt beginnt das vielfältige Nebeneinander guter und weniger guter neuer Bauformen. Die Stadt selbst ist in ihrer Ganzheit belassen.
Aber auch wir Wiener können unsere Stadt als ein geschlossenes Ganzes sehen; wir brauchen nur hinauf zuf ähren auf das Hochhaus, und hier oben angelangt auf der Terrasse, im Aufatmen der frohen Überraschung, befreien wir uns von den Fesseln der Alltäglichkeit — und unseren Blick, geführt von den Türmen nach oben, muß auch nicht mehr das Unten ängstigen, weil die Stadt — so fromm wie die wilden Tiere um den bekannten Heiligen — zu unseren Füßen sich lagert. Übermütig geworden, schauen wir in die Weite — und schon ist unsere Unruhe auch gestillt vor dieser Schrift am Himmelshorizont, dem zarten Geistschwung der Hügellinien, die Wien umranken — und wir dürfen uns für eine Zeitwelle erleben im Gnadenmaß der Heiterkeit.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!