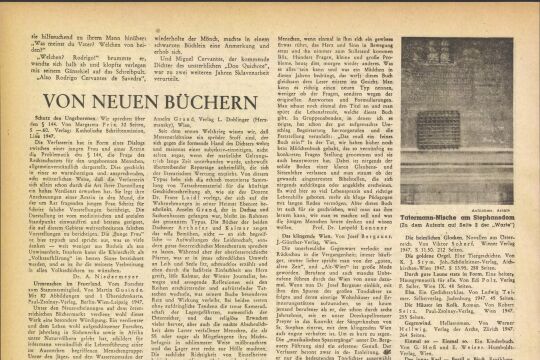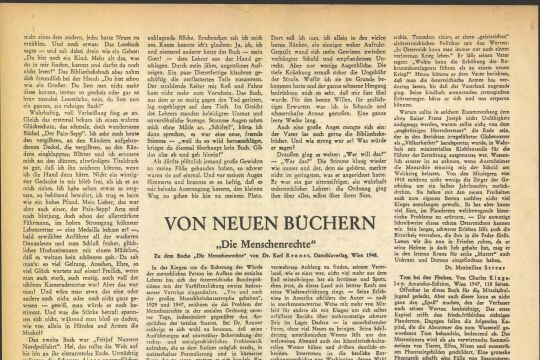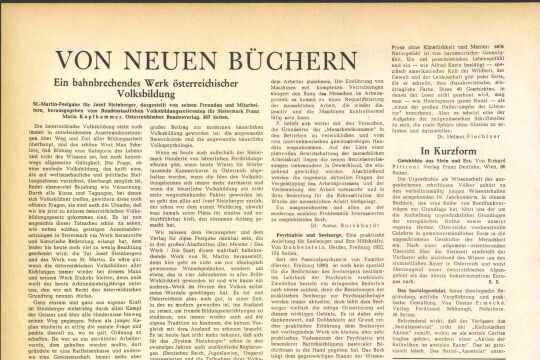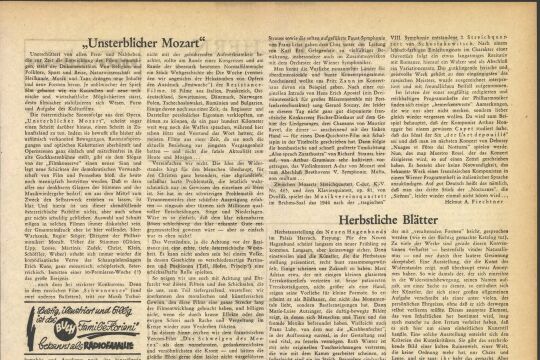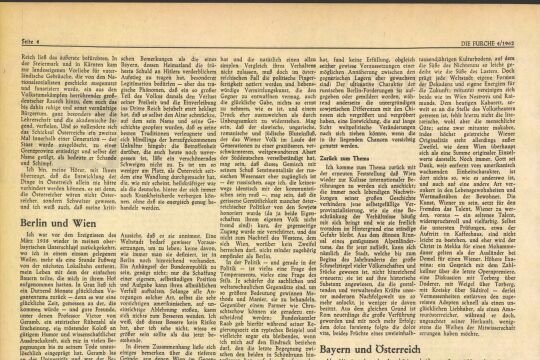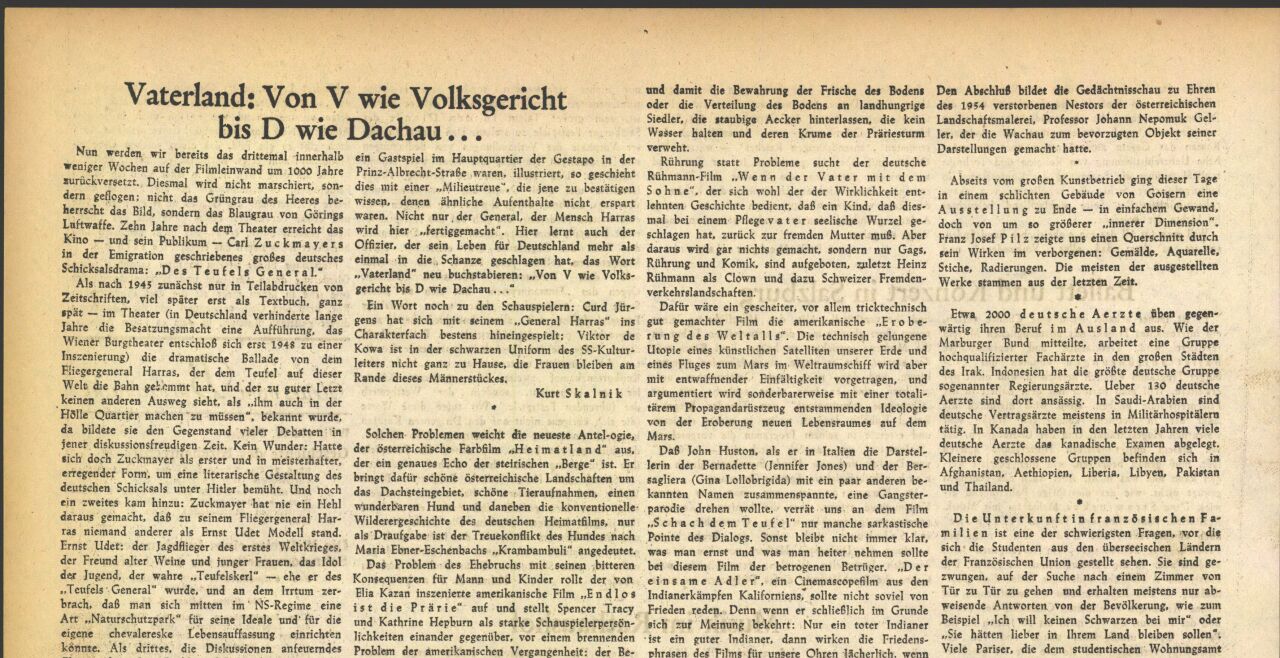
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vaterland: Von V wie Volksgericht bis D wie Dachau...
Nun werden wir bereits das drittemal innerhalb weniger Wochen auf der Filmleinwand um 1000 Jahre zurückversetzt. Diesmal wird nicht marschiert, sondern geflogen; nicht das Grüngrau des Heeres beherrscht das Bild, sondern das Blaugrau von Görings Luftwaffe. Zehn Jahre nach dem Theater erreicht das Kino — und sein Publikum — Carl Znckmayers in der Emigration geschriebenes großes deutsches Schicksalsdrama: „Des Teufels General.“
Als nach 1945 zunächst nur in Teilabdrucken von Zeitschriften, viel später erst als Textbuch, ganz spät — im Theater (in Deutschland verhinderte lange Jahre die Besatzungsmacht eine Aufführung, das Wiener Burgtheater entschloß sich erst 1948 zu einer Inszenierung) die dramatische Ballade von dem Fliegergeneral Harras, der dem Teufel auf dieser Welt die Bahn gelammt hat, und der zu guter Letzt keinen anderen Ausweg sieht, als „ihm auch in der Halle Quartier machen zu müssen“, bekannt wurde, da bildete sie den Gegenstand vieler Debatten in jener diskussionsfreudigen Zeit. Kein Wunder; Hatte sich doch Zuckmayer als erster und in meisterhafter, erregender Form, um eine literarische Gestaltung des deutschen Schicksals unter Hitler bemüht. Und noch ein zweites kam hinzu: Zuckmayer hat nie ein Hehl daraus gemacht, daß zu seinem Fliegergeneral Harras niemand anderer als Ernst Udet Modell stand. Ernst Udet: der Jagdflieger des erstes Weltkrieges, der Freund alter Weine und junger Frauen, das Idol der Jugend, der wahre „Teufelskerl“ — ehe er des „Teufels General“ wurde, und an dem Irrtum zerbrach, daß man sich mitten im' NS-Regime eine Art „Naturschutzpark“ für seine Ideale und' für die eigene chevalereske Lebensauffassung einrichten könnte. Als drittes, die Diskussionen anfeuerndes Element kam das „Problem Oderbruch“ hinzu — die doppelte Tragik des deutschen Widerstandes. Auch hier scheute sich der Dichter nicht, heißes Eisen anzufassen.
Das war, wie gesagt, damals — in jenen Jahren nach dem Krieg, in denen die materielle Not zu einer starken' (seither merklich abgeklungenen) geistigen Regsamkeit einen eigenartigen Kontrast bildete. Und min hat Helmut K ä u t n e r aus diesem Stoff einen Füm gemacht. Einen anständigen Film und einen ganz ausgezeichneten dazu. Hier wird nicht gemogelt und sich um die letzte Aussage herumgedrückt (siehe „Kinder, Mütter und ein General“), hier wird nicht em Teilausschnitt geboten, wie die rauhbeinige Landseridylle, Marke 08/15, hier wird Farbe bekannt und dem Publikum, das oft nur allzu gerne vergißt, eine Entscheidung abgefordert;
Es würde nicht des noch immer ins Mark gehenden Sirenengeheuls „Fliegeralarm“ bedürfen, um uns schon nach wenigen hundert Metern Zelluloid-Streifen mitten hinein in jene Jahre zu versetzen, und uns beinahe körperlich spürbar die gefährlich stickige Atmosphäre des Dritten Reiches zu vermitteln. Dabei hütet sich der Film, „dick aufzutragen“, und das ist gut so. Allein die bleiche, mit dem Totenkopfring geschmückte Hand und der bekannte Kneifer lassen die Nähe Heinrich Himmlers besser deutlich werden, als wenn irgendein Schauspieler in noch so guter Maske herumagitieren würde. Dasselbe gilt, wenn die Konturen Görings nur durch das Milchglas eines Türfensters kurz sichtbar werden.
Der Film folgt in weiten Partien dem Textbuch des Bühnenstückes. Wenn er aber die Wochen der „Frontinspektion“ Harras', von der wir auf dem Theater erfahren, daß sie die offizielle Vetsion für ein Gastspiel im Hauptquartier der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße waren, illustriert, so geschieht dies mit einer „Milieutreue“, die jene zu bestätigen wissen, denen ähnliche Aufenthalte nicht erspart waren. Nicht nur, der General, der Mensch Harras wird hier „fertiggemacht“. Hier lernt auch der Offizier, der sein Leben für Deutschland mehr als einmal in die Schanze geschlagen hat, das Wort „Vaterland“ neu buchstabieren: „Von V wie Volksgericht bis D wie Dachau...“
Ein Wort noch zu den Schauspielern: Curd Jürgens hat sich mit seinem „General Harras“ ins Charakterfach bestens hineingespielt: Viktor de Kowa ist in der schwarzen Uniform des SS-Kultur-leiters nicht ganz zu Hause, die Frauen bleiben am Rande dieses Männerstückes.
Solchen Problemen weicht die neueste Antel-ogie, der österreichische Farbfilm „Heimatland“ aus, der ein genaues Echo der steirischen „Berge“ ist. Er bringt dafür schöne österreichische Landschaften um das Dachsteingebiet, schöne Tieraufnahmen, einen wunderbaren Hund und daneben die konventionelle-Wilderergeschichte des deutschen Heimatfilms, nur als Draufgabe ist der Treuekonflikt des Hundes nach Maria Ebner-Eschenbachs „Krambambuli“ angedeutet.
Das Problem des Ehebruchs mit seinen bitteren Konsequenzen für Mann und Kinder rollt der von Elia Kazan inszenierte amerikanische Film „Endlos ist die Prärie“ auf und stellt Spencer Tracy und Kathrine Hepburn als starke Schauspielerpersönlichkeiten einander gegenüber, vor einem brennenden Problem der amerikanischen Vergangenheit: der Bewahrung des Graslandes für die großen Viehzüchter und damit die Bewahrung der Frische des Bodens oder die Verteilung des Bodens an landhungrige Siedler, die staubige Aecker hinterlassen, die kein Wasser halten und deren Krume der Präriesturm verweht.
Rührung statt Probleme sucht der deutsche Rühmann-Film „Wenn der Vater mit dem Sohn e“, der sich wohl der der Wirklichkeit entlehnten Geschichte bedient, daß ein Kind, daß diesmal bei einem Pflegevater seelische Wurzel geschlagen hat, zurück zur fremden Mutter muß. Aber daraus wird gar nichts gemacht, sondern nur Gags, Rührung und Komik, sind aufgeboten, zuletzt Heinz Rühmann als Clown und dazu Schweizer Fremdenverkehrslandschaften.
Dafür wäre ein gescheiter, vor allem tricktechnisch gut gemachter Film die amerikanische „E r o b e-rung des Weltalls“. Die technisch gelungene Utopie eines künstlichen Satelliten unserer Erde und eines Fluges zum Mars im Weltraumschiff wird aber mit entwaffnender Einfältigkeit vorgetragen, und argumentiert wird sonderbarerweise mit einer totalitärem Ptopagandarüstzeug entstammenden Ideologie von der Eroberung neuen Lebensraumes auf dem Mars.
Daß John Huston, als er in Italien die Darstellerin der Bernadette (Jennifer Jones) und der Ber-sagliera (Gina Lollobrigida) mit ein paar anderen bekannten Namen zusammenspannte, eine Gangsterparodie drehen wollte, verrät uns an dem Film „Schach dem Teufel“ nur manche sarkastische Pointe des Dialogs. Sonst bleibt nicht immer klar, was man ernst und was man heiter nehmen sollte bei diesem Film der betrogenen Betrüger. „D e r einsame Adler“, ein Cinemascopefilm aus den Indianerkämpfen Kaliforniens, sollte nicht soviel von Frieden reden. Denn wenn er schließlich im Grunde sich zur Meinung bekehrt: Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer, dann wirken die Friedensphrasen des Films für unsere Ohren lächerlich, wenn nicht schlimmer. Dr. Ludwig Gesek
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!