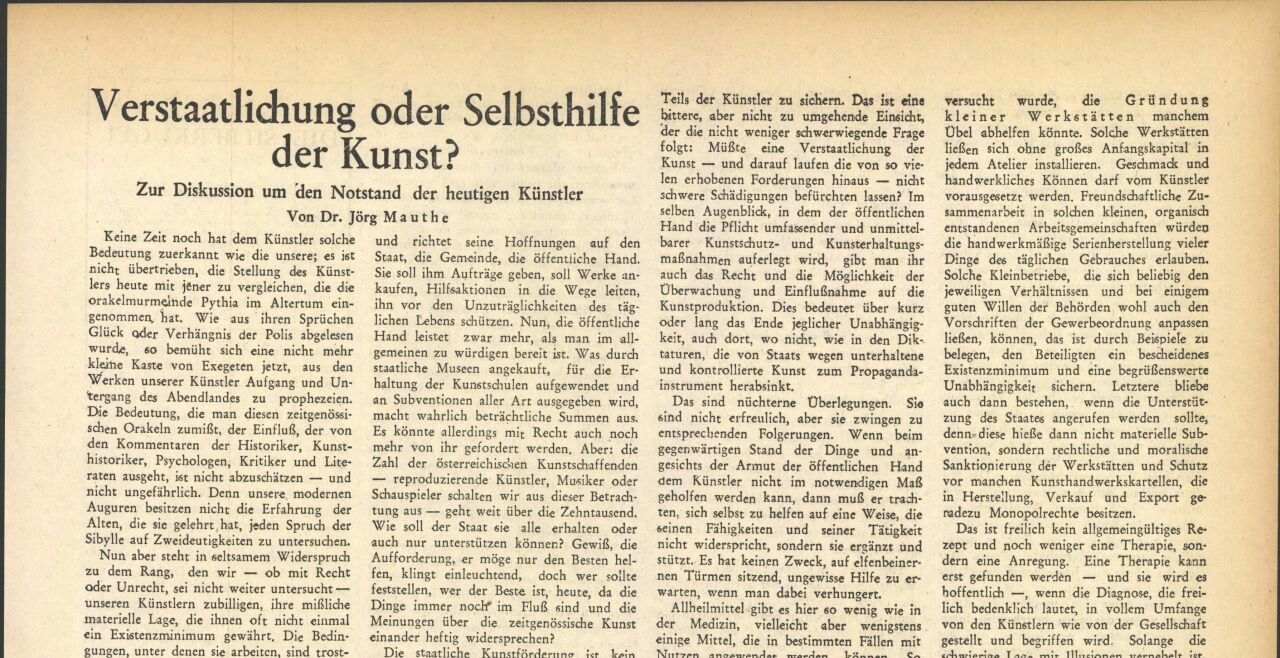
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Verstaatlichung oder Selbsthilfe der Kunst?
Keine Zeit noch hat dem Künstler solche Bedeutung zuerkannt wie die unsere; es ist nicht übertrieben, die Stellung des Künstlers heute mit jiner zu vergleichen, die die orakelmurmelnde Pythia im Altertum eingenommen hat. Wie aus ihren Sprüchen Glück qder Verhängnis der Polis abgelesen wurde, so bemüht sich eine nicht mehr kleine Kaste von Exegeten jetzt, aus den Werken unserer Künstler Aufgang und Untergang des Abendlandes zu prophezeien. Die Bedeutung, die man diesen zeitgenössischen Orakeln zumißt, der Einfluß, der von den Kommentaren der Historiker, Kunsthistoriker, Psychologen, Kritiker und Literaten ausgeht, ist nicht abzuschätzen — und nicht ungefährlich. Denn unsere modernen Auguren besitzen nicht die Erfahrung der Alten, die sie gelehrt hat, jeden Spruch der Sibylle auf Zweideutigkeiten zu untersuchen.
Nun aber steht in seltsamem Widerspruch zu dem Rang, den wir — ob mit Recht oder Unrecht, sei nicht weiter untersucht — unseren Künstlern zubilligen, ihre mißliche materielle Lage, die ihnen oft nicht einmal ein Existenzminimum gewährt. Die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, sind trostlos. Immer mehr werden jene Künstlerehcn zur Regel, in denen die Frau der verdienende und die Familie ernährende Teil ist. Andererseits versuchen vor allem jüngere Künstler, sich mit Gelegenheitsarbeiten als Bauarbeiter oder in Fabriken durchzubringen, was einem stetigen, der Meditation und Kontemplation bedürftigen Kunstschaffen kaum zuträglich ist; auch Künstler können nicht zwei Herren zugleich dienen. Daß sie sich dennoch äußerst selten von der Not verleiten lassen, leicht an den Mann zu bringende Minderwertigkeiten herzustellen, verdient uneingeschränkte Achtung.
Das ist also die Situation: auf der einen Seite spürt der Künstler die Bedeutung, die man seiner Arbeit zumißt und die ihn, sofern er Verantwortungsgefühl besitzt, zur äußersten Anstrengung treibt. Auf der anderen Seite ist er schutzlos und hoffnungslos der existenziellen Bedrohung ausgeliefert. Es gibt keinen Stand, keine Kaste, die ihn unterstützen würde; die privaten Mäzene in Österreich lassen sich an den Fingern einer Hand aufzählen und sind ohnehin über Gebühr beansprucht. Was also soll der Künstler tun, um wenigstens ein Stück sicheren Bodens unter die Füße zu bekommen?
Er macht es, wie es viele heute machen,
und richtet seine Hoffnungen auf den Staat, die Gemeinde, die öffentliche Hand. Sie soll ihm Aufträge geben, soll Werke ankaufen, Hilfsaktionen in die Wege leiten, ihn vor den Unzuträglichkeiten des täglichen Lebens schützen. Nun, die öffentliche Hand leistet zwar mehr, als man im allgemeinen zu würdigen bereit ist. Was durch staatliche Museen angekauft, für die Erhaltung der Kunstschulen aufgewendet und an Subventionen aller Art ausgegeben wird, macht wahrlich beträchtliche Summen aus. Es könnte allerdings mit Recht auch noch mehr von ihr gefordert werden. Aber: die Zahl der österreichischen Kunstschaffenden — reproduzierende Künstler, Musiker oder Schauspieler schalten wir aus dieser Betrachtung aus — geht weit über die Zehntausend. Wie soll der Staat sie alle erhalten oder auch nur unterstützen können? Gewiß, die Aufforderung, er möge nur den Besten helfen, klingt einleuchtend, doch wer sollte feststellen, wer der Beste ist, heute, da die Dinge immer noclf im Fluß sind und die Meinungen über die zeitgenössische Kunst einander heftig widersprechen?
Die staatliche Kunstförderung ist kein Allheilmittel, sie wird niemals ausreichen, um die Existenz auch nur eines größeren
Teils der Künstler zu sichern. Das ist eine bittere, aber nicht zu umgehende Einsicht, der die nicht weniger schwerwiegende Frage folgt: Müßte eine Verstaatlichung der
Kunst — und darauf laufen die von so vielen erhobenen Forderungen hinaus — nicht schwere Schädigungen befürchten lassen? Tm selben Augenblick, in dem der öffentlichen Hand die Pflicht umfassender und unmittelbarer Kunstschutz- und Kunsterhaltungsmaßnahmen auferlegt wird, gibt man ihr auch das Recht und die Möglichkeit der Überwachung und Einflußnahme auf die Kunstproduktion. Dies bedeutet über kurz oder lang das Ende jeglicher Unabhängigkeit, auch dort, wo nicht, wie in den Diktaturen, die von Staats wegen unterhaltene und kontrollierte Kunst zum Propagandainstrument herabsinkt.
Das sind nüchterne Überlegungen. Sie 6ind nicht erfreulich, aber sie zwingen zu entsprechenden Folgerungen. Wenn beim gegenwärtigen Stand der Dinge und angesichts der Armut der öffentlichen Hand dem Künstler nicht im notwendigen Maß geholfen werden kann, dann muß er trachten. sich selbst zu helfen auf eine Weise, die seinen Fähigkeiten und seiner Tätigkeit nicht widerspricht, sondern sie ergänzt und stützt. Es hat keinen Zweck, auf elfenbeinernen Türmen sitzend, ungewisse Hilfe zu erwarten, wenn man dabei verhungert.
Allheilmittel gibt es hier so wenig wie in der Medizin, vielleicht aber wenigstens einige Mittel, die in bestimmten Fällen mit Nutzen angewendet werden können. So wäre, um ein Beispiel zu nennen, zu untersuchen, ob nicht, wie dies schon erfolgreich versucht wurde, die Gründung kleiner Werkstätten manchem Übel abhelfen könnte. Solche Werkstätten ließen sich ohne großes Anfangskapital in jedem Atelier installieren. Geschmack und handwerkliches Können darf vom Künstler vorausgesetzt werden. Freundschaftliche Zusammenarbeit in solchen kleinen, organisch entstandenen Arbeitsgemeinschaften würden die handwerkmäßige Serienherstellung vieler Dinge des täglichen Gebrauches erlauben. Solche Kleinbetriebe, die sich beliebig den jeweiligen Verhältnissen und bei einigem guten Willen der Behörden wohl auch den Vorschriften der Gewerbeordnung anpassen ließen, können, das ist durch Beispiele zu belegen, den Beteiligten ein bescheidenes Existenzminimum und eine begrüßenswerte Unabhängigkeit sichern. Letztere bliebe auch dann bestehen, wenn die Unterstützung des Staates angerufen werden sollte, denn diese hieße dann nicht materielle Subvention, sondern rechtliche und moralische Sanktionierung der Werkstätten und Schutz vor manchen Kunsthandwerkskartellen, die in Herstellung, Verkauf und Export geradezu Monopolrechte besitzen.
Das ist freilich kein allgemeingültiges Rezept und noch weniger eine Therapie, sondern eine Anregung. Eine Therapie kann erst gefunden werden — und sie wird es hoffentlich —, wenn die Diagnose, die freilich bedenklich lautet, in vollem Umfange von den Künstlern wie von der Gesellschaft gestellt und begriffen wird. Solange die schwierige Lage mit Illusionen vernebelt ist, und das ist sie noch, ist eine Besserung nicht möglich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



































































































