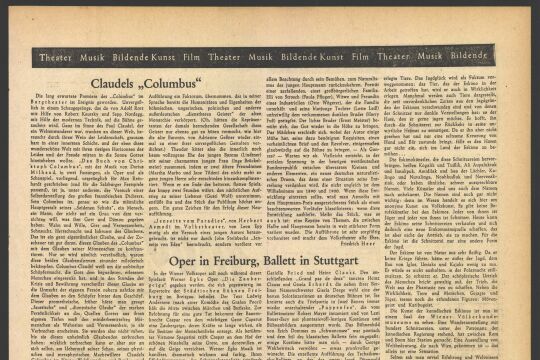Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vollendete Komödiantenkunst
Die jüngsten Premieren der Wiener Bühnen standen im Zeichen französischer Dramatik. Das Berliner Renaissancetheater gastierte im Akademietheater mit einem Bühnenkuriosum: mit Denis Dide-rots dramatisiertem Dialog „Rameaus Neffe“ in der Bearbeitung und Ubersetzung von Goethe. Eigentlich war es von Diderot, dem viel Unrecht geschehen war, als Pamphlet gegen die galantkorrupte Gesellschaft von ehedem gedacht und hätte, wenn es je veröffentlicht worden wäre, als richtiger geistiger Sprengstoff gewirkt. Für die Hartgesottenen von heute ist es eher ein Vergnügen voll intellektueller Spannung, wenn sich da in einem Pariser Cafe der rechtschaffene und ein wenig philiströs wirkende Philosoph Diderot, Mitverfasser der „Enzyklopädie“, mit dem Neffen des großen Komponisten Rameau über Genie und Moral, Genie und Gesellschaft unterhält. Eigentlich ist es mehr ein großer Monolog des Neffen, eines ausgemachten Schmarotzers, Zynikers und Freßsacks, durch dessen Mund Diderot, auch in wunderlichen Widersprüchen, vehemente Anklage gegen die verlogene Moral und die falsche Sicherheit der „Wahrheiten“ vorbringen läßt. Das wirkt unerhört
lebendig, jumal in Goethe Übersetzung,
der alle Register der Sprache zieht, so daß die ganze Atmosphäre mit Leben erfüllt ist.
Natürlich ergibt das kein Theaterstück und läßt sich überhaupt nur spielen, wenn ein großer Schauspieler und Komödiant wie 0. E. Hasse den Neffen so darstellt, daß er förmlich von Wirklichkeit strotzt. „Welch eine französische Kreatur“, kommentierte Hofmannsthal einmal „Rameaus Neffen“, „welch eine menschliche Kreatur, welch eine zeitlose Kreatur, welch eine nicht zu vergessende Kreatur.“ Trefflichere Worte lassen sich für die Wirkung 0. E. Hasses in dieser Rolle nicht finden. Alfred Schieske als Diderot war ihm ein ausgezeichneter Partner. Für die Regie zeichnete Kurt Reack, für das ungemein geschmackvolle, unaufdringliche Bühnenbild Werner Huhrke verantwortlich. Es gab Beifall einer stürmischen Begeisterung.
*
Keine Saison ohne ein Stück von Jean Anouilh im Theater in der Josef Stadt; ihm verdanken wir eine bald lückenlose Ubersicht über das Werk des bedeutenden französischen Dramatikers. Abwechselnd setzt man uns denn eines seiner „schwarzen“ oder „rosa“ Stücke vor. Diesmal gab es eine Probe seiner „Pieces grincantes“, seiner „zähneknirschenden“ Stücke. Sosehr sie sich in der Schattierung voneinander unterscheiden mögen, dem Thema nach bilden sie eine Einheit, nämlich den Nachweis der Unmöglichkeit von Reinheit, Glück und Liebe. In „Ardele oder das Gänseblümchen“ ist die buckelige Schwester des Generals (die nicht auftritt) die einzige Zeugin für die reine Liebe. Und da sie, von ihrer Familie gehetzt, keinen anderen Ausweg weiß, geht sie gemeinsam mit ihrem buckeligen Liebhaber freiwillig aus dem Leben. Die Familie kann nur „zähneknirschend“ dem Verhängnis zusehen und sich gegenseitig die Masken von Scheinheiligkeit, Haß und Resignation abreißen. Dieses Frühwerk Anouilhs, bisweilen an Strindbergs „Gespenstersonate“ erinnernd, ist ein tintenschwarzes, gallig-bitteres Stück, in dem nicht einmal die Jungen (wie etwa in „Romeo und Jeannette“) eine Ausnahme bilden. Noch fehlt die Meisterhand, namentlich im gedehnten Schlußteil, trotzdem ist man gebannt.
Die Inszenierung in der Josefstadt besorgte diesmal der Franzose Roland Pietri, bei den letzten Proben unter persönlicher Aufsicht des Autors. Das ergibt einen anderen Aufführungsstil, als wir bei Anouilh bisher gewohnt waren: realistischer, schärfer, näher der Farce. Erik Frey, Carl Bosse, Robert Dietl, namentlich aber Ursula Schult schienen den Intentionen der Regie am besten zu entsprechen. Am Schluß gab et wahre
Ovationen für den in der Direktionsloge verborgenen Autor.
Vorher wurde eine nur wenig amüsante Nichtigkeit des französischen Romantikers Alfred de Musset, „Vn Caprice“, geboten, ein Liebesgeplänkel im Salon, hübsch gespielt von den Damen Khol, Irrall und Erwin Strahl in der Mitte.
*
Das Volkstheater brachte in seinem literarischen Sonderzyklus eine Art Mysterienspiel des Franzosen Michel Parent, „Gilda ruft Mae-West“. Es zeigt Stationen aus dem Leben jenes unseligen amerikanischen Piloten Claude Eatherly (im Stück einfach John genannt), der seinerzeit die Atombombe über Hiroshima befehlsgemäß ausgeklinkt hatte, Stationen der Sühne am Weg des Vergessens. Im zeitlichen Nebeneinander werden auf verschiedenen Schauplätzen (markiert durch drei verschiedenfarbige Podien)
Reales, Bewußtes, Geschautes, Erinnertes des Mannes, der als „Massenmörder“ kein dekorierter Held sein wollte, miteinander verknüpft. Es handelt sich um ein interessantes Bühnenexperiment, dem leider vom Wort her weder eine aufrüttelnde noch eine erschütternde Wirkung vergönnt ist. Unter der hervorragenden Regie von Leon Epp bot besonders Georg Lhotzky neben vielen anderen Mitwirkenden eine sehr ansprechende Leistung.
Dem Stück ging die dramatische Skizze „Sonderurlaub“ von Gerd Oelschlegel tioraus, die Tragödie eines ostdeutschen Befehlsempfängers an der Berliner Mauer. Aus einem Hörspiel entstanden, wird der Konflikt — die Ächtung des jungen Volkspolizisten durch seine Umgebung — in der Dramatisierung mehr angedeutet als ausgeführt. Neben annehmbaren Episodenfiguren gefielen besonders Bernd Hall als junger Vopo und Ingrid Fröhlich als junges Mädchen, das ihn liebt. Lebhafter Beifall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!