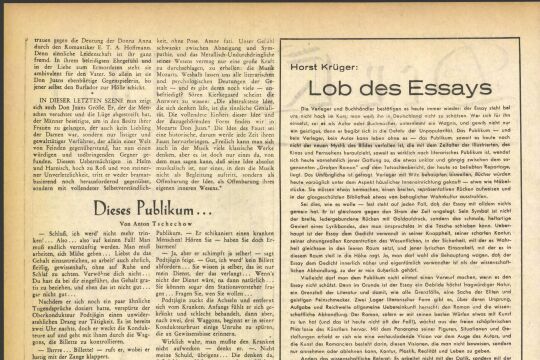Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von der Tiefe der Zeit
Von keinem gelten die Worte Rudolf Borchardts wohl so sehr wie von Paris von Gütersloh: „In der Atmosphäre des Geistes sind Achtzehnjährige nicht unter allen Umständen jünger als Achtzigjährige, ja sogar als sogenannte Tote.“ Wieder einmal mehr beweist das sein neuester Roman, in dem es um die beiden berühmten Gestalten von Faust und Mephisto geht. Einerseits läßt Gütersloh bestehen, „in vollkommener Ubereinstimmung mit der rechten Lehre“, daß Wahrheit Wahrheit, Bosheit Bosheit und der Teufel Teufel bleibt, anderseits interpretiert er das „alte Wahre“ derart revolutionierend neu — „Neuinterpretation des Glaubens“ wie man heute gern sagt —, daß man meint, es zum erstenmal zu hören oder zum erstenmal recht verstanden zu haben. Es geht ihm darum, „ohne die Absicht merken zu lassen, auf die via triumphalis der Orthodoxie zu führen“.
Von keinem gelten die Worte Rudolf Borchardts wohl so sehr wie von Paris von Gütersloh: „In der Atmosphäre des Geistes sind Achtzehnjährige nicht unter allen Umständen jünger als Achtzigjährige, ja sogar als sogenannte Tote.“ Wieder einmal mehr beweist das sein neuester Roman, in dem es um die beiden berühmten Gestalten von Faust und Mephisto geht. Einerseits läßt Gütersloh bestehen, „in vollkommener Ubereinstimmung mit der rechten Lehre“, daß Wahrheit Wahrheit, Bosheit Bosheit und der Teufel Teufel bleibt, anderseits interpretiert er das „alte Wahre“ derart revolutionierend neu — „Neuinterpretation des Glaubens“ wie man heute gern sagt —, daß man meint, es zum erstenmal zu hören oder zum erstenmal recht verstanden zu haben. Es geht ihm darum, „ohne die Absicht merken zu lassen, auf die via triumphalis der Orthodoxie zu führen“.
Wenn es jemand noch nicht gewußt haben sollte, hier wird es klar, Gütersloh ist ein erzkatholischer Österreicher, trotz aller Schauspielertricks, geistvoller Paradoxa und ironischer Verfremdungen, hinter denen er sich vielgesichtig verbirgt. Und wenn es einer Verteidigung sogenannter Konservativer bedürfte, hier läge sie vor, in einer Art, die alle, ob ihrer bloß aufgeputzten Modernität progresssiv nur klingea-gende Phrasen zu Paaren treibt. Doch Gütersloh „unterschwimmt“ diese billigen Gegensätze von konservativ und progressiv und zeigt, daß die Zeit mehr ist als ein bloßes Eilen von einem zu andern, sondern jene Tiefe der Zeit, die die Chance besitzt, jeden Augenblick zum Absoluten durchzubrechen, „mit jedem Schritt ein Absolutes gesetzt und schon mit einem einzigen Tag über den jüngsten Tag hinausgegangen wird“, gleichviel, ob in diesem oder jenem Schauspielerkostüm. Der Mensch entscheidet und nicht die Mode. So zu argumentieren liegt jedenfalls in guter österreichischer Tradition. „Du mußt dein Leben ändern“, rief einmal Rilke beim Anblick eines antiken Kunstwerkes aus, und Gütersloh geht es um die „Bekehrung“, während es dem Teufel nach Gütersloh nur um den „Einfall“ geht, sei es bei heiligen oder profanen Wissenschaften, bei Theologie oder Ästhetik.
Dadurch unterscheidet sich Gütersloh vom „Dr. Faustus“ des Thomas Mann. Im „Tonio Kröger“ war die Entscheidung gefallen, für das Entmythologisieren und Entsakralisie-ren des Heiligen sowohl wie des Unheiligen (Joseph und seine Brüder, Der Erwählte und eben Dr. Faustus), für den einfallsreichen Schreibtisch, für die „stilreiche Stillosigkeit“ des Montagetechnikera mit der ironischen Parodie, für „die Sünde des Dichters, zu dichten statt zu sein“; so psychologisiert Thomas Mann, sicher genial, den Teufel zu einer Halluzination eines krankhaften Hirns und damit auch das Böse. Gütersloh bleibt beim Künstler, „der empfindet“, und seiner „verzweifelten Einheit von ästhetisch und ethisch“, wie Robert Musil einmal das Kunstwerk als die produktive Inszenierung des „Bewußtseinsniveaus“ eines Künstlers ähnlich definierte. Und so existiert für Gütersloh der Teufel wie der liebe Gott, die Orthodoxie wie die Abgründe an ihren Rändern, der Mensch als ein Gratwandler zwischen Scilla und Charybdis, keineswegs in „trägen Sicherheiten“ sich wiegend. Damit nimmt er gleichsam die ganze existenzialistische Problematik Sartres und seines Dramas „Der Teufel und der liebe Gott“ auf sich, ohne etwas abzustreichen, Bitte nun kerne Mißverständnisse. Dieser Satz steht nur Im Nachwort, ist also eine Formulierung „in abstracto, also kalt, auf einen Nährwürfel eingegangen“. Schon die tragisch lächerliche Figur, die Udalrich macht, als er coram publico von seiner mit einem Nebenbuhler aufgetauchten Geliebten abserviert wird, sein Spielen, als späterer Mönch, mit dem „konservativen Ball“, den er auf dem Strahl eines Springbrunnens überlegen vor Konservativen und Progressiven, den beiden Parteien seines Klosters, tanzen läßt, machen ahnen, daß seine orthodoxe Via mit kräftigen und deftigen Sentenzen gepflastert ist, die jede „unerlaubte friedlich schlummernde Gewißheit“ jäh aufschrecken. Das „Schulstürzen“ war von jeher ein spezielles Herzensanliegen Güterslohs. Überhaupt, was heute als Verlebendigung starrer Formalismen, in weltlichen und geistlichen Lehren, angepriesen wird, unter den Schlagworten von Entmythologiisierung, Inkarnation, Geschichtlichkeit usw., explizierte Gütersloh schon längst in seinen Schriften, hier wieder im Roman, so einleuchtend, bildhaft, drastisch und geistvoll, witzig und entschieden, geschult an der Latinität des Thomas von Aquin und an der zeitgenössischen philosophischen und ästhetischen Problemik, daß er konservative wie revolutionäre Fassaden gründlich abräumt. So läßt sich Gütersloh auch in der Faust-Fabel gar nicht auf das allzu Bekannte ein. Nur die Gestalt der Mutter, die dem Kinde nie Weib sein kann, besteht sie, die den Menschen zum Tode gebiert, zerstört das Meisterkunststück der Schlange, sich selber in den Schwanz zu beißen und glaubhaft ein endloses Kreisen des Lebens vorzutäuschen, seine Hoffnungslosigkeit jedoch zu verbergen, auf Grund deren „wie beim Karussell die Holzpferde, die Epigonen einander auf den Fersen folgen“, Originalität, Einmaligkeit, Persön-lichkeitswerdung damit aber ausgeschlossen bleiben. An die Stelle einer leidenschaftlichen Liebe treten „nette Nächstenliebeleien“, Philanthropie, humanitäre Beteuerungen, soziale Fortschrittlichkeiten, „die Menschen fliegen nun einmal auf das Billige“. Persönlichkeit ist jedoch nur durch den Tod möglich. Daran hängt nun auch die ganze Philosophie des Wortes, das fleischgeworden einmal ausgesprochen oder gar gegeben, unaufhebbar bleibt. „Ubers Wort muß das Faktum, wenn es ins Sein will“. Hier liegt der Grund für Güterslohs Philosophie und Dichtung, ja für die Kunst überhaupt. Das doziert er nun nicht auf ein Happy-End zu, sondern an Hand einer „unhaltbaren Hypothese“ ... „bis zum Höchstgrad der Erfundenheit gesteigert“, nur so ist Inkarnation, Fleischwerdung des Wortes möglich, „das — ob nun weiß- oder schwarzmagisch wirkend — in grader Linie von dem Wort abstammt, das fleisch geworden ist“, möglich eben nur im Kunstwerk der Dichtung, wie ja auch die göttliche Offenbarung zum größten Teil Dichtung in „Parabeln und Gleichnissen“ bietet; alles andere wäre Denikskla-verei, Hundehumanität, andressierte Niedrigkeit, ordnende Funktion einer Herzlosigkeit, Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Logik. Nur unter diesem Symbol, das das Wort ist, zu dessen Gedankeninhalt notwendig auch die Form gehört, das Mephisto ohne das Ingenium der Liebe nur äfflsch nachplappern kann, wird es möglich, „der Schlange den Kopf zu zertreten“. Die conditio sine qua non aber, dieses entscheidende Wort zu finden, lautet: „Du sollst nicht mit dem Köder spielen, sondern anbeißen; dich auf den Markt bringen, auf den Küchentisch und in die Pfanne werfen lassen. Wie, Fisch, willst du sonst den Rundgang eines Fisches ausmessen von Nichts zu Nichts, von Rogen zu Rogen, und durchs kurze bläuliche Licht, das zwischen zwei Polen spritzt? Aus gar keinem Grunde, auch aus dem vernünftigsten nicht, weder aus Rücksicht noch aus Vorsicht, sollst du deinem Ver hängnis entgehen wallen. Forscher bist du, nicht Geschäfts- oder Vergnügungsreisender! Je unbekannter, gefährlicher der morgige Tag, desto reichere Beute nicht machst du, son-dem bist du.“
In der Kunst vom Sehen zum Erkennen führt Georgine Oer! auf unkonventionelle Art, die gewiß bei vielen Lesern Sympathien finden wird: „Die Kunst ist nicht für den Experten geschaffen und nicht für den Laien. Sie ist für Menschen geschaffen“, stellt sie als Motto auf und bietet damit durchaus keine Kunstgeschichte, sondern eine Bestandsaufnahme der vielfältigen Versuche des Menschen, sich selbst und seine Umwelt künstlerisch abzubilden. Der Mensch ist da natürlich das Maß aller Dinge. (Abbildung: Raoul Hausmann, „Der Geist unserer Zeit“.) Nicht zu übersehender Optimismus, wie er vermutlich gerade für den amerikanischen Durchschnittsleser zurechtgeschneidert ist, und eine gewisse Bildungsfreudigkeit geben dem Buch den Charakter eines Kompendiums über die Beziehungen zwischen Mensch und Kunst für Laien. Kulturelle Basis, religiöse Momente, Inspiration wie technische Probleme werden im Schnellverfahren demonstriert. Die Gegenüberstellung ist dabei natürlich das richtige Mittel, geistige, stilistische, qualitative Unterschiede zu markieren, den Leser auf große Entwicklungslinien wie auf Detailsfragen aufmerksam zu machen. Im ganzen ein interessanter Versuch der bekannten Kunsttheoretikerin und -kritikerin, die, als Korrespondentin großer Schweizer Zeitungen auch in Mitteleuropa geschätzt, vier Jahre lang am New Yorker Guggenheim-Museum tätig war und bis knapp vor ihrem Tod die „Geigy Art Collection“ aufbaute. (Vom Sehen zum Erkennen, Ein neuer Weg zur Kunst, von Georgine Oeri. Verlag Bucher AG, Luzern-Frankfurt. 156 Seiten, 059 Abbildungen. S 289.—.) KUR
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!