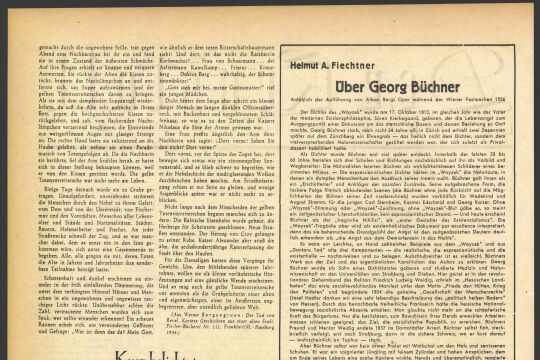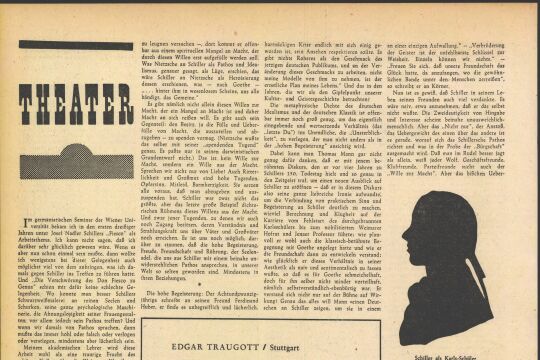Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Freiheit und Menschenwrde
Unwillkürlich fragte man' sich vor Aufgehen des Vorhangs zu Schillers „Wilhelm Teil“, ob man je eine restlos zufriedenstellende „Tell“-Inszenierung erlebt hat. Immer gab es etwas, oft vieles auszusetzen. Generationenlang gefürch-tetes Thema für Klassen- und Hausaufsätze, später für politische Phrasen ausgeschlachtet, war die Penetranz und Peinlichkeit der vielen Sentenzen nicht mehr zu übertönen. Wie soll daher einer uns heute dieses dramatische Gedicht ohne pathetisch-geschwollene Theatralik auf die Bühne bringen? Wie kann man Schillers Pathos mit unserem Tonfall sprechen? Freilich, spätestens von der letzten Szene des ersten Aufzuges an, da Fürst, Stauffacher und der junge Melch-thal zum erstenmal das Trutzbündnis der drei Länder gegen die Tyrannei „auf Leben und Tod“ besiegeln, ist man — entgegen allen Vorurteilen — von der bewegenden inneren Kraft des Dramas ergriffen. Die Heimat gibt den Grundakkord. Das Vaterland, dessen Unabhängigkeit vor Fremden die Schweizer verteidigen, ist das von Gott gegebene Land: damit werden zugleich Menschenwürde, Gerechtigkeit und Wahrheit verteidigt. Der Sinn des Dramas ist daher nur scheinbar historisch, im Grund jedoch ethisch, ja wohl metaphysisch. Daneben zeigt dieses ausgreifende Volksstück Schillers Freude am Theatralisch-Mitreißenden.
Der Inszenierung im Volkstheater unter Ulrich Erjurth (aus Hamburg) merkt man natürlich einige Angst vor der Poesie und dem Pathos an. Gestrichen sind demnach die zahlreichen in den Text eingestreuten Stimmung und Atmosphäre fördernden Lyrismen; nichts mehr von der Idylle am See gleich zu Beginn. Gestrichen ist alles, was in den Gesängen der Fischer, Hirten und Jäger auch nur entfernt an „Pastoralsinfonie“ gemahnen könnte. In der berühmten Rütliszene sprechen die Eidgenossen ihren Schwur o manierlich gedämpft, daß man geradezu ein wenig Spektakel vermißt. Aber auch so bleibt es noch in vielen Szenen (Teils Monolog und anderes) ein Fest vom Sprachlichen her. Die Aufführung wird von einigen trefflichen Schauspielerleistungen getragen. Max Eckard (Gast aus Hamburg) spielt den Teil mit ansprechender Bescheidenheit als unbekümmerten, aufrechten Mann, den erst der Zusammenstoß mit Geßler zum Helden macht. Aladar Kunrad gibt der Episodenfigur des Zwingvogts das extrem Böse und sadistisch Kalte. Klaus Höring ist ein leidenschaftlich entflammter Melchthal, Adolf Spalinger, ein ausgezeichneter Sprecher, gibt einen mannhaften Stauffacher, während Egon Jordan mit etwas zu konventionellen Mitteln einen würdig sterbenden Attinghausen mimt. Die übrigen Darsteller des figurenreichen Spieles blieben unterschiedlich. Wenig einfallsreich bewegt wirkten die Massenszenen. Das eindrucksvolle, wenn auch etwas düstere Simultanbühnenbild stammte von Gustav Manker. Großer Beifall.
Georg Bächner war Schillers Antipode. Blitzartig drängt sich einem diese Erkenntnis auf, wenn man — wie jetzt — die einzigartige Gelegenheit hat, Büchners „Woyzeck“ mit Schillers „Teil“ oder das „neue“, die hohe klassische Tragödie überwindende Pathos mit dem idealen, heldischen zu vergleichen. Auf den Idealisten Schiller folgte der hoffnungslose Fatalist und Antiheroiker Büchner. Bei beiden ist die unverminderte Macht des Wortes nicht von der Welt zu trennen, die sie hervorbrachte: der wissenschaftliche Materialismus hier, der philosophische Idealismus dort. Büchner, der 1837 starb, stand in einem Umbruch der Zeiten. Die neue Weltanschauung ging eben daran, „ein Loch in die Natur“ zu machen, wie es der trunkene Handwerks-bursch in der Wirtshausszene von Büchners „Woyzeck“ übermütig ausdrückt. Das Zeitalter der Versuche begann, und der Mensch wurde zum bloßen Objekt, das man ausschließlich auf seinen Nutzwert hin gelten oder nicht gelten lipß. Für die Geschichte des armen, von aller
Weh mißbrauchten Menschen konnte Büchner die geschlossene Form des klassischen Dramas nicht mehr gebrauchen. Also schuf er sich seine eigene, in kleine, schnelle Szenen aufgelöste Form, wobei der Magie der Sprache der entscheidende Anteil zufällt, die Figuren in kurzen Reden zu überzeugenden Gestalten und die einzelnen Szenen zu scharf separierten, in sich geschlossene Einheiten werden zu lassen. Einer sehr wachen und zugleich sehr alten, bibelfesten Sprache, welche die Wortkargheit der Enterbten kennt.
Die Literarhistoriker haben längst nachgewiesen, daß Büchner mit seinem „Woyzeck“ Wedekind und den Expressionismus vorweggenommen hat. Daß die Quelle seiner zeitgebundenen und zugleich so prophetischen Dichtung Haß auf die damals herrschende korrupte Gesellschaftsschicht gewesen sei. Gewiß spielt das alles mit. Aber das erklärt nicht die Verhexung, die von einem Wort, von einem Satz, einer Szene bis zum heutigen Tag ausgeht, weil allzu leicht übersehen wird, daß Dichtung eben mehr ist als Haß, ja mehr als Form. Die unheimliche Hintergründigkeit in der Ballade vom armen Soldaten Woyzeck, sein Wort von dem Abgrund des Menschen — ..es schwindelt einem, wenn man hinabsieht“ — packt wieder und läßt den Atem stocken. Wieder einmal steht man im Bann dieser skizzierten Visionen, die sich nicht leicht erschließen — weder dem Zuhörer noch dem Schauspieler. Denn es wird auch für den begabtesten Schauspieler immer schwer sein, einen so komplexen und zugleich „verkürzten“ Text zu sprechen und zu „spielen“.
Für die Inszenierung im Akademietheater (Regie Erich Neuberg) hatte Stefan Hlawa ein nüchternes Bühnengerüst vor schwarzem Hintergrund geschaffen. Scheinwerfer „schnitten“ jede Szene aus dem Dunkeln heraus, nur die Kostüme brachten Farbe. Immerhin wurde dadurch ein dichter Szenenablauf ermöglicht. Bruno Dallansky in der Titelrolle war die gedemütigte, elementare Kreatur, großartig in den Ausbrüchen der Verzweiflung bis zum furchtbaren Ende. Nur das Unheimliche fehlte dieser Gestalt. Martha Wallner gab der heißblütigen Marie das Einfache, Naturhafte, Getriebene. Michael Janisch verkörperte als Tambourmajor die brutale Fleischlichkeit in Person, Josef Offenbach (ein Gast) als skurriler Doktor und Günther Haenel als spießiger Hauptmann waren die grotesk-karikaturhaften Vertreter einer unmenschlichen Zivilisation. Alma Seidler als unheimliche Märchenerzählerin, aber auch all die übrigen Mitwirkenden wären lobend zu erwähnen.
„Ein schwerer Brocken“, sagte jemand nach der pausenlosen Aufführung beim Hinausgehen. Er dürfte der Mehrheit des Premierenpublikums, das anderes gewohnt ist, aus der Seele gesprochen haben. Ein schwerer Block — aber er wurde immerhin bewältigt. Fragt sich nur, warum man ihm nicht in vollkommenster Kontrapunktik das federleichte Zauberspiel „Leonce und Lena“ gegenübergestellt hat? Es hätte ein großer Büchner-Abend werden können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!