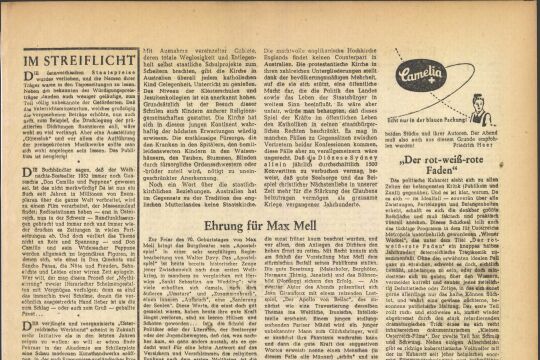Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Moliere bis Obaldia
Schauspieler sehen vor allem Rollen. Schreiben sie Stücke, so geht es ihnen besonders darum, gut darstellbare Gestalten zu scharten. Als der Schauspieler und Theaterprinzipal Moliere während seiner Wanderjahre in Frankreich sein erstes Stück „Der Wirrkopf“ — „L'Etourdi ou Les Contre-temps“ — schrieb, das derzeit im Theater in der Josefstadt zu sehen ist, stellte er sofort zwei bühnenwirksame Charaktertypen auf die Bretter.
Schauspieler sehen vor allem Rollen. Schreiben sie Stücke, so geht es ihnen besonders darum, gut darstellbare Gestalten zu scharten. Als der Schauspieler und Theaterprinzipal Moliere während seiner Wanderjahre in Frankreich sein erstes Stück „Der Wirrkopf“ — „L'Etourdi ou Les Contre-temps“ — schrieb, das derzeit im Theater in der Josefstadt zu sehen ist, stellte er sofort zwei bühnenwirksame Charaktertypen auf die Bretter.
In Mascarill, dem Diener, der bestrebt igt, seinem jungen Herrn Lelio zu der auch von Leandro begehrten Celia zu verhelfen und der nun, überaus aktiv und einfallsreich, alle sich unentwegt entgegenstellenden Hindernisse zu bezwingen weiß, ersteht eine ewige Figur des Theaters, eine Sehnsuchtsgestalt fast jedes Menschen, denn wer möchte nicht fähig sein, Widerstände, mit denen er zu kämpfen hat, kurzerhand zu brechen! Und Lelio ist der Tolpatsch, der alles durch Ungeschicklichkeit zunichte macht, was Mascarill für ihn unternimmt. Er stellt sich dauernd selbst ein Bein. Auch die Lelios gibt es immer wieder.
Diese Szenen wirken bei aller Primitivität durchaus dramatisch, da das unentwegte Zueinander zu einem — das ist der Witz — dauernden Gegeneinander wird. Doch variiert Moliere vielleicht ein dutzendmal die völlig gleiche Grundsituation, man bewundert seine Erfindungskraft, aber auf die Dauer ermüdet dies nicht nur, das letztlich Primitive der Situation entblößt sich immer mehr. Man müßte das Stück etwa um ein Drittel kürzen. Der Ubersetzer Hons Weigel ist sich laut Vorwort der Schwächen des Werks bewußt, er bewährt wieder seine Sprachkunst. Die Alexandriner wirken frisch, lebendig, vorzüglich sprechbar.
Regisseur Heinrich Schnitzler bringt das Spielerische der Szenen gut zur Geltung, ohne erfreulicherweise in Ambessersche Gagomanie zu verfallen. Das Bühnenbild von Roman Weyl ist der Dekoration einer Com-media-dell'arte-Aufführung nachgebildet, die von ihm entworfenen Kostüme sprechen durch die Harmonie gedämpfter Farben besonders an. Bruno Dallansky hat in plumper Beweglichkeit das komisch Dreiste des Mascarill, Klaus Wildbolz ist in dürrer Länge durchaus der Lolatsch Lelio.
*
Im 17. Jahrhundert entlarvten La Rochefoucauld und La Bruyere den krassen, hinter Masken getarnten Egoismus der Maßgeblichen, ihre Abscheulichkeiten. In Frankreich verbarg sich dieses Verhalten der führenden Kreise hinter Charme. In England aber kam statt dessen eine besondere Derbheit, ja Roheit hinzu, der Umgangston entsprach nahezu dem in Hafenkneipen. Das zeigt die Figurenwelt des William Wycherley, dessen gesellschaftskritische Komödie „Ein Freund der Wahrheit“ im Jahr 1676 im Royal Court Theatre uraufgeführt wurde und nun im Volkstheater gespielt wird.
Der verarmte Kapitän Manly hält von seinen Mitmenschen nur das Schlechteste, poltert grob heraus was er denkt, prangert Unehrlichkeit, Betrug, Speichelleckerei an, er ist eine anglikanische Vergröberung des zehn Jahre früher entstandenen Moliereschen „Menschenfeinds“ ins Ordinäre. Er riecht angeblich wie der Themse-Quai, man nennt ihn Teerjacke. Auch Manly durchschaut ein Frauenzimmer nicht, in das er verliebt ist. Nur hat Moliere der Celi-mene Grazie verliehen, Olivia aber erweist sich als libertin, falsch, geldgierig und ebenso ordinär wie der Kapitän, sie hintergeht ihn in gemeinster Weise. Doch verbindet Wycherley diesen Vorgang mit einem anmutigen Shakespeareschen Motiv: Viola aus „Was ihr wollt“ ersteht als Fidelia, die, als junger Offizier verkleidet, dem von ihr geliebten Manly dient. Das Rauh-
bein freilich nützt sie vor allem zur Rache an Olivia. Es wird daraus ein grimmig ruchloser Spaß, der ansonsten nur in dickem Pfeifenrauch bei Bier, Schnaps und derbem Gelächter gedeiht. Versteht sich, daß Fidelia und Manly, der alten Komödientradition gemäß, letztlich ein Paar werden.
Das von der Übersetzerin Anna Elisabeth Wiede umfassend überarbeitete Stück bringt Rudolf Kau-tek nicht zu optimaler Wirkung. Es liegt an der Besetzung. Herwig See-böck ist zwar ein prächtig vehementer Manly, aber weder hat Christine Buchegger glaubhaft das Abgefeimte der Olivia, noch Hilde Sochor in der ebenfalls wichtigen Rolle einer älteren Witwe das nahezu Diabolische dieser Gestalt. Als mehr oder weniger passabel erweisen sich die übrigen Mitwirkenden. Vortreffliches Bühnenbild von Rudolf Schneider-Manns-Au: ein zinnoberrotes Fachwerk.
*
Mit Recht wird ödön von Horvath als Dramatiker endlich gebührend geschätzt. Das darf aber nicht dazu führen, nun kritiklos jedem seiner Stücke hohen Rang zuzuerkennen. Die Posse „Hin und Her“, die derzeit vom Volkstheater in den Wiener Außenbezirken aufgeführt wird, spielt auf einer Brücke zwischen den Zollhäusern zweier Staaten, wo der auf der einen Seite als staatenlos ausgewiesene Havlicek auf der andern nicht angenommen wird und nun ständig hin und her wandert. Horvath versucht diesem Vorgang möglichst viel Lustigkeit aufzupfropfen, auch noch die Minister der beiden Staaten müssen sich da treffen, die zwecks zweifelhafter weiterer Erheiterung als Volltrottel dargestellt werden. Wo schärfste Satire allenfalls möglich wäre, gibt es lediglich mäßige Witze, ja, noch ein Happy-End. Geistig scharf Facettiertes fehlt völlig. Jedenfalls war das Schicksal der Staatenlosen dermaßen empörend und bitter — auch schon zwischen den Kriegen als das Stück entstand —, daß eine derart leichtfertige Behandlung als Posse in keiner Weise angebracht ist.
Regisseure sind bei dieser Aufgabe nicht zu beneiden. Werner Prinz bleibt kaum anderes übrig, als das Possenhafte herauszuarbeiten. Gustav Diefenbacher als Havlicek, Robert Werner als einer der Grenzer zeichnen besonders lebendige Typen.
Geschickt löst Brigitte Brunmayr auf der kleinen Bühne die unnaturalistische Kennzeichnung der Schauplätze. *
In einem eleganten Cafe gegenüber der Comedie Frangaise erklärte Rene de Obaldia mir gegenüber, es gehe ihm darum, große Probleme zu bieten, sie aber unverfälscht so zu wenden, daß man dabei lacht. Nun, ein großes Problem steckt keineswegs in der Komödie „Der Satyr aus der Vorstadt“, die im Kleinen Theater der Josefstadt aufgeführt wird. In diesem Stück, laut Untertitel „voll Satire und Moral“, erweist sich die Moral in einer subtilen Gewissensregung der Hauptgestalt, eines Fernsehsprechers, die Satire ergibt sich vorwiegend durch die Bearbeitung der Josefstadt-Leute, wendet sich etwas billig witzig gegen ORF. Dieser Fernsehsprecher Urban Loritsch ist allzu kleinen Mädchen zugetan, gibt diesem Hang aber keineswegs nach und wird als gesuchter „Satyr aus der Vorstadt“ aus nichtigem Anlaß verhaftet. Daß er sich innerlich schuldig hält, sich aber in der Haft — bis der wirkliche Täter entlarvt wird — frei von diesem Hang fühlt, macht den Kern des Stücks aus. Ein etwas kümmerlicher Kern. Doch sind die Szenen locker aufbereitet, reichen mitunter ins versponnen Poetische. Der Theaterskandal, den das Stück vor sieben Jahren in Paris hervorrief, wirkt unbegreiflich. Ionesco protestiert gegen die Ablehnung, doch seiner Zuerkennung „außerordentlicher literarischer Qualität“ kann man schwerlich zustimmen. Die gewandte Wiedergabe in der „Kleinen Josefstadt“ durch Edwin Zbonek führt als Fernsehsprecher Peter Matii, in weiteren tragenden Rollen Hellt Servi und Egla Wetnberger, Martin Costa und Lcruts Soldam, vor. Birgit Hut-ter schuf unter Mitwirkung ihrer kleinen Tochter die kritzeligen Bün-nenbilder und einen reizvollen Zwischenvorhang.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!