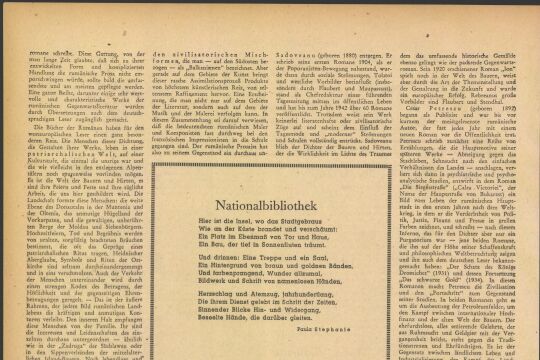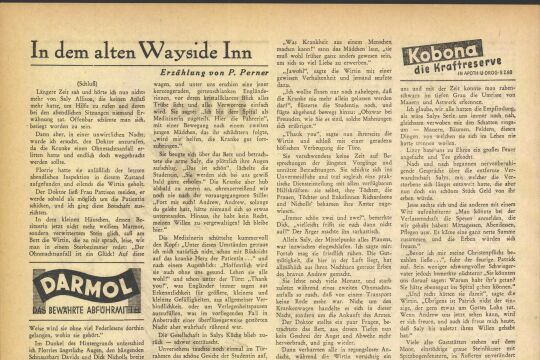Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
VON TEHERAN BIS TOKIO
Zunächst möchte ich einen Augenblick bei der unter ziemlich dramatischen Umständen aus dem Boden gestampften Arbeit unserer französischen Femsehequipe im Iran und damit bei der Großzügigkeit, Aufgeschlossenheit und vor allem auch menschlichen Anteilnahme der dortigen Behörde verweilen, die so wohltuend und erfrischend von der oft üblichen Pedanterie und kleinlichen Bürokratie derartiger Institutionen, mögen sie nun europäisch oder asiatisch gefärbt sein, abstach. Der anfangs für unsere ganze Tätigkeit in Teheran recht bedrohlich erscheinende Circulus vitiosus um die Visa begann mit einem telefonischen Mißverständnis. In meinem durch Klimaanlage angenehm temperierten Hotelzimmer erreichte mich zwei Tage nach meinem Abflug vom Bosporus der Anruf unserer türkischen Sekretärin, die mir aufgeregt mitteilte, daß der iranische Generalkonsul in Istanbul unserer attraktiven anglo-französischen Darstellerin, Gilian Hills — von hochblonder Haarpracht umwallt — die kurzfristige Ausstellung eines Einreisevisums verweigere. Bei meiner Intervention via Informationsministerium und Außenamt erfuhr ich dann, daß von den iranischen Behörden alle Weiblichkeiten, die als Schauspielerin, Sängerin oder Tänzerin in ihren Pässen firmieren, allgemein etwas stärker unter die Lupe genommen werden, weil diese Berufe oft als Tarnung für recht eindeutige Tätigkeiten benutzt werden.
Wegen der Kürze der Zeit sollte unsere Gilian ihr Visum ausnahmsweise bei der Ankunft auf dem Flugplatz in Teheran erhalten. Meine entsprechende Mitteilung nach Istanbul aber wurde von meinen Freunden so aufgefaßt, daß die gesamte Equipe ihre Visa in Teheran bekommen werde. Übermüdet, jedoch geduldig, harrten also ein Vertreter des Informationsministeriums und ich bis vier Uhr früh — die Maschine traf mit guten fünf Stunden Verspätung ein — im Flughafengebäude und fielen dann bei der Paßkontrolle aus allen Wolken, als keiner ein gültiges Visum vorweisen konnte. Die erst abgelehnte Gilian war nun die einzige, die berechtigt iranischen Boden betreten durfte. Unser Freund aus dem Ministerium aber erwirkte entgegen allen Vorschriften die Durchschleusung des gesamten Stabes, half uns, das gesamte Material noch in der Nacht — inzwischen war es beinahe sechs Uhr geworden — durch den Zoll zu bringen und nach diversen Interventionen bei verschiedenen Ämtern waren alle drei Tage später im Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis. Das Damoklesschwert der Ausweisung war dank gütigem Verstehen der iranischen Behörden für die verzwickte Situation nicht auf uns niedergefallen. Normalerweise hätten nämlich alle mit dem nächsten Flugzeug nach Istanbul zurückkehren müssen.
Ein kleines menschliches Schlaglicht von den Wirren zwischen Pakistan und Indien bot sich mir beim nächtlichen Abflug von Teheran. Beim Warten auf den aus Europa kommenden Düsenclipper fiel mir an der Flugplatzbar eine bildschöne junge Frau in einem eleganten seidenen Sari auf, die sich angeregt mit einem typischen Kolonialengländer unterhielt. Trotz ihrer dunklen, langen Haare war die Dame sicher keine Inderin, und auch ihr einwandfreies Englisch schien mit einem leichten deutschen Akzent gefärbt. Als sie dann gar ihrem Gesprächspartner eine österreichische Zigarette anbot, steigerte sich mein Interesse. Bald fand sich auch ein Anknüpfungspunkt, der mich in ihre Unterhaltung einbezog und da zeigte es sich wieder einmal, wie klein doch im Grunde die Welt ist. Denn ich plauderte hier zu mitternächtlicher Stunde mit der attraktiven Tochter eines Bregenzer Spediteurs, die einen Mann aus Pakistan geheiratet hatte. Ziemlich Hals über Kopf hatte der bei Lahore beheimatete Pakistaner dann seine junge Gattin, als die ersten Bomben und Granaten einschlugen, nach ihrem heimatlichen Bodensee in Marsch gesetzt. Die überstürzte Flucht ließ ihr nicht einmal Zeit, sich europäische Kleider mitzunehmen. Auf dem Umweg über Bangkok, wohin ich gerade fliegen wollte, war sie nun am Fuße des Elbrus-Gebirges gelandet und wartete auf den Anschluß nach Zürich, wo der besorgte Vater schon ihrer harrte, um sie in die Geborgenheit des elterlichen Hauses beim Bregenzer Martinsturm zu bringen.
Mit der Landung in Bangkok begann unsere Wanderung durch den Zauber und die Geheimnisse Asiens, die sich mir freilich mehr im genauen Kennenlernen thailändischer, chinesischer, philippinischer und japanischer Ämter und Bürokratiemodulationen als im Genießen exotischer Schönheit von Tempeln und Bauten offenbarte.
Das Ringen mit undurchsichtiger, zäher Liebenswürdigkeit und einem dem europäischen Tempo entgegenstrebenden Zeitbegriff wurde zu einem harten Prüffeld unserer angespannten Nerven. Schließlich waren für jede unserer Episoden höchstens sechs bis acht Drehtage festgesetzt, die möglichst einzuhalten die Pariser Zentrale uns immer wieder freundlich, aber nachdrücklich ermahnte. Einflußreicher Gönner und Freunde hatte ich mich im Reiche König Bhoumipols ver sichert, hatte versucht, geschickt zwischen ständig im Fluß befindlichen Machtsphären von Militärs und Zivilisten, zwecks möglichst schneller und reibungsloser Abwicklung unserer Arbeit zu lavieren. Da stellte uns die Beharrlichkeit eines von seiner Wichtigkeit durchdrungenen Zollbeamten beinahe ein Haxl, wie es so schön bei uns heißt.
25 Prozent Zoll für das gesamte von uns eingeführte Rohfilmmaterial, lautete die Forderung, die er uns mit lächelnd entblößten Zähnen verkündete. Unsere Argumente und die eindringlichen Vorstellungen uns attachierter offizieller Regierungsvertreter brachten ihn nicht um ein Jota von seiner Meinung ab. Unser Budget war wieder einmal in bedrohliches Schlingern geraten. Schweißgebadet — bei 40 Grad im Schatten und 95prozentiger Luftfeuchtigkeit — raste ich 72 Stunden lang, mehrmals täglich, zwischen der Stadt und dem rund 20 Kilometer entfernten Flugplatz, wo unser Material unter Verschluß lag, hin und her. Gleich im ersten Ansturm drang ich eine halbe Stunde vor Büroschluß ganz allein bis zum Generalinspektor für das thailändische Zollwesen vor, der gerade in Beratung für die Aufdeckung eines riesigen Opiumschmuggels verwickelt war. Ein kurzes Gespräch mit seinem, von Paris und Wien begeisterten Berater hatte mir das Entree verschafft. Trotzdem dauerte es noch zwei Tage, bis wir mit seiner Hilfe (sogar der Finanzminister wurde dafür in Bewegung gesetzt) das Rohfilmmaterial zollfrei zu unserer Verfügung hatten. Denn amtliche Verfügungen werden in Thailand noch mit der Hand geschrieben und das braucht eben seine Zeit.
Zu einem wirklichen Abenteuer aber gestalteten sich die Aufnahmen im thailändischen Urwald zwischen Pataya und Srirachar, ungefähr 250 Kilometer südlich von Bangkok. Hier waren Szenen eines Überfalls auf unsere beiden Hauptdarsteller — die zwei Reporter aus Paris — vorgesehen. Gewehre und Platzpatronen, aber auch echte für Großaufnahmen von Einschlägen waren vonnöten. Eine Schlange war ebenfalls mit im Spiel. Eine gut drei Meter lange Boa constrictor samt ihrem Bändiger begleitete die kleine Expedition, die zunächst in den mondänen Bungalows des Badeortes Pataya ihre Zelte aufschlug, um von dort mit einer vorsintflutlichen Kleinbahn in das grüne Dickicht vorzudringen.
Mit großer Bereitwilligkeit hatte uns der Chef des militärischen Fernsehens, Oberst Prasit, die benötigten Requisiten und auch einen jungen Leutnant aus prinzlichem Geblüt als
Berater und Helfer zur Verfügung gestellt. Das er uns mit dem Letzteren ein Danaergeschenk gemacht hatte, wußten zu diesem Zeitpunkt weder sein Vorgesetzter noch wir. Wir hatten uns bei den ersten Besprechungen in Bangkok und bei verschiedenen gemeinsamen Motivbegehungen nur darüber gewundert, daß der junge Mann eine ziemliche Vorliebe für scharfe Alkoholika, sprich Whisky und Wodka, an den Tag legte, und anscheinend auch eine gehörige Portion davon vertrug. Bei der Bahnfahrt in den Dschungel legte er sich in dieser Hinsicht keinen Zwang auf und brachte es auf eine durchschnittliche Tagesration von eineinhalb Flaschen Whisky. Selbst für die Tropen eine beachtliche Menge. In diesem Zustand kam dann ein gewisser Hang zu unberechenbarer Despotie zum Durchbruch, deren Folgen wir bald zu spüren bekamen.
Auch in Hongkong und auf den Philippinen bereitete uns die Unberechenbarkeit asiatischer Mitarbeiter so manches Kopfzerbrechen. Dabei ist durchaus nicht immer böser Wille das Motiv. Mit geradezu kindlicher Naivität ändern sie einen gefaßten Entschluß, erscheinen entweder nicht zur Arbeit oder gestatten einem zum Beispiel nicht, an einem fest versprochenen Ort zu drehen. Sie haben es sich nur anders überlegt und können es nicht begreifen, daß wir dieser Mentalität nicht zu folgen vermögen.
guter Letzt wäre unsere Episode mit der ominösen Z- Nummer 13 in Japan beinahe nach fünf Drehtagen in Tokio noch „geplatzt“. Unser amerikanischer Hauptdarsteller, Edward Meeks, benötigte als einziger ein Visum im Land der aufgehenden Sonne, hatte aber dessen Beschaffung in Manila versäumt. Eine kurzfristige Aufenthaltserlaubnis bei der Einreise auf dem Flughafen Haneda war die Folge. Tim Trubel der ersten Drehtage wurde auch deren Verlängerung vergessen. Schon drohte ihm die Einweisung ins Einwandererlager und ein anschließender Prozeß wegen unerlaubten Aufenthaltes im Lande des Tenno, dessen bürokratische Spielregeln noch strenger gehandhabt werden als im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten. Stundenlange Diskussionen mit den Einwanderungsoffizieren, ein schriftliches Gesuch des amerikanischen Vizekonsuls, persönliches Bemühen des Protokollchefs des japanischen Außenministeriums, Doktor Fujijama, den ich noch von seiner diplomatischen Tätigkeit in Wien gut kenne, erbrachten lediglich die Vergünstigung und den Entscheid, daß Meeks am nächsten Tag unbedingt Japan zu verlassen habe. Dabei hatte er aber noch zwei Drehtage zu absolvieren. Nur der freundschaftliche Rat eines uns besonders gewogenen Einwanderungsoffiziers schien Rettung aus dieser ausweglosen Situation zu verheißen. „Fliegen Sie mit der nächsten Maschine nach Okinawa, beschaffen Sie sich dort ein Visum und kommen Sie noch am gleichen Tag zurück.“ Meeks startete am nächsten Morgen dorthin, und ich erwartete mit flauem Gefühl im Magen bis gegen Mitternacht auf dem Flugplatz Haneda seine Rückkehr. Als ich ihn dann strahlend als ersten durch die Paßkontrollen eilen sah, war für mich auch die letzte und gefährlichste Hürde dieser an aufregenden Erlebnissen, aber auch an interessanten Einblicken reichen Reise um die halbe Welt genommen.
Der erste Teil dieses Reiseberichtes „Von Paris bis Teheran" wurde in der 10. Folge der „Furche“ veröffentlicht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!