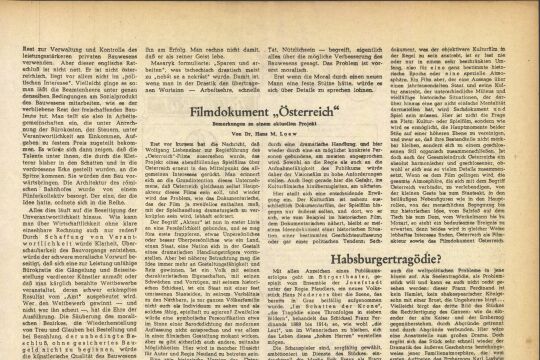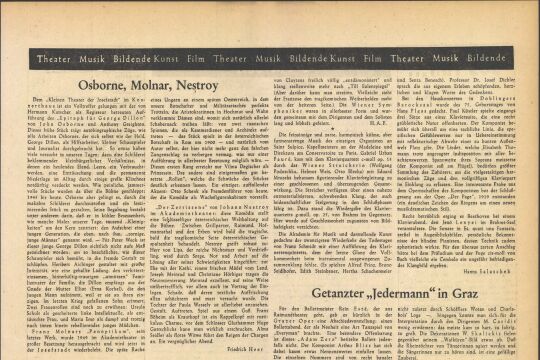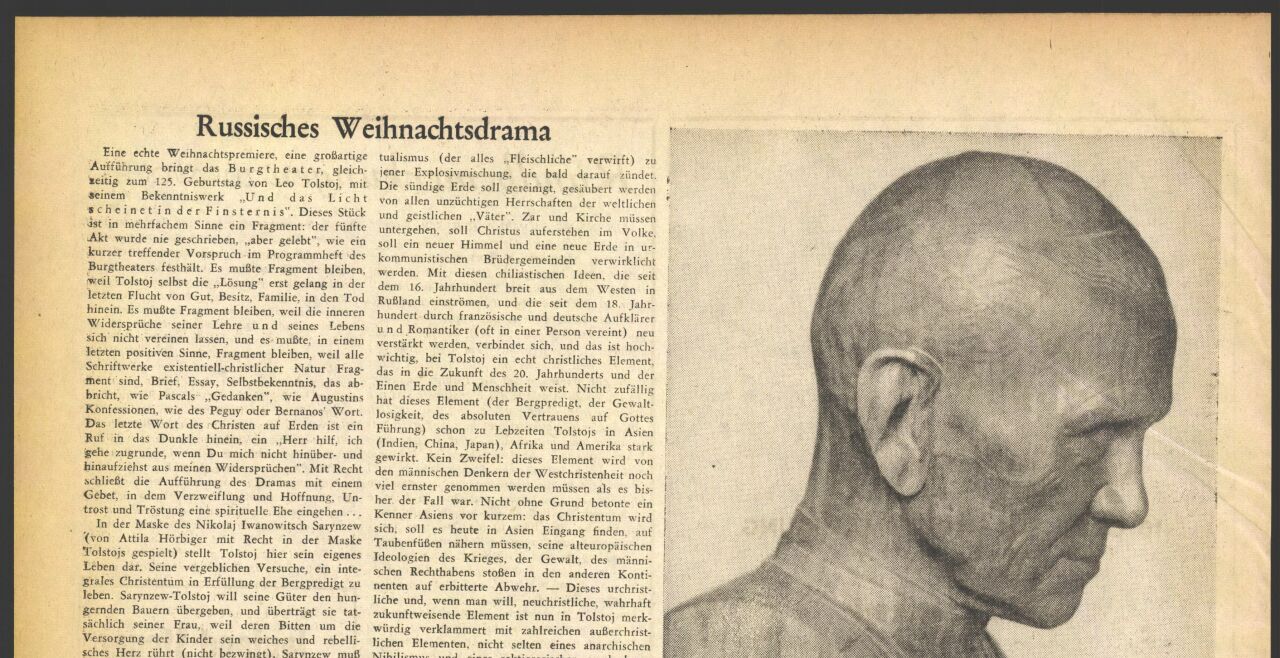
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von „Tiefland“ zur Sphärenharmonie
Auf die Gefahr, alle Eklektiker und Esoteriker zu enttäuschen, wollen wir eingangs erklären, daß wir „Tiefland" von d’Albert für eine großartige Oper halten. Die Vorzüge des Textbuches mit seiner passionierten, dem blutigen Ende zustürzenden Handlung wurden oft gerühmt. Nicht minder zu rühmen sind aber auch zahlreiche Stellen dieser Partitur, die für eine bestimmte dumpfe und lichtlose Leidenschaft eindringliche Töne bereit hat und durch die d’Albert an die Seite der größten sentimentalen Melodiker der Opernbühne, Tschaikowskij und Puccini, tritt. Der richtig verstandene Verismus des Textes und der Musik zeigen dem Regisseur, dem Bühnenbildner, dem musikalischen. Leiter und allen Darstellern völlig eindeutig ihren Weg. Ganz in ihrem Element war Christi Goltz als Martha, die wir als singende Schauspielerin und ihres schonungslosen Einsatzes willen höher schätzen, als andere Primadonnen, die unsere Opernbühne zieren. Sie hatte in Max Lorenz als Hirten einen darstellerisch zu schweren und stimmlich unbefriedigenden Partner und in Karl K a m a n n als Sebastiano einen in jeder Hin- sich bedeutenden Gegenspieler.
Es mögen Erinnerungen an jene denkwürdige Uraufführung der Sinfonie „Mathis der Maler" in der Berliner Philharmonie vor zwanzig Jahren gewesen sein, die Wilhelm Furtwängler veranlaßten, sich wieder eines Werkes seines damaligen Schützlings anzunehmen. Diesmal war es— merkwürdige Parallelität! — wieder eine dreiteilige Suite aus einer neuen (noch unvollendeten) Hindemith-Oper. „Diese handelt", schreibt der Komponist, „von Leben und Wirken des großen Astronomen und Philosophen Johannes Kepler, von den ihn fördernden oder hindernden Zeitereignissen und von dem Suchen nach der Harmonie, die unzweifelhaft das Universum regiert. Die Titel der Sätze (Musica Instrumentalis, Musica humana und Musica mundana) beziehen sich auf die bei den Alten oft anzutreffende Einteilung der Musik in drei Klassen und wollen damit auf die früheren Versuche hinweisen, die Weltharmonie zu erkennen und die Musik als tönendes Gleichnis zu verstehen." Man sieht, ein gewaltiger Stoff, den der Komponist in seiner Oper und speziell im letzten der drei Sätze gestalten wollte, wo er versucht, „die postulierte Harmonie der Welt in einer musikalischen Form zu symbolisieren". Dies geschieht durch ein Fugato und eine Passacaglia, die freilich die einzigen Stücke dieser klanggewaltigen und effektvollen Partitur sind, die ganz befriedigen. Die beiden ersten Sätze wirken fragmentarisch, aufgeputzt und lärmend oder leer, der zweite '(langsam) ist dünnflüssig, klingt aber sehr schön aus. — So mäg auch für den Dirigenten diese Wiederbegegnung mit „seinem" Komponisten ein wenig enttäuschend gewesen sein.
Im großen Sendesaal der R a v a g wurde mit drei österreichischen Erstaufführungen der Zyklus „Musica nova“"eröffnet. Vier kultische Tänze aus der Oper „M ij summer Marriage“" von Michael Tippett, von einem Vor- und einem Nachspiel eingerahmt, zeigen die charakteristischen Merkmale einer Handschrift, die am altenglischen Madrigalstil geschult ist und zugleich die impressionistische Palette beherrscht. „Die Erde im Herbst" (Der Hund jagt den Hasen), „Die Wasser im Winter" (Die Otter jagt den Fisch), „Die Luft im Frühling” (Der Falke jagt den Vogel) und „Sonnwendfeuer" (Das freie menschliche Opfer) Sind die hintergründigen Titel von vier symphonischen Tänzen, . die sich der Realisierung im Stil des modernen Balletts wohl ebenso widersetzen, wie Strawinskys „Feuervogel" oder Ravels „Daphnis und Chloe". — Das „C o n- cert dans l'esprit Latin" von Alexander Spitzmüller mit den vier kurzen Sätzen Sinfonia, Serenata, Permutazioni und Commedia (von Jeanne Manchon gespielt), verwendet komplizierte Rhythmen und zarte Orchesterfarben, die im letzten jazzartigen Satz energischer und kräftiger werdet!. — Die VI. Symphonie von Sergei Prokofieff, 1945 46 komponiert, zeigt jenen für Prokofieffs letzte Periode charakteristischen vereinfachenden, etwas grellen Plakatstil mit häufigen Unisoni und handfesten, nicht immer wählerischen Melodien. Der letzte Satz mit Reminiszenzen an „Peter und der Wolf" führt uns gewissermaßen in die symphonische Kinderstube. Hier wird recht robust und mit deutlichen Anklängen an Prokofieffs Landsmann, den mondänen Orientalen Aram Chatschaturian, musiziert und gelärmt. Der junge, etwa 25jährige Dirigent Kurt Richter leitete die Wiener Symphoniker mit verblüffender Ruhe und Sicherheit. (Das Konzert ist über den Sender Wien I am 27. Jänner um 20.15 Uhr zu hören.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!