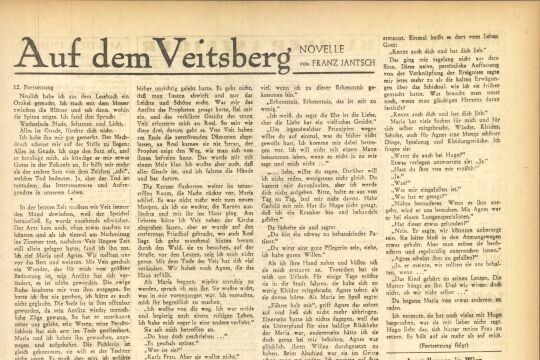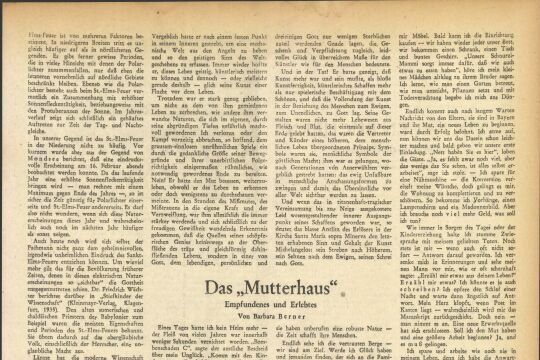Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Verlorenem
Die Liebe hat bei mir immer ihre Bestätigung durch eine tiefe Traurigkeit erfahren, oft ist sie mir durch diese Traurigkeit erst recht bewußt geworden; wenn eine Liebe zu schlummern schien, hat die Schwermut sie wieder aufgeweckt, wobei mir manchmal nicht recht klar war, wo die Schwermut Liebe, wann die Liebe Schwermut gemacht.
Im frühen Jahr 1945 — in der Stadt war schon Vorfrühling, daheim im Gebirge hing noch der Winter — habe ich die Eltern das letztemal gesehen. Sie hatten mich in allem Unwetter zur Bahn gebracht, hatten im Windzug am freien Bahnsteig gewartet, in den leichten Mänteln aus schlechtem Loden; waren mit mir bis zum Zug vorgetreten, in dem Morast aus Schlamm und Schnee, waren dann folgsam in die Rampe zurückgegangen und hatten dem kleinen Zug nachgewinkt. Ich hatte in der Wagentür gestanden und zurückgeschaut, solange es ging. Es war nichts Neues für mich, so ein „kleiner Abschied“ von daheim, das war alles schon so oder ähnlich dagewesen, an die dreißig- oder vierzigmal. Aber jetzt war der Krieg so nahe an die Heimat herangekommen, und doch fand ich immer noch Kostbarkeiten, die ich aus der Stadtwohnung in das Elternhaus legte, weil mein Herz an diesen Dorfwinkel glaubte, gegen alles Denken.
Ich redete mir auch das Gefühl aus, dies könnte ein Abschied sein für immer — und. so möchte ich mir auch heute wieder einreden, es werde ein Wiedersehen geben, obwohl immer wieder ein neuer Zug Rache durch das Tal meiner Kindheit geht und gewiß die Unschuldigen — kleine bangende Menschen wie die Eltern — mitergreift, quält, vertreibt.
Jetzt, da ich nichts mehr als ein kleines Lichtbild von den kleinen Leuten Rabe — keines vom Vaterhaus, keines vom Heimatort —, jetzt ziehen meine Träume hin, und ich denke daran, wie gut das Herz der Eltern ist. Sie konnten noch manchmal schreiben; von ihren immer wenigen Wünschen ist nur einer geblieben: daheim sterben zu dürfen. „Wir haben doch nichts Böses getan“, schreiben sie, meinend, daß Schuld und Verantwortlichkeit nur individuell sein können, nicht fühlend einen Anteil an der großen Schuld der Zeiten. Wo ist er denn, ihr Anteil? Ich sehe ihn auch nicht.
In der Heimat haben wir Fichtenwälder. Der neue Wald, wie er hier zu meinen Fenstern hereinsieht, ist schöner als die Wälder daheim, ist bunter: Buchen, Birken, Ahorn, Lärchen, Fichten, Tannen, Föhren, soviel Bäume, soviel Farben, dahinter das Hochgebirge — solche Ansichtskarten hat die Landschaft meiner Jugend nicht. Aber wenn ich die Wege durch den Wald hier gehe, so muß ich an das eintönige Mittelgebirge „daheim" denken und an altes Glück, an Kindertreiben, an Maria und Angelika. Ich versinne mich in vergangene Zeiten — auch den Heimatwald werde ich lange nicht wiedersehen. Ida bin ja von dort verwiesen. Es gilt nicht, daß Großvater Bäume gesetzt, Vater Felder gepflügt und ich dort zwanzig Jahre gearbeitet habe, Holz getragen und Lohnlisten addiert — es fragt niemand danach.
Aber der Wald bleibt, wenn auch alte Bäume fallen und der langsame Niederwald nachholt — es werden Fichten Fichten bleiben und ewige Bäche werden durchziehen, wenn ich nach langer Zeit heimkehren sollte. Die Liebe zum Wald hat es nicht so schwer, ihr Warten hat eine Aussicht; aber der Vater war 72, als ich wegging, die Mutter 67.
Ich hatte ein eigenes Heim. Eine Stadtwohnung mit aller Bequemlichkeit, mit viel Möbeln, viel Büchern, Kleiderschränken, Schuhbänken, Teppichen, Bildern. Dort lebten wir Jahre; Frau, Kind, Mann, Dienstmädchen. Das Leben war etwas lärmend, der Tag anstrengend. Man war am Abend müde, vergaß, daß man gut lebte, daß das Geld sich folgsam auf Anruf einstellte; vergaß auch manchmal, daß Frau und Kind daheim warteten.
Eines Tages war man allein. Da ging man abends von einem Zimmer ins andere, rauchte viel Tabak, stellte das Familienbild zur stillen Andacht auf und betete: „Herr, erhalte sie mir, ich wußte bis heute nicht, wie sehr ich sie liebe.“
War auch die Bücherwand schön! Von tausend Bänden hatte ich nicht viel retten können: ein Neues Testament und Viktor Hugos „1793", eine Widmung des einzigen Freundes von den letzten Weihnachten. Eine Auswahl Lyrik war für das begrenzte Gepäck als zu schwer befunden, zerschnitten und nochmals ausgewählt worden.
Hätte man in die Zukunft gesehen, würde man mehr mitgenommen haben, man hätte — meint man etwas später — doch noch zwei Kilo mehr tragen können. Zwei Kilo wären eine ganze Herrlichkeit gewesen von Hesse wenigstens „Der Weg nach Innen", von Fontäne zwei, drei Bücher, der Matthias Claudius in dem schönen Lederband mit zeitgenössischen Stichen, dazu das gute englische Wörterbuch mit der genauen Aussprachebezeichnung. Das waren alles Stücke, nach denen 1945 und 1946 das Herz lechzen mußte.
Auch einiges vom Selbstgeschriebenen fehlt mir, so die hundert Seiten Roman, die ich begonnen, als ich noch Dichter werden wollte. Der Titel stand fest: „Maria, so lange sie glücklich war." An sich ist mit der Schrift nicht viel verlorengegangen. Ich bin nicht über eine Kindheitsgeschichte hinausgekommen — aber die Arbeit war mir ein wertvoller Beweis für meine Endlichkeiten. Es ist mir der Mangel an Erfindungsgabe klargeworden, die Neigung zum träumerischen, müden Verspinnen, die Unbeholfenheit in der direkten Rede. Auch war es vermessen, gerade eine Mädchenseele darstellen zu wollen — ein kleiner Schreiber soll nicht so groß sein wollen wie der liebe Gott, und bei der Erschaffung von Menschen behutsam vorgehen.
Beim Grammophon und den vielen Platten brauche ich mir wenigstens keine Vorwürf zu machen, die wären im Rucksack nicht unterzubringen gewesen. Ein Stück habe ich noch aufgelegt, bevor ich das Heim verließ: „In diesen heiligen Hallen, kennt man di Rache nicht" — und es täte mir leid (daran dachte ich auch erst später), wenn der Besitznachfolger den guten Gedanken falsch aufgefaßt hätte. Auch eine Flasche Wein habe ich für ihn stehen lassen — oder für midi, wenn es dodi nicht ernst wäre und ich wiederkäme?
Ich hatte einst einen schönen Beruf. Dai ganze Leben vorher schien ein Schicksalsweg zu diesem Beruf gewesen zu sein, und, wi ich sagen darf, ein redlicher, mühevoller Weg. Nun war es so weit. Ein Wagen holte mich gegen Mittag ins Amt. Auf dem Tisch standen zwei Telephone. Im Vorzimmer warteten Besucher, die Post brachte Stellenbewerbungen, Bettelbriefe; der Kalender war voll Termine geschrieben — es sind manch davon stehengeblieben, der Termin des Abschieds kam dazwischen, es war auch ein Abschied vom Beruf.
Wir haben gespart. Wir sahen böse Zeiten kommen. Wir hatten dann den Besitz verteilt, damit, wenn auch neun Räuber kämen, doch ein zehntes Zehntel erhalten bliebe (für Brot; für einen Arzt, wenn das Kind krank würde) — es sind aber zehn Räuber gekommen.
Und was ist geblieben? Zwei Gefährten fürs Leben: eine Frau, ein kleiner Junge; die Gesundheit; das gute Gewissen; der auswendig gelernte Goethe mit Versen zum „seelischen Lastenausgleich“, wie den folgenden:
Ich weiß, daß mir nichts angehört als der Gedanke, der ungestört aus meiner Seele will fließen.
Und der günstige Augenblick, den mich ein liebendes Geschick von Grund auf läßt genießen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!