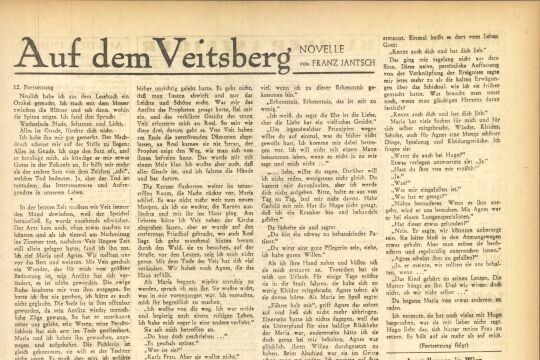Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
WANDLUNG IM WETTERMANTEL
„Kannten Sie“, fragte er mich, „den liebenswürdigen österreichischen Dichter Riesental?“ „Ich bin ihm nur einmal begegnet“, erwiderte ich. „Aber ich erinnere mich, daß er an diesem Tag mit einer hinreißenden Mischung von Einfachheit und Geheimnis gesprochen hatte. Um seine Worte wogte gleichsam ein dünner Nebel, der den Menschen, die er schilderte, eine mehr als menschliche' Gestalt verlieh. Sogar Seine Stimme war seltsam und wie verschleiert. Ja, ich hatte ihn,.nur . ein einziges Mal gesehen, aber ic schätze ihn mehr als manche Menschen, die ich mein ganzes Leben kannte. Bald nach dieser kurzen Begegnung erfuhr ich zu meinem Leidwesen, aber ohne daß es mich sonderlich erstaunte, seinen Tod, denn er sah kaum wie jemand von dieser Welt aus. Seitdem sind mir auf meinen Reisen durch die verschiedensten Länder, in Frankreich, in Deutschland, in Italien, überall Freunde Riesentals begegnet."
„Ich freue mich über das, was Sie mir da sagen", beteuerte er, „denn ich bin ein Freund Riesentals. Wie Sie, hatte ich ihn eines Tages eine Stunde lang gesehen und habe ihn seitdem nicht vergessen können. Drei Jahre ist es her, daß er sich auf der Durchreise durch meine Heimat meiner erinnerte und sich für einen Tag bei mir ansagte. Das war in den ersten Herbsttagen, und die Luft war schon sehr kühl. Ich wohnte am Fuß der Berge. Riesental, gegen die Kälte empfindlich und zart wie er war, litt darunter, keine genügend warme Kleidung mitgebracht zu haben. .Könnten Sie mir', bat er mich lächelnd, .einen Mantel leihen?“ Sie sehen, daß ich viel stärker und größer bin als unser Freund. Ich holte einen braunen Lodenmantel hervor, den ich im Winter auf der Jagd zu tragen pflegte. Riesental zeigte mir belustigt, wie er sich mit doppelt übereinandergelegtem Stoff darin einhüllen konnte. In meinen Wettermantel gewickelt, ging er lange mit mir unter den Bäumen spazieren. An jenem Tag gefielen ihm mein Haus, mein Garten, das sich schon verfärbende Laub und am Abend das Holzfeuer im Kamin so gut, daß er beschloß, noch einen Tag zu bleiben. In der Nacht breitete er den Wettermantel übers Bett und zog ihn am nächsten Tag wie einen Schlafrock wieder zum Arbeiten an. Am Abend sagte er mir, daß er keine Lust habe, abzureisen. Ich wünschte mir nichts mehr, als diesen liebenswerten Menschen so lange wie möglich unter meinem Dach zu beherbergen. So reihte sich ein Tag an den anderen. Er blieb zwei Wochen, die er, in meinen Wettermantel gehüllt, verbrachte. Schließlich reiste er ab, wobei er mir als Andenken an diesen Aufenthalt ein Gedicht hinterließ. Einige Monate spätei erfuhr ich seinen Tod.
Im darauffolgenden Herbst bekam ich einen änderen Besuch, den eines französischen Schriftstellers, dessen klaren Stil ich liebe und den ich damals nur sehr wenig kannte. Auch er hatte sich in meinem Städtchen nur einen Tag aufgehalten, denn er wollte nach Wien Weiterreisen. Die Unterhaltung beim Frühstück wollte nicht in Fluß kommen. Es schien mir, als ob die von mir erhoffte Freundschaft entschwinde, daß wir zu verschieden voneinander waren, und ich begriff mit Bedauern, daß wir uns trennen würden, ohne uns nähergekommen zu sein. Nach dem Essen ergingen wir uns unter den vergilbten Bäumen. Er beklagte sich über die Feuchtigkeit, und ich holte ihm den Wettermantel Riesentals. Es ist eine recht merkwürdige Tatsache, aber sobald er diesen Mantel um seine Schultern gelegt hatte, schien mein Gast verwandelt. Sein von-Natur klarer, manchmal etwas zersetzender Geist, schien plötzlich von Melancholie verschleiert. Er wurde vertraulich, fast aufgeschlossen. Schließlich, beim Einbruch der Nacht, hatten sich zwischen uns Freundschaftsbande geknüpft und, wie vorher Riesental, blieb auch dieser nur für einen Tag gekommene Besucher zwei Wochen bei mir. - Danach wurde, wie Sie sich wohl vorstellen können, der braune Wettermantel für mich ein sehr wertgehaltener Gegenstand, dem ich, ohne wirklich daran zu glauben, eine symbolische und wohltätige Kraft zuschrieb.
Im darauffolgenden Winter verliebte ich mich in eine bezaubernd hübsche Wienerin, Ingeborg von D. Sie gehörte einer verarmten adeligen Familie an. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie sich durch ihre Arbeit bei einem Verlag. Ich hielt um ihre Hand an, aber sie war wie die meisten jungen Mädchen von heute auf ihre Unabhängigkeit bedacht und sagte mir — wobei sie durchblicken ließ, daß ich ihr nicht mißfiel —, sie wolle sich nicht durch eine Ehe binden. Ich konnte sie mir nicht, ohne darunter zu leiden, frei und ungebunden in einer großen Stadt und von skrupellosen Männern umgeben vorstellen. Wir verlebten so mehrere qualvolle Monate. Im Frühjahr erklärte sich Ingeborg damit einverstanden, mich in meinem Haus zu besuchen. Am ersten Abend ihres Aufenthalts gingen wir nach dem Essen hinaus in den Garten, und ich sagte zu ihr: „Wollen Sie mir einen großen Gefallen tun? Erlauben Sie mir, Ihnen statt Ihres Mantels eine mir gehörende Pelerine um die Schultern zu legen. Ich weiß, daß Sie nicht gerne in Gefühlen schwelgen. Dieser Wunsch muß Ihnen ungereimt erscheinen. Es ist Ihr erster Abend bei mir, gewähren Sie mir daher meine kleine Bitte.“ Sie lachte, und indem sie sich mit viel Anmut über mich lustig machte, gab sie nach.
Er verstummte, denn durch den Abendnebel kam vom Ende der Allee eine liebliche Gestalt auf uns zu, in eine braune Pelerine eingehüllt. „Kennen Sie eigentlich meine Frau?“ fragte er.
(Autorisierte Übertragung: Hans B. Wagenseil)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!