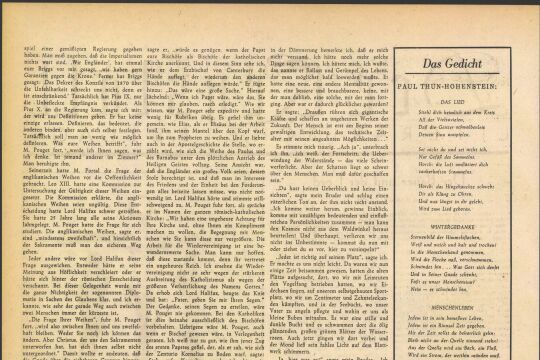Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Was Heimat sei..
Seit ich, liebe Freunde, das erstemal über meine Heimat gesprochen, habe ich in manchem meine Meinung geändert und habe vor allem gelernt, leiser zu sprechen. Ich habe gesehen, wie die am lautesten gepriesenen Anschauungen und Dinge, wenn man sie erst richtig ansah, gar keine wirklichen Werte waren. Ich hüte mich, in ersten Begeisterungen Worte zu machen; ich lasse meine blauen Blumen lieber erst einmal im Wetter stehn.
Ich habe vor zehn Jahren — ich war damals nie länger als acht Tage von daheim fort gewesen — die Heimat gepriesen. Ich habe etwa wörtlich gesagt: Ob es eine einsame, graue Stadt am Meere, ein vergessener Waldort sei, das Auge, das dort zuerst die Menschen, die i i i i
Erde sah, findet tausend Schönheiten in der Einöde; die Seele, die dort die ersten Freuden und Leiden erlebte, fühlt sich nirgends so wohl wie dort, in der Heimat.
Ich hatte das aus Büchern und Liedern und die Beredsamkeit jener Tage kam von der schönen Literatur her. Klar war mir, daß Heimat immer ein kleines Stüde der Welt sein müsse.
Ich mengte die Begriffe Landschaft und Heimat.
Ich bezeichnete Menschen, die in der Fremde das Glück gefunden hatten, als gefühlsärmer, „zigeunerhafter“ im Wesen. Ich fühlte Liebe zur Heimat und ihren Reichtümern, ich empfand wahr und tief — aber dunkel. Aber ich wollte Worte machen und mörtelte mir ein in den Grundfesten recht wackeliges Beweisgebäude zusammen, in dem ich mich zuweilen recht unbehaglich fühlte. Immer wieder sprachen Beispiele gegen meine Lehre vom alleinseligmachenden Leben in der Heimat. Weil in meinem Begriffe zuviel Landschaft steckte, brachte mir die Betrachtung der schönen weiten Welt arge Zweifel.
•
Ganz dunkel wurde es in meinem Kopfe, als ich ein paar Jahre die Volkswirtschaft als die wichtigste aller Wissenschaften betrachtete und die gemeine Nützlichkeit, den „Mehrertrag“, als höchstes Lebensziel. Vielleicht hat jeder einmal die Zeit, wo der böse Geist der Erde um seine gute Seele ringt.
Ich verstand unsere Bergbauem nicht, wenn ich durch die mannshohen Maisfelder Südslawiens fuhr, die schwarzen Äcker sah, die für wenig Arbeit viel Frucht geben.
In jenen Jahren hielt ich auch den Mund, vermied Reden über die Heimat und dachte daran, wie man durch Zollfreiheit in großen Wirtschaftsgebieten das Paradies auf Erden schaffen, und die Bergbauern erlösen könnte. Es war eine böse Zeit, geleitet vom Grundsatze der gemeinen Nützlichkeit.
Erst spät wurde mir mein Irrtum klar. Ich hatte die Poesie vergessen. „Auf Poesie“, sagt Gneisenau, „ist die Sicherheit der Throne gegründet.“ Auf Poesie sind aber auch nicht nur die Throne gegründet; Poesie hält auch Bauern auf Berghängen.
Im Bestreben, mir die Ursachen der neuen Herzenserhebung mit Worten zu erklären, versuchte ich es damals so: Wo das Leben seine Uraufführungen vor uns und mit uns spielt, da wird jedes Ding Markstein, wir erleben täglich, erinnert durch die Wahrzeichen, alles Schöne von zwanzig Jahren zurück und leben so „im farb'gen Abglanz“ das Leben hundertfältig.
Wenn ich, liebe Freunde, die letzten Jahre überlege, sehe ich, daß das
Schicksal mit mir einen gewissen Plan verfolgt. Immer hatte ich die Sehnsucht, meine Gefühle geprüft und bewiesen zu sehen durch alle Lebensmöglichkeiten. Keine Gottheit, die mir ein anderer angeraten, habe ich hingenommen, jedem eigenen Gefühle bin ich prüfend nachgegangen. Bequem war das nicht; immer geriet ich in neue Zweifel. War ich einst als Wanderer zur eigenen Freude in die Welt gegangen, so kam's auch einmal anders. Ich wurde in den Beruf der grimmigsten Heimatlosigkeit gedrängt; wurde Reisender. Zog mit Bestellbuch und Tasche durch ein schönes Land. Es ging mir gut. Ich aß und trank gut und viel und trieb Sdiindluder verschiedener Art. Ich nahm den Kampf gegen die alte Liebe zum Kinderland auf, ich wehrte mich gegen schwache Stunden, ich begann ohne Vorurteil ein neues Leben.
Und schmählich brach der Bau zusammen,
Eines Tages lief ich, es war auffallend genug, auf und davon. Die Leute schlugen die Hände zusammen: so eine Torheit. Mein alter Geist aber siegjubelte, der Ring der Prüfungen schien geschlossen; der Urgedanke meiner jungen Zeit hatte recht behalten.
Ich sage immer, das Schicksal macht unser Leben doch mehr als unser Wille. Es machte mit mir nicht viel Federlesens, ich mußte bald wieder fort. Ich ging aber nicht mehr als Wanderer, ich blieb in einer schönen Stadt, fand Freunde, und die wehmütigen Anwandlungen wurden seltener. Aber sie vergingen nicht. Sie wurden mit den Jahren nur zager und friedlicher. Ich war lebensfroh geworden in der Welt, hatte auch die wohltuende Glut fremder Herde gefühlt; und doch war's nie so wie bei Mutters Backofen und des Brüderleins Kartoffelfeuern.
Die Stadt, sagen ihre Kinder, hat hundert Türme, ich habe dort „Iphigenie auf Tauris“ gesehen, viel gelernt und gute Kuchen gegessen. Bin mit lustigen Mädchen im Lichtspielhause gewesen und an Sonntagen auf Burgen in der Nachbarschaft. Ich bin der Fremde und ihren Menschen für schöne Tage und Nächte dankbar.
Es fehlte aber immer ein Klang, ein Blätterbeben, ein mütterlicher Hauch, die mir zur Heimat das fernste Land hätten machen können. Wenn es auch draußen einmal noch schöner gewesen war, und daheim noch ärmer, nie habe ich mich von daheim fortgesehnt.
Wer mit besonderen Vorzügen und Naturschönheiten erklärt, warum es ihm daheim besser gefalle als anderswo, der sieht wie ein Kurgast, und so sehe ich nicht, und am Vierwaldstätter See ist es wirklich „schöner“ als bei meinen Scheuern und Pappdächern. Aber wenn wir nicht mehr wissen, warum wir lieben, wenn wir keinen zureichenden, von allen anerkannten Grund mehr finden für das Gefühl, dann erst ist es wahrhaft groß und unirdischen Ursprungs.
Draußen habe ich manchmal einen gefunden, der so war wie ich. Daheim waren's ihrer fünfzig, hundert. Ich verstehe jetzt auch, wie Landschaft und Mensch einander bilden, und die Verknüpfung der Begriffe Landschaft und Heimat in meinen ersten Erwägungen — was ich damals dunkel erfühlt — wird so auch noch gerechtfertigt.
Unlängst hat mich eine Zeitungsbemerkung, eine ganz klein gedruckte, sehr gerührt. Japanische Arbeiter, die auf Südseeinseln auswandern und dort ihr Leben lang für elendsten Lohn arbeiten, nie mehr heimkommen, sparen dieses Leben lang, damit sie für die Uberführung des Leichnams in ihr Land Geld hinterlassen können. Warum denn? Ist nicht „Gottes Himmel dort wie hier“?
Die Heimatliebe ist also kein Sondergefühl einiger Gefühlsmenschen, kein durch wirklichkeitsfremde Bücher verursachtes Weichsein. Auch die gelben Arbeiter auf Sachalin und Korea kennen es; sie werden es allerdings nicht zu „begründen“ wissen. Hören auch wir auf mit Begründungen. Die heimatfarbenblind sind, die werden nicht sehend werden. Und wer liebt, versteht uns schon.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!