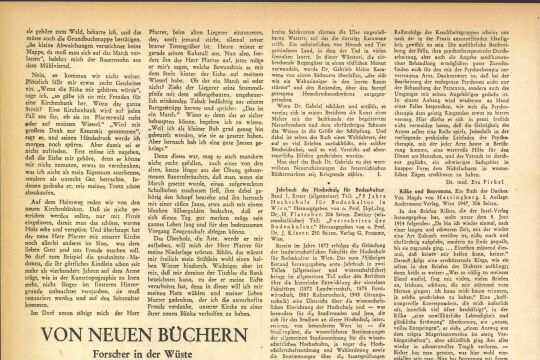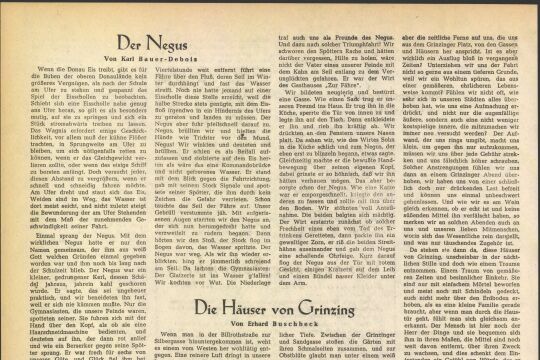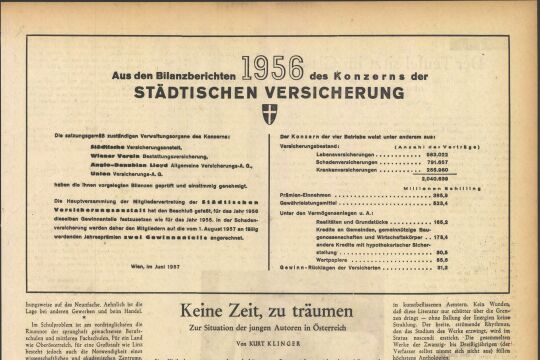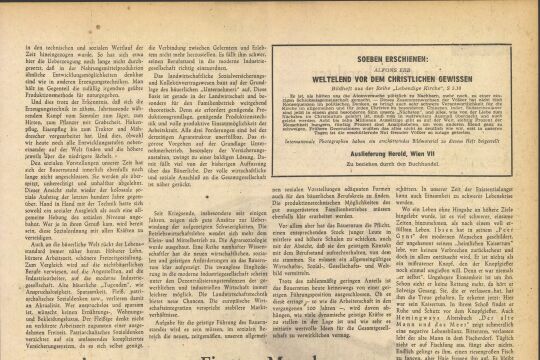Wer noch hier ist, wird verschlungen
Marie Gamillschegs Roman "Alles was glänzt" ist eine überzeugende Fallstudie darüber, was es bedeutet, in einem unaufhaltsam absterbenden Gemeinwesen zu leben. Die Autorin beweist dabei bemerkenswertes Feingefühl und scharfe Beobachtungsgabe.
Marie Gamillschegs Roman "Alles was glänzt" ist eine überzeugende Fallstudie darüber, was es bedeutet, in einem unaufhaltsam absterbenden Gemeinwesen zu leben. Die Autorin beweist dabei bemerkenswertes Feingefühl und scharfe Beobachtungsgabe.
Seit einiger Zeit entdecken junge Autorinnen und Autoren verstärkt die Provinz wieder als Sujet. Wenn sie nicht ins Klamaukige verharmlost wird, ergibt die topografische Peripherie aktuell tatsächlich oft einen ergiebigeren Stoff als die mehr oder minder autobiografischen Streunereien frisch zugezogener Metropolenbewohner, mit Sex and Drugs und Diskomusik in unterschiedlicher Abmischung. Im ländlichen oder kleinstädtischen Milieu prallen die digitalen, bevölkerungspolitischen und mentalen Veränderungen viel ungebremster auf, hier sind die Menschen schlechter auf die Rasanz der Umbrüche vorbereitet und müssen mitunter einige Entwicklungsschritte überspringen.
Marie Gamillscheg wählt einen besonders abgelegenen Landstrich inmitten der Berge und verbindet das langsame Sterben einer Bergbausiedlung mit der Mythentradition dieses Gewerbes. Hier ist es die Sage vom Blintelmann, der in sehr alten Zeiten über das Tal hin flog und das glitzernde Edelmetall in den Berg versenkte. Mittlerweile hat der Jahrhunderte hindurch betriebene Erzabbau den Berg völlig ausgehöhlt, eines Tages wird er sich dafür rächen, und das schon bald.
Bedrohliches Rumoren
Für die Wirtin Susa begann das Übel mit jenem Journalisten, der sich vor einiger Zeit ins Dorf eingeschlichen hat und dann einen Artikel über den bevorstehenden Einsturz des von Stollensystemen durchlöcherten Berges publizierte. Dass dieser Bericht schuld sein soll, ist natürlich Unsinn, was Menschen selten davon abhält, sich an greifbare Erklärungsmuster für Angst machende Vorkommnisse zu klammern. Das lädt auch den tödlichen Autounfall des jungen Martin auf der Serpentinenstraße, die aus dem Dorf hinausführt, entsprechend auf. Natürlich sind alle ehrlich erschüttert, insbesondere seine Familie und seine Freundin, aber zugleich ist der Unfall ein Bild für das nahe Ende des ganzen Ortes.
Es ist eine Handvoll von Figuren, deren Schicksal die Autorin abwechselnd erzählt. Wie das der Wirtin, die seit dem Selbstmord ihres Mannes Nacht für Nacht alleine dem bedrohlichen Rumoren im Berg lauscht und dennoch will, dass sich vor Ort nichts ändert. Ihr letzter Stammgast ist der Bergmann Wenisch. Von der Arbeit unter Tag gezeichnet, betreut er das Bergbaumuseum und verfällt körperlich immer mehr. Seine Tochter wird trotzdem nicht zurückkommen, und so muss er schließlich die Wohnung Richtung Altenheim verlassen.
Die junge Teresa wiederum besucht mit wahrem Feuereifer ihre Klavierstunden im Nachbarort und träumt von einem Leben als Pianistin, weniger aus Liebe zur Musik, denn als Fluchtstrategie. Eine "Wohnung mit straßenseitigem Balkon, das Auskommen ohne Garten. Direkt von der Haustür auf den Bürgersteig treten, gegenüber ein Geschäft oder ein Café", das sind für sie zentrale Bestandteile ihres künftigen Lebens in der Großstadt. Weg will Teresa auch, weil sie beobachtet, wie der Spalt in der Bergwiese unaufhaltsam breiter wird. Außerdem: "eine kann gehen. Das war schon immer so. Die Sache mit dem Gleichgewicht: Wenn eine geht, ist es trotzdem noch eine Familie, ist es trotzdem noch ein Ort. Solange gerät nichts ins Rutschen und alles bleibt Ordnung". Doch es ist dann ihre ältere Schwester, die eines Tages einfach eine Tasche packt und in den Bus steigt.
Ein Neustart? Aussichtslos!
Durch die Ankunft des Regionalmanagers Merih geraten die Dinge vor Ort noch ein wenig weiter durcheinander, Fremde fallen hier immer und selten positiv auf. Irgendwie am Ende -nicht nur was seine Beziehung mit Lara betrifft -ist auch Merih. Einen Neustart genau hier zu versuchen, ist von vornherein ein aussichtsloses Unterfangen. Er soll eine Art Revitalisierungsprogramm entwickeln und den Bewohnern schmackhaft machen, etwa in Richtung "Gesundschrumpfen als Chance /Regionale Daseinsvorsorge /Attraktivitätsrelevanz der Ortskerne". Das Scheitern ist vorhersehbar, das von ihm mit großem Pomp organisierte Dorffest ein Trauerspiel.
Marie Gamillscheg zeichnet dabei keine dumpfen rückschrittlichen Einschicht-Figuren. Im Gegenteil, immer wieder zeigt sie ein bemerkenswertes Feingefühl und eine scharfe Beobachtungsgabe, die aus der Art, wie Menschen sich bewegen oder sprechen, vieles über deren Charakter, Schicksal und Vorgeschichte herauszulesen oder auch hineinzufantasieren versteht. Manches mag ein wenig wolkig, abgerissen, mitunter auch formelhaft klingen, aber diese sprachlichen Schräglagen sind mit sicherer Hand gesetzt. Es sind keine Abstürze, sondern das Stilmittel, sich an Denkweisen und Gefühle der Figuren heranzutasten.
"Alles was glänzt" ist eine überzeugende Fallstudie darüber, was es bedeutet, in einem unaufhaltsam absterbenden Gemeinwesen zu leben. Wer noch hier ist und eines Tages vielleicht tatsächlich vom berstenden Berg verschlungen wird, sind jene, die hier arbeiten oder gearbeitet haben. Von denen, die den Profit aus der rücksichtslosen Ausbeutung des Erzes einstreichen, ist unter den Dorfbewohnern an keiner Stelle die Rede.
Alles was glänzt Roman von Marie Gamillscheg Luchterhand 2018 224 S., geb., e 18,50
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!