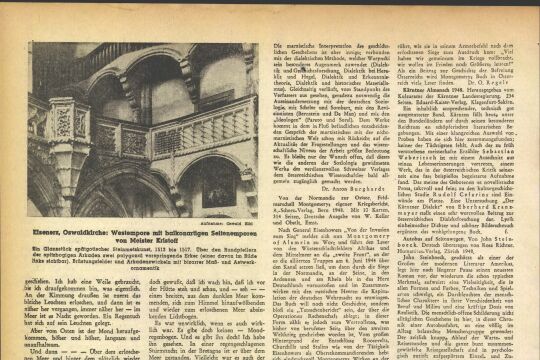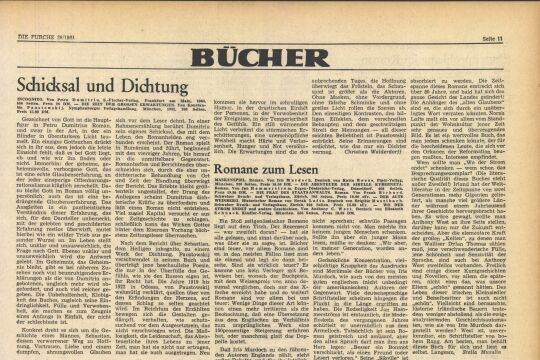Die Rolle jener Reporter, die unter Einsatz ihres Lebens von den Kriegsschauplätzen berichten, ist äußerst umstritten. Wie über Krieg und Tote schreiben, fragt sich auch Norbert Gstrein in seinem neuesten Roman "Das Handwerk des Tötens".
Risse zwischen Fiktion und Wirklichkeit will der österreichische Schriftsteller Norbert Gstrein in seinen Werken sichtbar machen, Risse, die vor allem wenn es um historische, faktische Begebenheiten geht, oft nicht deutlich genug sind. Man kann heute nicht mehr Geschichte erzählen - so Gstreins Auffassung, die sich durchgehend auf seinen Schreibstil auswirkt -, ohne die Rezeption von Geschichte in irgendeiner Form mit zu erzählen.
Fakten und Fiktion
Bezog sich diese Erkenntnis und ihre entsprechende literarische - übrigens meisterhafte - Durchführung in seinem Roman "Die englischen Jahre" auf eine vermeintlich jüdische Biografie zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, so gilt sie genauso für Begebenheiten, die gerade erst vergangen und bei denen dennoch und schon zum Zeitpunkt ihres Geschehens Wirklichkeit und Fiktion nicht mehr zu trennen sind. Trotz und auf Grund der Berichterstattung von Medien.
Die Rede ist vom Krieg im ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Historische Ausgangspunkte für den Roman bilden nicht nur die Kriegsgeschehnisse und ihre mediale Berichterstattung, sondern auch die konkrete Ermordung eines Journalisten, nämlich des Südtiroler Stern-Reporters Gabriel Grüner, der im Juni 1999 nahe der Ortschaft Dulje 40 Kilometer südlich von Pristina erschossen wurde.
Mehrere Annäherungen
Gstrein schreibt aber nicht über diese historische Person, sondern verfremdet sie, gibt ihr mit einem anderen Namen eine neue, eigene Identität, die sie als literarische Gestalt unantastbar macht - und ihn als Autor ebenso. Frei nach dem Motto, Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Nur lautet dieses Motto bei Gstrein "zur Erinnerung an Gabriel Grüner (1963-1999) über dessen Leben und dessen Tod ich zu wenig weiß als daß ich davon erzählen könnte".
Auf 380 Seiten erzählt Gstrein also gerade nicht von Grüner, sondern vom fiktiven Reporter Christian Allmayer. Diesen lernt man nicht direkt kennen, sondern aus der Sicht eines Ich-Erzählers, eines eigenartig teilnahmslosen Journalisten - vor allem aber aus der Sicht des auf den Ich-Erzähler permanent einredenden Kollegen Paul, der angeblich einst ein Freund des Ermordeten gewesen ist und nun, nach dem Tod Allmayers, einen Roman über ihn schreiben will. So sagt er jedenfalls. Den Roman verfasst schließlich aber ein anderer, nämlich der Ich-Erzähler.
Diese mehrfachen Brechungen braucht Gstrein, damit er über das Wahrnehmen und Schreiben reflektieren kann. In vielen Dialogen und Gesprächen, auch mit Personen, die Allmayer gekannt haben, die ihm nahe gestanden sind, wird bald deutlich: Ebensowenig wie man Allmayer - auch moralisch - einschätzen kann, kann man über die Kriegsparteien ein eindeutiges Urteil abgeben.
Darum wird jeder enttäuscht, der in diesem Roman die Entlarvung eines sensationslüsternen Kriegsreporters erwartet und mit ihm eine Abrechnung mit den bösen Medien, die alles anders darstellen, als es in Wirklichkeit ist. Dafür ist sich Norbert Gstrein getreu seines eigenen Ansatzes im wahrsten Sinne des Wortes zu gut. Entlarvt wird daher schon eher die Sensationslust der Daheimgebliebenen, unsere eigene, die sich anhört wie "Hast du schon gehört, ist das aber entsetzlich ..."
Tote Wirklichkeit
Der Ich-Erzähler gibt denn auch einmal zu bedenken, ihm gefalle die Art nicht, wie Paul sich in die Sache hineinsteigere, wie die beiden über den Tod von Allmayer sprechen. "Für mich hat es etwas Hyänenhaftes". Und auf die Frage, welche Rolle dabei wohl die Wirklichkeit spielt, hat er selbst die Antwort parat: "Sie
ist natürlich das Aas."
Ein drastisches Bild. Aas ist tote Wirklichkeit und die scheint besonders interessant. Dass sich Menschen um Menschen oder Orte kümmern, von denen sie nie zuvor gehört haben, liegt daran, dass sie gestorben sind. Als wäre die einzige Mitteilungsform, so der Ich-Erzähler, die Todesanzeige. Erst durch das Verschwinden erblickt etwas das Licht der Öffentlichkeit. Zu spät. Denn Tote bleiben tot. Werden auch durch Schreiben nicht mehr lebendig. Und dennoch soll doch nicht geschwiegen werden ... Ein Paradox, mit dem Schriftsteller ebenso wie Journalisten zurechtkommen müssen.
Wie darüber schreiben?
Wie über den Krieg und über die Toten schreiben, das ist die Frage, die sich durch den Roman zieht. Verschiedene Möglichkeiten werden vorgeführt: die Versuche des Kriegsreporters Allmayer; die des wenig erfolgreichen Journalisten Paul, dem die Ermordung des Journalisten, um es salopp zu sagen, gerade recht kommt, um endlich einen Stoff für seinen Roman zu haben, der aber noch einen Plot dafür finden will; und des Ich-Erzählers, der wie ein Unbeteiligter halbwegs vernünftig erscheint und neutral. Aber das angebliche Misstrauen gegenüber dem Schreiben artet selbst in Schreiben aus. In ihren Motivationen bleiben alle Figuren schillernd.
Der Roman thematisiert sich also auch selbst. Gstrein erkunde auf radikale Weise die Fähigkeit des Romans, Einsichten in die gravierendste Bedrohung von Menschen - den Krieg - zu vermitteln, so die Begründung der Jury, die dem Autor dafür den diesjährigen Uwe-Johnson-Preis zuerkannt hat, der ihm im September verliehen wird.
Kein neutraler Standpunkt
Gstrein klopft Behauptungen aller Art ab, die man in Diskussionen zum Thema zu hören bekommt, so etwa auch die Frage, ob nur unmittelbar Beteiligte über Kriege schreiben können, Schriftsteller also den Hauch des Todes der Kriegsschauplätze hautnah geschnuppert haben müssen um darüber Fiktionen kreieren zu dürfen.
Angebliche Unbeteiligtheiten oder neutrale Standpunkte jedenfalls gibt es nicht, das wird deutlich, weder für den sich am Kriegsschauplatz Herumtreibenden noch für den in seiner Redaktion Sitzenden. Weder für den Zeitgenossen noch für den Nachgeborenen.
Pauls - in seiner Suche nach dem besonderen Plot der Geschichte geradezu besessene - Nachforschungen lassen ein Interview auftauchen, das Allmayer 1991 in der Nähe von Vukovar mit einem kroatischen Frontkämpfer geführt hat, über das Handwerk des Tötens. "Wie ist es, jemanden umzubringen?" fragt der Journalist, der plötzlich selbst ein Teil der Maschinerie ist, über die er kritisch berichten will.
Gstrein wechselt zwischen Hamburg und Kroatien, schwenkt auch einmal nach Tirol, dem eigenen Herkunftsland und dem seiner Figur Paul, und bringt zunehmend bei den Ausflügen nach Kroatien mit seiner Sprachkunst Schönheit und Kargheit des Landes zum Blühen.
Die schöne Helena
Und die Frauen in Gstreins Roman? Ihnen scheint die ewig weibliche Bedeutung gegeben, des Krieges müde Männer in ihren Armen eine Zeitlang zu trösten. Oder ist dies alles nur Projektion des Ich-Erzählers?
Die Freundin Pauls zum Beispiel wirkt wie nach klassischem Vorbild gebaut und kann daher gar nicht anders heißen als Helena. Zu ihr fühlt sich der Ich-Erzähler immer mehr hingezogen, er sieht die in Deutschland lebende Kroatin von den anderen nicht verstanden und schon ist sie ein Objekt, um das man sich auch streiten könnte. Die Figur scheint von den Projektionen der Männer zu leben. Wie das Land, aus dem sie kommt?
Dort und da sind Anklänge an Cesare Pavese und seine Aufzeichnungen "Das Handwerk des Lebens" aus den Jahren 1935-1950 zu spüren, auf die ja auch der Titel des Romans anspielt. Immer mehr werden Leben und Schreiben eins, bis Paul soweit ist, für seinen Roman literarisch auch Helena zu töten. Doch Gstrein lässt Pauls Suche und Leben mit dem letzten Satz Paveses vor seinem Selbstmord, "Ich werde nicht mehr schreiben", enden.
Nicht mehr schreiben
Dass der Text nicht einfach zu lesen ist, ist natürlich kein Kriterium, das Literatur abwertet, im Gegenteil. Gstrein schreibt keine Verschlingbücher, und auch der Plot, der zu einem Krimi gereicht hätte, kommt so spät daher, dass er dafür nicht dienen kann.
Bei aller sprachlichen und formalen Meisterschaft gibt es aber leider auch störende Töne in diesem Roman. "Ein Schriftsteller, der reden will, einer, der meint, etwas zu sagen zu haben oder, noch schlimmer, vielleicht sogar loswerden zu müssen, ist genau der Typ, dessen Bücher ich in der Regel eher meide. Denn einer der Beweggründe wenigstens meines eigenes Schreibens ist, daß ich dabei gerade nicht Stellung beziehen muß." So Gstrein in seiner schon erwähnten Rede über "Fakten, Fiktionen und Kitsch beim Schreiben über ein historisches Thema", einer Rede, die nun auch als Suhrkamp-Taschenbuch vorliegt.
Warum, fragt sich die geneigte Leserin, die sein Schreiben und diese Einstellung schätzt, hat Gstrein seine eigene Grundhaltung verlassen und den Roman unterhöhlt mit Seitenhieben auf Autorenkollegen? Zwar sind sie namentlich nicht genannt, aber immerhin so wenig verfremdet, dass man sie leicht erkennt.
Musste Gstrein selbst etwas "loswerden"? Seine Polemik ist für den gelungenen Roman einerseits unnötig und andererseits ein Verrat am eigenen Konzept, nämlich dem grundsätzlichen Zweifel an Urteilen, und scheinen sie auf den ersten Blick noch so eindeutig begründet.
Das Handwerk des Tötens
Roman von Norbert Gstrein
Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2003
380 Seiten, geb., e 23,60
BUCHTIPP:
Die englischen Jahre
Die englischen Jahre; Selbstportrait einer Toten;
Fakten, Fiktionen und Kitsch beim Schreiben über ein historisches Thema
Von Norbert Gstrein
Suhrkamp Taschenbuch-Verlag,
Frankfurt 2003
3 Bände, 339, 109, 35 Seiten, kart. in Kassette, e 15,50