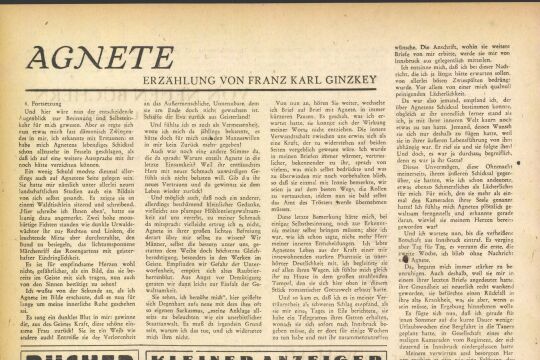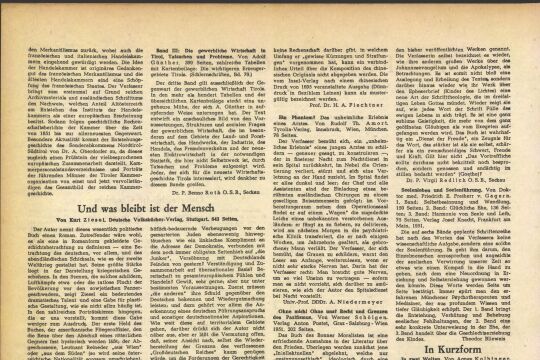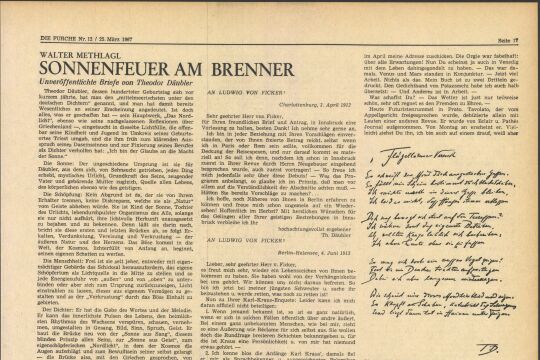Diese Aufzeichnungen sind nicht dazu bestimmt, mein per- sbnliches Leben zum Gegenstand literarischen Interesses zu machen. Mein Wunsch war nie darauf gerichtet, im Lichte der Offentlichkeit zu stehen. Ich habe lebenslang die Stille und Zuruckgezogenheit geliebt, und ich glaube, mit dieser Haltung auch den tieferen Anspruch eines der Dichtung ge- widmeten Lebens erfullt zu haben. Denn das Wort „Es bildet ein Talent sich in der Stille" ist immer noch gilltig, und es scheint mir eine gewisse Verwirrung der heutigen Zeit, dafi alles und alle weiterhin der Offentlichkeit preisgegeben sind, dap man nicht zu einer besinnlichen Stunde aufs Podium steigen kann, ohne von den zahllosen Apparaten der Reporter fixiert zu werden. Ja, ich bin der Vberzeugung, dap alles Wesentliche im Leben eines Menschen und eines Dichters der schiitzenden Hiille einer gewissen Verborgenheit bedarf. — Aber hier erhebt sich ohne Zweifel die Frage: Ja, warum schreibst du denn, trotz dieser Vberzeugung, deine Erinne- rungen auf? Ich glaube, sie bedeuten eine stille Rechen- schaft, die ich vor mir selbst ablege, den Anspruch, noch einmal gegen Ende des Lebens die lange Reihe des Gelebten — so wie es in Wirklichkeit war — voriibergleiten zu lassen. Es sind also nicht eigentlich Memoiren, es sind Erinnerungen, die ich hier fiir mich selbst und meine personlichen Freunde aufschreibe.
Schon als ganz kleines Madchen hatte ich meinen Vater manchmal auf Spaziergangen begleiten durfen, und er hatte mir dann immer geschichtliche Begebenheiten erzahlt. Da war vor allern die eigene Familiengeschichte, die er mir ein- pragte. Denn die le Forts waren eigentlich uberall dabei- gewesen. Zwar waren sie nicht Hugenotten, sondern ver- folgte Protestanten, welche aus Norditalien und Savoyen nach Genf auswanderten. Dort verwandelte sich das italie- nische il Forte in le Fort. Der Adel wurde 1698 durch Kaiser Leopold I. vom Heiligen Romischen Reich Deutscher Nation rezipiert. Allerdings fiihrte eine Spur nach der Insel Zypern, von wo einer unserer Ahnen, der sich le Fort de Vallerin nannte, nach Rom gesandt worden sein soli, um zwischen Papst Gregor IX. und Kaiser Friedrich II. zu vermitteln. Auch das Wappen — der Elefant mit den Palmbaum — weist auf die Kreuzzuge bin; das klein geschriebene 1 des Namens konnte ebenfalls auf einen franzosischen Unsprung deuten, der auch iiberliefert, aber nicht mehr urkundlich nachweis- bar ist. Historasdi verbiirgt jedoch ist nur die Flucht aus Coni und Savoyen nach Genf, wo noch heute jedes Mitglied unserer Familie das unverlierbare Biirgerrecht besitzt. Von Genf aus trait dann unser Ahnherr Francois le Fort fiber Frankreich und Holland in russische Dienste. Als Freund und Mitarbeiter Peters des Groden half er, das russische Reich europaisch umzugestalten. Sein Bild zeigt ihn in groBer Admiralsuniform vor dem Hintergrund brennender Schiffe. Nach seinem friih verstorbenen Sohn, bei dem Peter der GroBe Pate stand, wind seither jedes Mitglied unserer Familie Peter Oder,Petra getauft. Dem Adpiiral folgte in,russischen Diensien sein Neffe, der als Generalleutnant im Zuge des nordischen Krieges durch Mecklenburg kam und dort Land- besitz erwarb — hierdurch wurde spater unser Zweig der Familie in Deutschland ansassig. Einige le Forts traten in franzosische Dienste — so fielen zwei von ihnen fiir Ludwig XVI. beim Sturm auf die Tuilerien. Von ihnen bewahrte unser Familienarchiv einige Briefe, die den heiBen Atem jener sturmischen Tage ausstrbmen. Diese halfen mir spater, meine Novelle „Die letzte am Schafott“ zu gestalten.
Mit dem Tode meines Vaters hatte mein Leben seinen geistigen Wegweiser verloren. 'Wahrend meine Schwester in dem Kreise von Johannes Muller auf der Mainburg eine neue Welt kennenlernte, in die sie haufig zuriickkehrte, suchte und fand ich Anregung in unserem Ludwigsluster Bekanntenkreis bei zwei Menschen, die mich bis zu einem gewissen Grade geistig befriedigen konnten — die damals als Verfasserin anmutiger kleiner Erzahlungen beruhmte aber heute langst vergessene Frau Helene von Krause und der Gymnasiallehrer Professor Schaumkell. Frau von Krause war eine vomehme Dame mit einer groBen, damals schon seiten gewordenen Haube und mit vielen Erinnerungen an groBe Reisen, die sie in den Stiden — insbesondere nach Rom — unternommen hatte; sie zeigte mir mitgebrachte romische Marmorsteine und kleine Katakombenlampen, deren Anblick fiir mich ein Stuck weite Welt bedeuteten, nach der ich mich sehnte. Sie hatte in ihrer Jugend noch Bettina von Arnim gekannt und erzahlte mit liebenswiirdigem Spott, wie diese noch als altemde Frau in einem sie langweilenden Theater sich zutraulich an einen neben ihr sitzenden jungen Herrn geschmiegt habe, mit den erklarenden Worten: „Bettina will jetzt schlafen!" — Dann gab es da bei Frau von Krause die Geschichte von der WeiBen Frau der Hohenzollem, die einer ihrer Ahnherren vor der Schlacht bei Jena erblickt hatte, wie sie, als sein Regiment einen Hohlweg passierte, plotzlich an dessen Ausgang schwebend, beide Hande vors Gesicht geschlagen habe. —
Ganz anders war meine Beziehung zu Professor Schaumkell. Mit ihm konnte ich fiber Goethe und Schiller sprechen und geschichtliche Eindriicke austauschen, aber der viel Be- schaftigte vermochte meinen Wissensdurst doch immer nur fliichtig zu befriedigen. Das Beste, das ich ihm verdanke, war der Rat, doch einmal nach Heidelberg zu gehen — wohin er sich in alien Ferien zurfickzog —, um midh als Horerin an der Universitat einschreiben zu lassen. — Und eines Tages faBte ich denn auch den Mut, diesem Rat zu folgen. Mir half dabei auch mein etwas naives BewuBtsein, durch Privat- studien leidlich vorgebildet zu sein, was natiiiiich nur sehr bedingt der Fall war. Mein Wunsch stieB auf keinen Wider- stand — die damaligen Universitatsprofessoren waren noch nicht wie heute durch wahre Sturmfluten von Studenten be- drangt und nahmen meine Anwesenheit in ihren Vorlesun- gen freundlich und nachsichtig zur Kenntnis. Ich fand uberall offene Tfiren und konnte in vollen Ziigen die geistige Atmo- spahre einatmen, nach der ich mich so lange gesehnt hatte. Da waren besonders der Kirchenhistoriker Hans von Schubert und der Dogmatiker und Philosoph Ernst Troeltsch, zu deren Vorlesungen und zu deren Personlichkeit ich ein tieferes menschliches Verhaltnis gewann, fiir das ich lebenslang dank- bar bleibe.
Auch als Stadt war Heidelberg damals noch nicht in den Strudel des modesnen Verkehrs gezogen. Es war zwar nicht mehr das Heidelberg der Romantiker, aber immerhin noch von dem Zauber der lebendigen Erinnerungen an sie erfullt — , unvergeBIich und unvergessen. Ich konnte mir jeden " Augenblick ivonstellen, daB Brentano mir begegnen wiirde — das SchloB und die alten Walder, im Friihling von Maiglock- chenduft fiber und fiber erfullt, hatten noch keine Konzes- sionen an die Gegenwart gemacht — auch der Neckar rauschte noch, ungefesselt durch Stauwerke, schaumend unter der alten Briicke hindurch — und die stille LandstraBe an seinem Ufer entlang landete bei der idyllischen Stiftsmiihle, wo Professor Niebergal von Zeit zu Zeit einen kleinen Kreis Studierender um sich versammelte. Da gab es Streusel- kuchen und Wein und viele, viele widhtige Gesprache. Bei solchen Diskussionen fand ich mich nicht gleich, aber doch stetig fortschreitend, in Sprache und Denkdisziplin der Wissenschaft zurecht. Wenn ich heute ermutigt werde, meine Kollegnachschriften der Universitatsbibliothek Heidelberg zur Verfiigung zu stellen, so beweist mir dieses noch fiber Jahrzehnte hinweg, daB ich offenen Geistes aufzunehmen vermochte, was man mir darbot, und es als unvergeBliche Frucht dutch mein ganzes Leben zu bewahren.
Heidelberg bedeutet dann auch die wichtigste und ent- scheidendste Etappe meines Lebens und nicht, wie manche Interpretations behaupten, ein nach meiner Konversion fiberwundenes Stuck geistigen Lebens — inwieweit auch meine Konversion zur katholischen Kirche von der Heidel- berger Zeit mitbestimmt wurde, ist kaum je verstanden worden. Es bedurfte der ganzen theologischen und historischen Weitschau meiner Heidelberger Lehrer, um diesen Weg zu ermoglichen, dem meine von Jugend auf der Einheit der Kirche zugewandte Innerlichkeit zustrebte. Wenn in den gegenwartigen Tagen, in denen ich diese Erinnerungen aufschreibe, auch von der katholischen Kirche her dieser Weg gesucht wird, so lag die Sehnsucht nach ihm von friih auf in mir — es ging, um es sehr deutlich zu sagen, bei mir weniger um eine Konversion als Ablehnung des evangelischen Glau- bens, sondern es ging um eine Vereinigung der getrennten Bekenntnisse. Es bedeutet fiir mich das Geschenk einer be- sonderen Gnade, daB ich jetzt im hohen Alter das Konzil noch erleben darf, wo innerhalb der groBen Konfessionen auf beiden Seiten das Eis schmilzt und die Erkenntnis zu tagen beginnt, daB wir eins sind in der Liebe Christi, und daB die Unterscheidungen zeitbedingter Natur fiberwunden werden konnen und miissen. —
Doch ich kehre zu meiner Heidelberger Studienzeit zuriick. In manchen Vorlesungen war ich die einzige weibliche Hbre- rin, was Professor von Schubert immer am Eingang der Vorlesungen mit der scherzhaften Anrede „meine Herren und meine Dame“ quittierte. Auch die Studenten waren damals noch sehr hoflich — es war unmoglich, daB mir beim Verlas- sen der Universitat nicht einer in den Mantel geholfen hatte —, es herrschten selbstverstandliche Kameradschaft und jene Ritterlichkeit, die spater, nicht ohne Schuld der Frau, erlosch.
Eine neue Welt erschloB sich mir, eine Welt, nach der ich mich im Grunde immer gesehnt hatte. Mit Eifer suchte ich die Mangel meiner Bildung auszugleichen, und was man mit seinem ganzen Sein begehrt, das schafft man auch. Mehr als mein Wissen kam mir allerdings meine unbe- grenzte Aufnahmefahigkeit zugute. Langsam aber stetig wuchs in mir die Freude am Denkenlemen und die Verant- wortung des Denkens.
Fiir die Kirchengeschichte war Professor Hans von Schubert ein wunderbarer Lehrer. Seine Liebe zur christlichen Geschichte half mir uber deren Mangel hinweg, denn im Grunde muBte ich mir eingestehen: Wer die Kirchengeschichte, wie sie wirklich war, mit all ihren Entgleisungen wie Inquisition, Hexenprozesse und Glaubenskriege ge- schluckt hat, der ist als Christ gefeit. — Mit unbeschreib- licher Liebenswiirdiigkeit und, wo es anging, auch mit Humor, stellte uns Professor von Schubert vor die schweren Ratsel der christlichen Geschichte. Nie vergesse ich, mit welcher Erschutterung er fiber den Untergang des Templerordens sprach, den sein Freiburger katholischer Kollege, Professor Fincke, mit schonungsloser Wahrhaftigkeit herausgearbeitet hat. DaB die Kirchengeschichte weithin mitbestimmt war von den furchtbaren Gesetzen der Macht, gegen welche dann freilich immer wieder einzelne groBe Gestalten der Liebe und des Friedens sich erhoben, um oft nur zu unterliegen statt zu siegen — diese grausame Wahrheit, hier trat sie mir zum erstenmai entgegen.
Professor von Schubert war eine von Natur heitere Per- sbnlidikeit — dies und sein tiefer christlichen Glaube be- wahrten ihn vor dem Sturz in die Abgrfinde der Kirchengeschichte. Seiner Gfite verdanke ich auch die herzlichen Beziehungen zu seiner Familie, wie mir denn auch lebenslang seine Tochter liebe und treue Freundinnen geblieben sind.
Eine harmonische Enganzung, aber auch gelegentlich einen Gegensatz zu ihm, bildete Frau von Schubert, eine geborene Westfallin, von der ihr Mann zu sagen pflegte, sie und ihre Bruder haBten noch heutigen Tages Karl den GroBen. Aber solche Gegensatze spiegelten sich immer in einer Atmo- sphare ab, in der man letzten Endes frohlich miteinander lachte.
Auch das Verhaltnis zu Professor Troeltsch gestaltete sich freundschaftlich warm. Riickblickend glaube ich sagen zu durfen, daB er mein bester Freund gewesen ist, der mir spater in schweren und schwersten, durch das Schicksal meiner Familie bedingten Situationen beistand. In seinem Kolleg fiber „Glaubenslehre“ spiegelte sich deutlich das fruchtbare Ringen um die christliche Wahrheit. Der Glaube an sie war schon damals weithin unterhohlt, aber er wurde von Ernst Troeltsch doch immer wieder seiner letzten Substanz nach bejaht und gerettet. Mit aller Skepsis seiner Zeit ringend, war sein tiefstes Bekenntniis ein glaubiges, wenn auch dem ortho- doxen gegenuber stark relativiert. Professor Troeltsch besaB bei aller Kampfesstellung gegenuber gewissen dogmatischen Positionen doch eine wunderbar tiefe Einfiihlungskraft in das ihm nicht mehr GemaBe. In seinem Kolleg uber Syrnbo- lik war man zuweilen versucht zu meinen, er stelle seine eigenen und nicht fremde Gedanken dar. Ich erinnere mich noch, wie ihn die Studenten nach seiner Vorlesung fiber die Romische Kirche fragten: „Herr Professor, wollen Sie uns eigentlich fiberreden, katholisch zu werden?" worauf er lachend erwiderte: „Das ware noch nicht das Schlimmste." Das Schlimmste war fur ihn der Gedanke an das Erloschen der christlich gebundenen Seele, ja der religidsen Seele fiber- haupt. Von daher hat es mich auBerordentlich befremdet, daB in den Denkschriften, die, wahrend ich dies schreibe, zum 100. Geburtstag Ernst Troeltschs erscheinen, das religiose Apriori, dem er in seinen philosophischen Kollegs eine her- vorragende Stellung gab, keine Erwahnung erhielt — es be- deutete formal sein letztes und unabdingbares Bekenntnis. Im ubrigen ist es richtig, wenn jene Gedachtnisschrift dar- legt, Troeltsch selbst habe sich als einen Gescheiterten be- zeichnet. In der letzten Unterredung, die ich wenige Monate vor seinem Tode mit ihm hatte, war er tief davon durch- drungen, gescheitert zu sein. Aber liegt nicht gerade in solcher schmerzlicher Einsicht in die letzte Unerforschlichkeit unseres Seins, in die Kapitulation des Bedingten vor dem Abso- luten die tiefste Religiositat? Troeltsch zog die ewige Wahrheit aus der zeitbedingten. Wenn man ihn allein sprach, so bekannte er sich personlich zur Mystik — den schlesischen Schuster Jakob Bohme liebte er sehr. Im ubrigen konnte man immer wieder Ausbriiche seines Temperamentes erleben, wenn es um die Dogmatik ging: „Diese ffirchterlichen Theo- logen!" — Seine letzte Verbundenheit mit dem Christentum storte zeitweise sein Verhaltnis zu dem im ubrigen von ihm hochverehrten Max Weber. Sie lebten beide in dem gleichen, wundervoll von Baumen umrahmten Haus am Neckar, nahe der alten Briicke gegenuber dem SchloB — eine Wohnung, wie man sie ertraumt, wenn man an Heidelberg denkt
Ich habe Max Weber, der aus gesundheitlichen Griinden damals keine Vorlesungen hielt, nicht kennengelemt, wohl aber seine liebenswerte geistreiche Frau, eine der sympathi- schsten Frauenrechtlerinnen, denen ich begegnet bin. Die letzteren machten damals viel von sich reden — ich verstand ihre Ziele, die von der burgerlichen Gesellschaft her weithin berechtigt waren, ertrug aber ihre Kampfesweise zuweilen nur schwer. Frau Marianne Weber war eine begeisterte Anhangerin des Dichters Stefan George, der damals viel- fach in Heidelberg weilte. Ich sah ihn oft im Kodleg seines geistvollen Schulers, Professor Gundolf; sein feines, etwas hochmfitiges Profll war sehr einpragsam. Ein letztes Verhalt- nis zu George besaB ich nicht, darin einig mit vielen meiner Studienfreunde, welche schon damals den Umschwung zur Verehrung Rilkes vollzogen, die bald darauf im ersten Weltkrieg offenbar wurde. Uber das Verhaltnis von George und Rilke erzahlte mir damals ein Bekannter, er habe den letzteren zu einem Vortrag begleitet, welchen der Redner dazu benutzte, Stefan George auf Kosten Rilkes emporzuheben. Als mein Bekannter dann spater nach SchluB des Vortrages einige abfallige Worte uber die an Rilke geiibte Kritik fallen lieB, erwiderte der Herabgesetzte ganz ruhig: „Nicht wahr, es ist ein bdBchen iibertrieben gewesen."
Ganz besondere Freude hatte ich an den zum Teil bffent- lichen Koilegs von Carl Neumann, der eine der liebenswer- testen Gestalten meines Lebens war. Eine nervos sehr bela- stete Persbnlichkeit von ungeheurer Feinheit und Sensibili- tat, vertrat er doch in semen Vorlesungen mit groBer, fast kampferischer Intensitat den Vorrang der nordischen Kunst gegenuber der italienischen Renaissance. Das groBe Myste- rium dieser seiner „Konversion“, wie er selber es nannte, ist In dem Namen Rembrandt beschlossen. Sein tiefes Verhaltnis zu Rembrandt driickt sich in seinem wohl einzigartigen zweibandigen Werk aus, das er mir eines Tages personlich brachte und das mir lebenslang eine teure Erinnerung bedeutet.
Zu den vielen kbstlichen Geschichten uber Troeltsch gehort auch die, in der er zu Neumanns etwas xanthippeartiger Haushalterin sagte: „Sie komrnen noch einmal in die Hoile.” Als sich die so Angeredete wehrte, erhielt sie die trostliche Antwort: „Sie komme ja nicht ihretwegen hin, sondern wegen der bbsen anderen, die in der Hoile gestraft werden sollen." Bei aller Neigung zu iibermutigem Humor konnte Ernst Troeltsch todemst sein. Wenn er mich auf dem Heimweg vom Kolleg begleitete, kam beides oft zum Ausdruck. Immer ist fur mich die alte Briicke mit seinem Bild verbunden.
Bei dem geistvollen und spriihenden Professor Oncken horte ich neuere und neueste Geschichte. Hier, wie bei der Kirchengeschichte liegt fiir mich der Ansatz meines spate- ren tiefen Leidens an der Weltgeschichte. Parallel mit der Geschichte des Christentums geht das Schicksal der Gespal- tenheit der europaischen Volker, welche nur zu bald zur Katastrophe fiihren sollte.
Einer der nachmals besonders hervorgetretenen Schuler Troeltschs war Gogarten, mit dem ich damals auf gemein- samen Spaziergangen theologische Probleme walzte, wobei wir nicht ganz der gleichen Meinung waren. Von Gogarten, der schon damals durch Karl Barth beeinfluBt war, sagte mir Troeltsch, der zuweilen uber Menschen ganz spontan hell- sichtige Meinungen hatte: „Der wird sich noch einmal gegen mich wenden." Er hat sich leider spater auch gegen mich gewandt, gehort er doch zu den wenigen unter meinen evangelischen Freunden, die uber meine Konversion nicht hinweggekommen sind.
Aus dem im Ehrenwirth-Verlag, Munchen, erschienenen Erinnerungsbuch „Hdlfte des Lebens" von Gertrud von le Fort