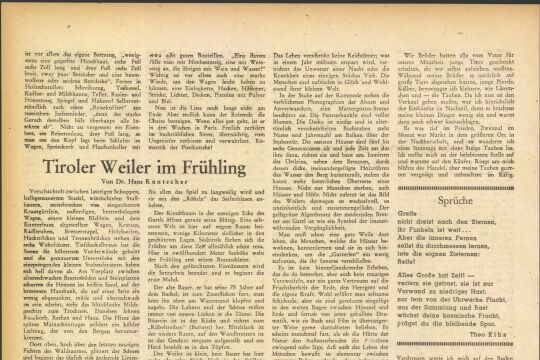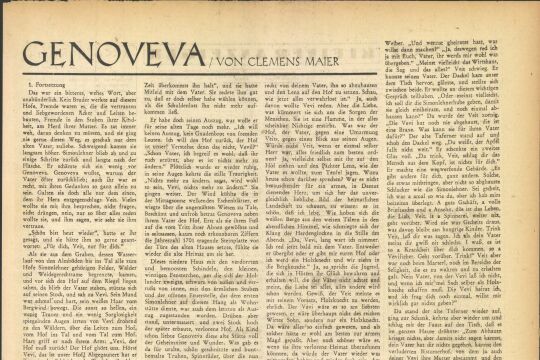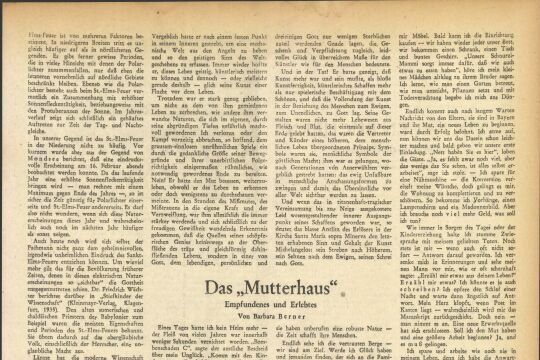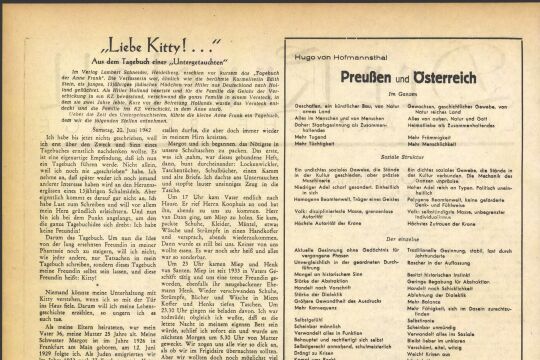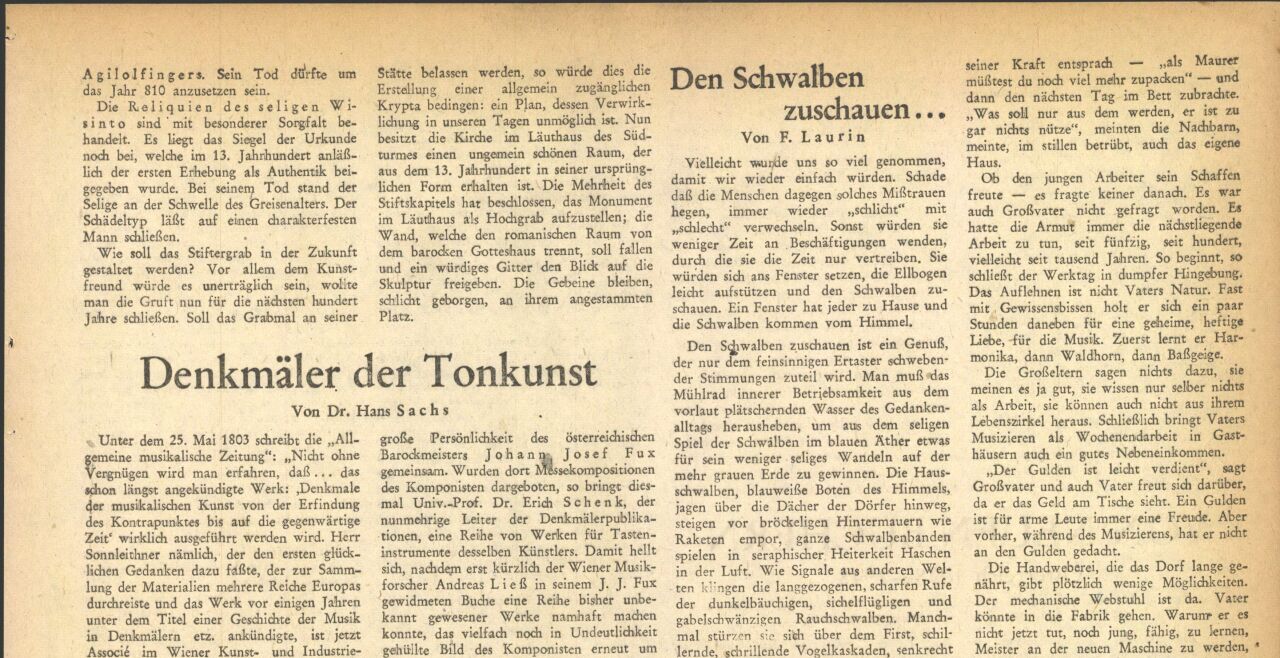
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wie meine Eltern arbeiten mußten
Meines Vaters Wünschen ist nie über den Lebenskreis der Armut hinausgegangen. Richtig Luftschlösser bauen lag ihm nicht. Einmal Baumeister sein zum Beispiel — davon hätte er nicht einmal als Knabe zu träumen gewagt.
„Maurer, höchstens Maurerpolier wäre ich in früheren Jahren gern geworden“, hat er mir oft erklärt. „Mit vierzehn war ich aber zu schwach und dazu immer kränklich, so konnte ich nicht in eine so schwere Lehre gehen. Da wurde ich Weber. Die Jungen sind immer das geworden, was der Vater war. Handweber war damals jeder zweite im Dorf. Der Pate, der ein Weberfaktor war, hat auch dazu geraten, und wenn der Pate etwas sagte, so galt es daheim." — So begann Vater als Weber. Vierzehn Jahre alt, kaum daß er mit den Füßen den Antrieb erreichte. Im Herbst gab es dann eine Abwechslung, da ging Großvater mit einigen
Nachbarn zu den Bauern dreschen. Eine erste Dreschmaschine war ins Dorf gekommen, und zur Mannschaft, mit der die Maschine nun von Bauer zu Bauer ging, gehörte auch Großvaters Bub. Zuerst hatte der Garben auf den Tisch zu legen, später Stroh vom Wurf wegzurechen. Dazwischen gab es didke Brote und weißen Schnaps.
Der Arbeitstag war beim Dreschen durch das Tageslicht begrenzt, beim Weben nicht. Da kam es darauf an, ob eine Ware oder ob der Lohn dringend gebraucht wurde — das zweite war immer, das erste oft der Fall. Im Sommer war dazu Brennholz für das ganze Jahr aus dem Walde zu holen. Dabei wurde jeweils die wohlfeilste Art gewählt, die allerdings immer die meiste Arbeit machte, wie das Ausgraben von Baumstöcken. Da geschah es oft, daß der Knabe und auch der junge Mann fester zugreifen mußte, als seiner Kraft entsprach — „als Maurer müßtest du noch viel mehr zupacken“ — und dann den nächsten Tag im Bett zubrachte. „Was soll nur aus dem werden, er ist zu gar nichts nütze“, meinten die Nachbarn, meinte, im stillen betrübt, auch das eigene Haus.
Ob den jungen Arbeiter sein Schaffen freute — es fragte keiner danach. Es war auch Großvater nicht gefragt worden. Es hatte die Armut immer die nächstliegende Arbeit zu tun, seit fünfzig, seit hundert, vielleicht seit tausend Jahren. So beginnt, so schließt der Werktag in dumpfer Hingebung. Das Auflehnen ist nicht Vaters Natur. Fast mit Gewissensbissen holt er sich ein paar Stunden daneben für eine geheime, heftige Liebe, für die Musik. Zuerst lernt er Harmonika, dann Waldhorn, dann Baßgeige.
Die Großeltern sagen nichts dazu, sie meinen es ja gut, sie wissen nur selber nichts als Arbeit, sie können auch nicht aus ihrem Lebenszirkel heraus. Schließlich bringt Vaters Musizieren als Wochenendarbeit in Gasthäusern auch ein gutes Nebeneinkommen.
„Der Gulden ist leicht verdient", sagt Großvater und auch Vater freut sich darüber, da er das GeLd am Tische sieht. Ein Gulden ist für arme Leute immer eine Freude. Aber vorher, während des Musizierens, hat er nicht an den Gulden gedacht.
Die Handweberei, die das Dorf lange genährt, gibt plötzlich wenige Möglichkeiten. Der mechanische Webstuhl ist da. Vater könnte in die Fabrik gehen. Warum er es nicht jetzt tut, noch jung, fähig, zu lernen, Meister an der neuen Maschine zu werden, ‘ das alte Können gut mitzuverwerten; warum er für lange Jahre landwirtschaftlicher Taglöhner wird, Gelegenheitsarbeiter — er weiß es nicht mehr, er sprach auch nicht viel davon.
Die Musiksonntage wiegen in seiner Erinnerung und Erzählung mehr. In die Zeit fallen auch andere Ereignisse: die Großeltern sterben. Eine Frau kommt ins Haus. Ein Sohn wird geboren. Der Gulden wird kostbarer als je.
Da erzwingt endlich das Leben von dem Mann, der immer nur sein Befehle aufnahm, einen eigenen Entschluß: er geht nun doch in die Fabrik, und zwar in die, welche am nächsten ist, die Bürstenfabrik des Dorfes. — Die Arbeitszeit währt von halb sieben früh bis zwölf, dann von eins bis sieben. Von der Stunde Pause nimmt der Weg von der Fabrik nach Hause zum Essen die Hälfte.
, Der Vater steht wieder hinten. Er hat nichts gelernt. Er steht an einer Maschine, die man nach zwei Stunden Lehrzeit bedienen kann. Er verdient nicht viel, aber es ist mehr, als es je vorher war. Er schleift an Bürsten die Reibflächen gleich. Es staubt in der Werkstätte. Die Lungen blasen. Es geht nicht weiter.
Da geschieht ein kleines Wunder. Ein Werkmeister mit Verstand und einem Herzen nimmt sich des neuen Arbeiters an. Er findet eine andere Arbeit für ihn. Vater kommt in die Fabriktischlerei, sitzt in einer kleinen Stube unter dem Dach, leimt und schleift die Bürstenbretter glatt und färbt sie gelb und rot und grün und legt Politur auf. Es brennt den ganzen Tag der Ofen, weil der Leim fließend bereitstehen muß. Das ist im Winter angenehm, im Sommer kaum zu ertragen, wenn die Sonne dazu auf das Fabrikdach scheint. Aber hier bei dieser leichten, in manchem fast tändelnden Arbeit wird Vater froh. Hier trägt er auch, nach vierzig, eine Handwerkslehre nach. Mit Stolz zeigt er der Mutter den Lohnzettel, auf dem neben seinem Namen zum ersten Male ein vollwertiger Bruf geschrieben steht: „Bürsten- tischler“. Hier erlebt er den Achtstundentag, verfälscht ihn allerdings, indem er an Sommerabenden in den Wald um Reisig geht, im Winter Heimarbeit mitbringt und nach dem Abendessen weitersch’leift und hobelt — ich weiß nicht, wie lange, denn ich schlafe, mein Bettchen steht daneben, immer früher ein. Er ist froh, er summt ein Lied. Seinen Musiksonntag hat er beibehalten.
Das ist Vaters Karriere. Am Schluß stehen zwanzig Schilling Wochenlohn.
Zu dem kleinen Verdienst mußte Mutter etwas zulegen können. Sie hat in ihrer Jugend das Kleidernähen gelernt. Sie ist die Tochter eines Häuslers, sie erhält nach ihren Eltern auch tausend Gulden Erbteil, die dann rasch ein Krieg frißt, so daß sie nicht wohltätig wirksam werden, nicht die Mühe wiedergeben, die in den ersparten Münzen steckt.
Mutter näht für die Dorfleute. Sie bringen die einfachen Arbeiten zu ihr, meist nur das, was umgenäht werden muß. Die neuen Sachen tragen sie zur anderen Näherin, sie trauen der neüen noch nicht. Es, kränkt Mutter oft.
aber es ist nicht zu ändern. Nur wenige Kunden, die ärmsten, bringen alles. Aber der Schrank ist immer voll, der Arbeitsvorrat wächst vor Ostern, vor Weihnachten — es gibt Beleidigungen, wenn die Bäuerin ihre Schürze nicht rechtzeitig erhält. Die Folge ist, daß Mutter vor allen hohen Feiertagen die Nächte opfern muß, daß der Haushalt leidet. Der Vater, später auch ich, der Sohn, predigen alle Zeiten, sie möge doch nicht soviel übernehmen; zum Leben würde es reichen, auch wenn ein Kunde wegbliebe — immer ohne Ergebnis. Und wenn es einmal ganz gut eingeteilt ist mit der Arbeit, dann kommt gewiß zwei Tage vor dem Heiligen Abend noch ein armes Weib mit einem geschenkten Stoff und bittet um die Weihnachtsfreude für ihr Kind — und Mutter nimmt auch diesen Auftrag noch an, näht im stillen weitet;, wenn wir mit unseren Lehren über eine zweckmäßige Arbeitseinteilung daher kommen.
Mutter näht auch dann noch weiter, als Vater schon nicht mehr in die Fabrik geht und sich auf Reisigholen im Sommer, kleine (verhaßte) Küchendienstleistungen im Winter beschränkt. Mutter näht auch weiter, als vorübergehend Geld genug kommt, die Kinder nicht mehr nehmen, eher gehen — ihr Arbeitskasten wird nie leer werden. Sie kann zwar nicht mehr mit der Mode mit, es geht ihr auch nicht mehr so von der Hand. Aber es ist da ein Kreis von Stammkunden, vierzig Jahre sind sie ihr treu geblieben, mit ihr alt geworden, die soll sie jetzt weitergehen lassen?
Herzliebe Eltern, das Leben lang bin ich die Frage nicht losgeworden, was meine eigene Tätigkeit wert sei, verglichen mit Vaters Lohn, verglichen mit der Mutter kleinen Nährechnungen — ich habe die Gewissensgleichung nicht lösen können — vielleicht, weil es mir zu gut gegangen ist.
Nun wohl, jetzt hat mich das Schicksal geworfen, und ich stehe da, wo Vater stand, als er so alt war — aber ich sehe vom Tal auf einen Berg zurück, von dem ich kam. Und hier im Tal ist mir’s, als be- gegnete ich dem Vater (der so fern ist, wenn er noch lebt) jeden Morgen, als gingen wir dann zusammen an die Arbeit, die schwere Arbeit und als müßte das alles nur sein, damit ich ihn und sein Leben verstehe und damit meine Augen die Welt klarer sehen!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!