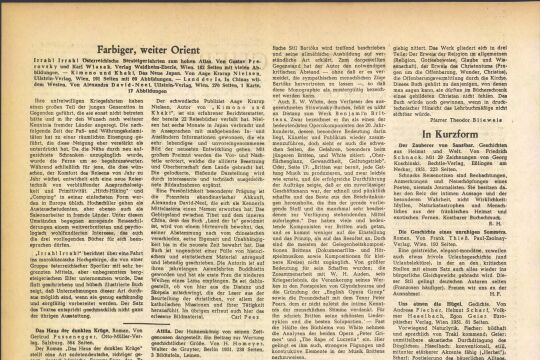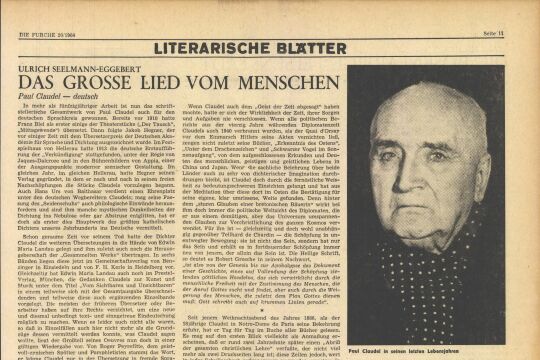Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
CLAUDEL, MILHAUD, DIE ORESTIE
Der große Glücksfall meines Lebens war die Begegnung mit 55 Claudel 1912. Ich hatte damals einige seiner Gedichte in Prosa aus der .Erkenntnis des Ostens' in Musik gesetzt. Er aber sprach gleich mit mir von der .Orestie', die ich dann in den Jahren zwischen 1913 und 1923 komponierte.“ „Wir haben ausschließlich über Musik gesprochen“, berichtet der Dichter seinem Freunde Francis Jammes, der die Bekanntschaft vermittelt hatte. Nicht als erfahrener Musiker sprach der damals Vierundvierzigjährige, um jene Zeit Generalkonsul in Frankfurt am Main, mit dem gerade zwanzigjährigen Komponisten, sondern als Dichter, der sich über die Möglichkeit, den Wirkungsbereich der Sprache, ihre Aussagekraft zu erweitern und zu steigern, sehr bestimmte Vorstellungen machte. Überdies fand er sich durch die, wie er es
nannte, „männliche“ Tonsprache Milhauds, durch die Klarheit der vom geistigen Licht des mediterranen Raumes aufgehellten Musik sehr angezogen. Lediglich die Übersetzung des „Agamemnon“ lag bei der ersten Begegnung des Dichters mit dem Komponisten vor. Die der „Choephoren“ war erst im Werden. Erst 1915, während eines kurzen Ferienaufenthaltes auf Hostel en Valromay, einem Landsitz über der Isere, wo in einem besonders glücklichen Augenblick „ ... die Stunde, die Frühling und Sommer trennt, Kantate für drei Stimmen“ entstanden war, ging er auf Drängen des Komponisten an die Übersetzung der „Eume-niden“, wollte er doch die ganze Trilogie vertonen.
Es ist die Frage, die vom ersten Gespräch an im Mittelpunkt der Erörterung stand, wo nämlich das Wort und wo die Musik zu dominieren habe, eine Frage, die auch für den Dichter nicht theoretischer Natur war. Denn er bedachte das alles daraufhin, in welcher Weise man sich unter Hinzuziehung der Musik der antiken Aufführungsweise nähern könne und wie heutzutage eine solche Aufführung zu verwirklichen wäre. An diese Möglichkeit zu glauben, fühlte er sich bestärkt durch eine Aufführung des Gluck'schen „Orpheus“ in Hellerau, dessen Inszenierung von Dalcroze bestimmt war. „Die Aufführungen waren unvergleichlich“, schrieb. Milhaud. „Zum ersten Mal erblickte ich Schönheit im Theater. Ein Zusammenspiel von Musik, plastischer Gestaltung und Licht, wie ich es noch nie gesehen habe.“
Auch für Darius Milhaud handelte es sich keineswegs darum, daß ihm hier ein großartiger Text, ein Libretto zugespielt worden wäre. Seine Musik sollte ihrerseits wie die Sprache des übersetzenden Dichters dazu dienen, dem erhabenen Werk des antiken Dichters zu neuer Wirksamkeit zu verhelfen. Wenn er einmal dlavon spricht, daß der „Künstler für jedes neue Werk neue Ausdrucksformen braucht“, so gilt dies in höchstem Maße für eine „Orestie“. Gewiß, das Finden der musikalischen Form und des Ausdrucks ist sein Werk, voraus ging aber ein intensiver Gedankenaustausch mit dem Dichter, der uns im Briefwechsel der
beiden teilweise zugänglich ist. Zunächst ging es nach Claudels Vorstellung darum, die Musik auf die Chöre — wohlgemerkt die Aischyleischen Chöre — abzustimmen, so daß weder die Deklamation noch der dramatische Rhythmus beeinträchtigt würden, daß ein Ton gefunden würde, über dem wie beim Psalmodieren von Epistel und Evangelium etwas wirklich Gesungenes schwebt, das sich bruchlos mit dem Text verbindet. Später, als er sich die große. Beschwörungsszene aus den „Choephoren“ einmal von einer Schallplatte abhört, entschlüpft ihm die Bemerkung: „Wie wünschenswert wäre es doch, ein ganzes Drama könnte in dieser Weise prosodisch festgelegt und metrisch aufgeführt werden durch Sänger-Schauspieler. — Warum nicht?“ Aber bei solchen Allgemeinheiten, wenn auch grundlegender Art, blieb es nicht. Wenn er schreibt, er spüre es, ohne Vernunftgründe dafür angeben zu können, der Dialog zwischen Klytämnestra und dem Chor könne nicht nur deklamiert werden, ohne deshalb Musik im eigentlichen Sinne zu werden, so verstärkt dies den Eindruck, mit welcher Zurückhaltung im Sinne eines Dienens am Werk der Komponist zunächst seine Aufgabe auffaßte. Klytämnestras Worte müßten nicht gesungen, die müßten getanzt werden, der Rhythmus solle mit einer Schroffheit hervorgehoben werden, für die die einfache Deklamation nicht ausreiche. Es bedürfe einer Musik, die auf das rhythmische Element reduziert wäre, oder kurze Posaunenschreie. Schließlich verständigt man sich auf Gesang oder eine Art langgezogener Schreie, die in abrupte Kadenzen münden. Und da Claudel an eine Insenzierung mit Masken denkt, taucht der Gedanke auf, gegebenenfalls einige Rollen doppelt, durch einen Schauspieler und einen Sänger, zu besetzen. Er fügt hinzu: „Es will mir scheinen, es ließe sich noch manche andere Verbindung zwischen Dichtung und Musik denken als die Wagners.“
*
Für den Dichter ergaben sich immer wieder formale Probleme. Je weiter seine Übersetzung voranschritt, um so deutlicher wurde ihm die Unentbehrlichkeit der Musik, die er sich aber auf ganz besondere Weise vorstellt, mehr linear, rhythmisch und bewegungsmäßig, weniger auf harmonischen Effekten basierend. Als Milhaud ihm nach einer längeren Pause, 1921, meldet, daß er die Arbeit an den „Eumeniden“ wieder aufgenommen habe, da kommt er auf die Frage der Striche zu sprechen und äußert, seiner Meinung nach käme im 3. Akt zum Beispiel den Worten keine Bedeutung zu, wichtiger sei es, daß das Publikum sich an der Auseinandersetzung als solcher interessiere, ohne ein einziges Wort zu verstehen, einzig durch die Bewegung und den Umriß der Satzperioden, die nicht musikalisch untermalt sein sollten, sondern prosodisch nachgezeichnet. Zur Ergänzung fügt er eine Inszenierungsskizze bei und ermutigt ihn, dies Werk ja^ zum Abschluß zu bringen. Musikalisch sei es wie für ihn geschaffen durch die äußerst ungleichartigen, kontrastierenden und auseinanderstrebenden Elemente, die zu vereinigen, zu verschmelzen und zusammengehen zu lassen, seine besondere Kunst sei.
Das Werk dieser langen gemeinsamen Mühen und Überlegungen sollte vorerst nur in seinen einzelnen Teilerl zur Aufführung kommen. Nach einer solchen der „Choephoren“ schrieb der Dichter an Darius Milhaud: „Das ist einer der künstlerischen Höhepunkte, wie man sie nur einmal in seinem Leben erreicht. Welchen Stolz bereitet es mir, Ihnen den Stoff für dieses erhabene Werk geliefert zu haben. Welch ein Wunder, auf solche Weise nach 3000 Jahren den altehrwürdigen Aischylos auferstehen zu sehen.“
Für Claudel selber hatte die ganze jahrzehntelange Beschäftigung mit der „Orestie“ ihren letzten Sinn darin, daß er hier die erste morgendliche Helle der Neuen Zeit sich ankündigen sah. Den Abschluß der Übersetzung der „Eumeniden“ meldete er dem Komponisten mit den Worten: „Das Finale nimmt zu meiner großen Überraschung eine erstaunlich christliche Wendung. Es braucht kein Wort daran geändert zu werden, um daraus etwas zu machen, das man Wort für Wort in unsern Prozessionen singen könnte.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!