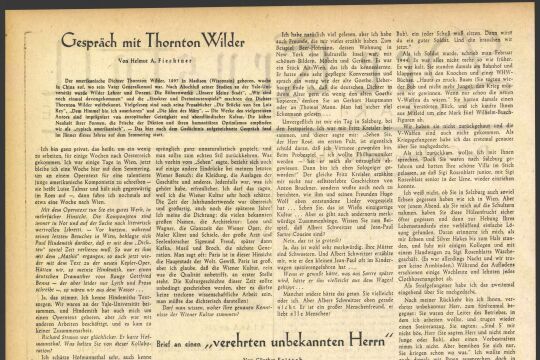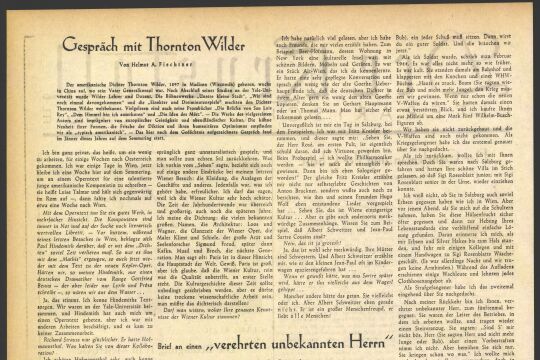Der Verfasser dieser Zeilen hatte das Glück, mit Clemens Krauss, der am 31. März dieses Jahres 75 Jahre alt geworden wäre, in seinen letzten Lebensjahren freundschaftlich verbunden zu sein. Er hatte lange vor der persönlichen Bekanntschaft mit Clemens Krauss begonnen, biographisches Material über den aus der Feme verehrten Künstler zu sammeln, und Krauss hat später meine Sammlung von Programmen, Photographien Zeitungsausschnitten und Schallplatten ergänzt durch das, was er selbst, beinahe achtlos, während eines Künstlerlebens aufgehoben hatte. Er war ein Mensch, der Persönliches gern verbarg und im Grunde seines Wesens Distanz und Zurückhaltung liebte. Er konnte ein herzlicher und verständnisvoller Freund sein, aber er hat wenigen Menschen „Du” gesagt. Ich glaube auch nicht, daß ihm je an einer eigentlichen „Biographie” gelegen war. Ihm kam es nicht darauf an, daß sein Publikum, dessen Anerkennung und Beifall er selbstverständlich, wie jeder Künstler, suchte und schätzte, etwas über sein persönliches Schicksal wisse, wo er studiert hatte und welche Krankheiten er durchmachen mußte, mit wem und wie oft er verheiratet war; aber es war ihm sehr daran gelegen, daß man wußte, worum es ihm bed der Ausübung seiner Kunst ging, was er für Prinzipien bei der Führung eines Opemtheaters, dem Aufbau eines Sängerensembles verfocht und gegen den Widerstand jeglicher „Materie” durchzusetzen versuchte. Er wollte als Künstler verstanden werden, er erstrebte speziell, daß die Jugend, auch unter seinen Fachkollegen, ihm nachstrebe, wie er Arthur Nikisch, Felix Weingartner, Richard Strauss als Vorbild nachgestrebt hatte; an der Aufzeichnung rein privater biographischer Erlebnisse lag ihm nichts: auch darin seinem Freund Richard Strauss sehr ähnlich. Er empfand das grundsätzlich als einen unerlaubten Einbruch in die private Sphäre: ein Künstler sollte nur durch das Werk, beziehungsweise die Wiedergabe wirken. Er hielt auch nichts von der Publikation privater Briefe oder Tagebücher. Vielleicht lag hier auch die Quelle für manche Zusammenstöße mit einem gewissen übersteigerten Journalismus, wenn ihm Fragen gestellt wurden, die Krauss unklug, überflüssig oder taktlos fand. Ich erlebte selbst einmal mit ihm im Künstlerzimmer, fünf Minuten vor einem großen Konzert, daß man ihn fragte, wieviel Dirigentenstaberl er schon aus Zorn auf den Köpfen seiner Musiker zerbrochen habe? Krauss reagierte sehr zornig, was er nicht getan hätte, wenn er ein echtes, sachliches Interesse an Fragen seines Berufes gespürt hätte. Da gab er gern Auskunft, denn er haßte zwar „publicity”, so altmodisch war er, aber als Künstler wollte er verstanden werden…
Manche falsche Ansicht über den Menschen Krauss ist sicher nur dadurch entstanden, daß er in seiner mimosenhaften Empfindlichkeit sich gegenüber seiner Umwelt, zumal in der Hitze des Gefechts, also seiner Arbeit, nicht anders abzuschirmen wußte, als sein Gegenüber scheinbar brüsk zurückzustoßen, um seine ihm notwendige „Ruhe” zu haben. Beleidigungen von Vertretern der Presse resultierten nicht aus Arroganz oder Überheblichkeit, sondern aus dem inneren Zwang des Künstlers, sich seine Sphäre nicht stören zu lassen, nicht aus der ihm unentbehrlichen „Stimmung” gebracht zu werden. Krauss tat sich darin zweifellos schwer und mußte sich mit eiserner Selbstdisziplin lockern, entspannen, um inspiriert arbeiten zu können: die kleinste Kleinigkeit, von der Außenwelt ungeschickt an ihn herangetragen, konnte Ausbrüche auslösen, die ihm entweder gar nicht bewußt wurden oder sogleich leid taten. Denn er war ein Mensch von großer Herzensgüte, ausgesprochener Weichheit (nicht von ungefähr war einer seiner Lieblingsschriftsteller Charles Dickens!), und suchte in der menschlichen Sphäre zu helfen, wo er nur konnte, ob nun mit Rat oder — sehr großzügiger! — Tat; aber man durfte ihm solche Dinge nicht vortragen, wenn er gerade künstlerisch beschäftigt war, was er immer sehr ernst nahm und als eine zu privater Entsagung verpflichtende Aufgabe auffaßte.
Gewiß war er von Natur aus unerhört begabt für die Dirigierkunst, für das Theater: nicht nur, daß ihm das Dirigieren, das er nie „erlernt” hatte, denn es gab damals noch keine „Kapellmeisterschulen”, leicht fiel, er war ein Mensch von so großer Natürlichkeit, daß ihm poch im Alter, als er schon vierzig Jahre dem Theater diente, Dinge auf der Bühne auffielen, die sonst nur das echte, in Geschmack und Urteil ganz unverbildete, also das naive Publikum zu bemerken pflegt; er konnte schauen mit den Augen eines wachen Kindes, dem Unnatürliches und Unlogisches bekanntlich viel schneller auffällt, als dem Routine gewohnten Erwachsenen, als dem Praktiker vom „Bau”, der sozusagen auch Dinge zu sehen glaubt, die nicht auf der Bühne zu sehen sind, weil er die Stücke schon kennt. Krauss konnte rasen — so geschehen München 1944 —, wenn der Regisseur zum Jungfemkranz „aus veilchenblauer Seide” im „Freischütz” grüne Seide verwendete und gar nichts dabei fand! In seiner berühmten Neuinszenäeirung der „Frau ohne Schatten”, Wien 1931, die er mit Lothar Wallerstein und Alfred Roller machte und die nach Aussage des Komponisten die erste war — zwölf Jahre nach der Uraufführung!, — die seine und Hofmannsthals Visionen verwirklichte, wollte er die Färber- Szenen in zwei Schauplätzen — Färberhaus und Färberhof — inszeniert haben. Er überredete den sich anfangs sträubenden Bühnenbildner mit Hilfe einer Kindererinnerung, ihm nachzugeben: als er auf seinem Kindertheater Sonntag nachmittags den Verwandten vorspielte, hätten sie es nicht geduldet, daß nach einer „Umbaupause” — das gleiche Bühnenbüd, ohne Verwandlung, zu sehen gewesen wäre. Wozu dann die Pause?! Eine für Krauss sehr charakteristische Anekdote—: die außerdem verbürgt ist!…
Krauss aber als Chef, bei der Arbeit auf der Probe, in seinem Opernhaus. Er liebte keine Vertraulichkeiten, sondern eben Haltung und Distanz über alles. Das ging so weit, daß er auf den Proben bis zuletzt seine Gattin per „Sie” und mit „Frau Ursuleac” anredete…
Krauss sagte einmal: „Fleiß ohne Talent ist nutzlos, Talent ohne Fleiß ist ärgerlich, beides zusammen erschafft den Künstler.” Er arbeitete bis zu seinem Tode mit eisernem Fleiß an sich. Er hat nach dem zweiten Weltkrieg, fast zwei Jahre unfreiwillig pausierend, viele Werke der Konzertliteratur auswendig erarbeitet und nachher auch seine Verehrer durch die Reife so mancher Interpretation noch überrascht. Als er 1953, mit sechzig Jahren, zum ersten Male im Bayreuther Festspielhaus dirigierte, das mit seinem verdeckten Orchesterraum eigene klangliche Probleme bot, sagte er einmal schmunzelnd, daß er eben dabei sei, „die letzten Hürden” seines Berufs zu nehmen…
Jeder Einbruch des „äußeren” Lebens in das Reich seiner Kunst störte ihn, denn er arbeitete am liebsten, wenn man ihn in Ruhe arbeiten ließ und die nötigen Geldmittel bewilligte, denn es ging ihm stets nur run die Qualität seiner Vorstellungen, nicht um Macht oder Einfluß an sich. Den Einbruch der Politik in die Bereiche der Kunst hat er mit ehrlichem Mißfallen, erlebt, aber er hat ein totalitäres Regime nicht offen bekämpft, weil es ihn arbeiten ließ und er als künstlerische Potenz so viel galt, daß er mißliebige und unerwünschte Künstler halten und vor dem Einrücken schützen konnte. Seine Feinde sagten nachher: so mächtig war er eben! Er hatte aber nur Charakter — und Zivilcourage. Auch den Wiener Staatsopemchor hat er vor dem Volkssturm gerettet. Einmal befragt, warum er nicht emigriert sei, antwortete Krauss in meiner Gegenwart ruhig: „Meine Kollegen, die Weggehen mußten, hätten sich bestimmt nicht gefreut, wenn ich auch noch gekommen wäre, um ihre Erwerbsmöglichkeiten durch meine Anwesenheit zu mindern!”… Ein „Pater, peccavi”, das die Welt so gern hört, selbst, wenn es nicht ganz aufrichtig wäre, hat Krauss nie gesprochen. Er hat die Haltung eingenommen, die für ihn die richtige war, und dafür so manches getragen: falsche Beschuldigungen, unwahre Behauptungen. Er ist auch von Wien 1934 nicht freiwillig weggegangen — das ist so oft aktenkundig fest- gestellt und von einem österreichischen Minister1 klargelegt worden, und trotzdem gehört es scheinbar zu seinem Schicksal über das Grab hinaus, daß diese böswillige „Legende” nicht auszusterben scheint. Freilich kann ich Krauss von der Schuld nicht ganz freisprechen, mit fast nachtwandlerischer Sicherheit oft gerade die Menschen geringschätzig behandelt zu haben, die mächtig und einflußreich waren, und ihm nicht nur schaden konnten, sondern es auch dann taten… Er machte keine Kotaus, keine Konzessionen, er ließ sich keine Protektionskinder aufzwingen, aber man muß leider auch feststellen, daß er dafür büßen mußte. Es ist noch heute so, daß in vielen Artikeln, statistischen Aufstellungen, kurz in vielen theatergeschichtHchen Arbeiten und Erinnerungen sein Name dort fehlt, vergessen oder verschwiegen wird, wo er schon um der historischen Wahrheit oder Gerechtigkeit willen erwähnt werden müßte. Ich glaube hier nicht an Zufälle!
Nein, er war kein Glückspilz, nicht im Leben, und noch im Tode bleibt sein Stern durch manche Mißgunst verdunkelt. Was er erreichte im Leben, und das war sehr viel, hat er durch seine Arbeit, sein Können erreicht. Er hat von der Pike auf gedient, war mit 19 Jahren Chordirigent in Brünn, war Kapellmeister, der alles dirigieren mußte, in Riga, Nürnberg und Stettin. Mit 28 Jahren war er Opemchef in Graz, ein Jahr später Kapellmeister an der Wiener Staatsoper und — jüngster — Professor an der Staatsakademie für Musik. In den folgenden Jahren sehen wir ihn als Intendant in Frankfurt am Main und Leiter der Museumsikonzerte dort, zugleich als ständigen Dirigenten der Wiener Tonkünstler. Es ist richtig, daß ihn Richard Strauss als Opemdirektor nach Wien empfohlen hat: weil Krauss so gut, nicht, weil er ihm sympathisch war. Es wurde ihm nichts geschenkt, durch keine politische Partei oder Bewegung ist er das geworden, was er wurde: der Max Reinhardt der Opembühne! Wie dieser lieble er es, aus dem Vollen zu wirtschaften, aber gerade an der Wiener Oper, seiner großen Liebe und künstlerischen Heimat, die er 1929 bis 1934 lenkte, erlebte er ab 1931 die schwerste finanzielle Krisensituation, die Land und Institut je trafen, er mußte Gagen kürzen und an allen Ecken und Enden sparen. Daß Berlin ihn nach dem Rücktritt Wilhelm Furt- wänglers holte, ist nicht nur begreiflich; traurig, daß Wien ihn nicht hielt, sondern geradezu zu diesem Schritt zwang. 1937 finden wir Krauss in München, wo er den größten Etat seines Lebens bekam: Krauss kaufte davon unter anderem seinem Orchester echte Stradivari-Geigen. Dann kam der Krieg, den er unbeirrt um künstlerische Vollendung auch als Mensch meisterte… Dieses Werk lebt in der Erinnerung seiner Künstler und Mitarbeiter, auch seines Publikums unauslöschlich weiter, die Dokumente aber sind mit dem alten Haus in Schutt und Asche gesunken, die Ausstattung von 62 (!) vollständigen Neuinszenierungen in sechseinhalb Jahren, davon vier Kriegsjahren, einschließlich der täglich zum Studium und für die Selbstkontrolle der Künstler auf Band aufgenommenen Vorstellungsmitschnitte! Unersetzliches ging verloren.
Clemens Krauss war gern allein, abgeschirmt von der lauten Außenwelt und unter Freunden, die er sich ausgesucht hatte. Hier war er ein anderer als in der Öffentlichkeit: humorvoll, rücksichtsvoll, zu Rat und Tat bereit, gütig und überlegen; nichts von seinem gefürchteten, zum Zynismus tendierenden Witz, die Schwächen des anderen durchschauend! Seine sogenannte Arroganz war ein Selbstschutz vor der Umwelt. Dabei wußte er sehr genau, wer er war. Aber er war auch überlegen und selbstkritisch genug, um mir einmal zu sagen: „Ich kenne meine Grenzen sehr genau, aber ich binde sie nicht jedem auf die Nase! Manche Stücke dirigiere ich nur, wenn man sie von mir verlangt, aber ich weiß, wenn mir etwas nicht liegt!” Wer so ehrlich mit sich selbst war, verlangte die gleiche Ehrlichkeit in der Arbeit auch von seinen Mitarbeitern. Künstlerische Untreue bat er nie verzeihen können. Ein Sänger, aus dem er alles gemacht und den er gegen die gesamte Presse durchgesetzt und weltberühmt gemacht hatte, verließ ihn auf einer Station seines Weges wegen ein paar tausend Mark jährlich, die ihm ein anderer Theaterleiter mehr zahlen konnte. Das war „Verrat” in den Augen von Krauss. Er ist ihm wie viele andere Enttäuschungen nicht erspart geblieben. Die letzten Monate seines Lebens waren überschattet von einer bewußt gelenkten, unsachlichen und verleumderischen Kampagne von Menschen, denen die Persönlichkeit Krauss’ zu groß war, und die verhindern mußten, daß er nochmals Wiener Operndirektor wurde. Er hat es als Herr getragen, er hat geschwiegen, aber vielleicht hätte sein plötzlicher Tod, fern der Heimat, nicht sein müssen…
Er hinterließ uns als Theaterleiter ein, wenn auch unvollendetes, großes Lebemswerk als Vorbild; eine Schar von Sängern und Instrumentalisten, Regisseuren und Bühnenbildnern, durch ihn erzogen und geformt; eine — leider nicht große — Reihe von Schallplatten, heute durch die rapide Entwicklung der Technik klanglich veraltet, denn Krauss hat die Langspielplatte gerade noch erlebt, die Stereophonie aber schon nicht mehr. Die Lebensfreundschaft mit Richard Strauss, entstanden aus werkgetreuen Interpretationen, führte zu dramaturgischen Anregungen und Bearbeitungen fertiger Bühnenwerke und gipfelte, fast könnte man sagen zwangsläufig, im Textbuch zum „Capriccio”. Aber ich könnte auch eine Abhandlung schreiben über die ungeschriebenen Werke von Clemens Krauss, zu denen er nicht mehr gekommen ist: ein „Lehrbuch des Dirigierens”, das er im Alter, wenn er endlich Zeit dazu hätte, schreiben wollte; seine „Erinnerungen an Richard Strauss”, sowie die „Briefe an Richard Strauss ins Jenseits”, die nicht so heiteren Inhalts gewesen wären, wie „Die gesammelten Ausreden eines Theaterdirektors”‘, um die es mir besonders leid ist… Sie hätten die Summe der Weisheit des Operndirektors in humorvoller Form enthalten!