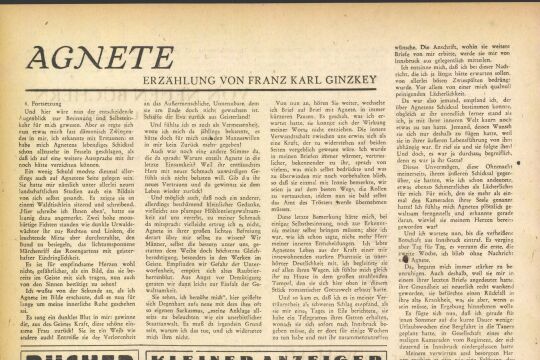EIN NEUERER UND SEIN „FAUST“
Persönliche Erinnerungen zum 100. Geburtstag Ferruccio Busonis am 1. April 1966
Persönliche Erinnerungen zum 100. Geburtstag Ferruccio Busonis am 1. April 1966
Diese Blätter sollen in der Tat nur persönliche Erinnerungen vermitteln; keine analytische Würdigung von Ferruccio Busonis Musik, die ja, stimuliert durch die hunderste Wiederkehr seines Geburtstages, endlich, endlich! in allen Ländern der westlichen Hemisphäre, auf Opernbühnen, in Konzertsälen, auf den Programmen überzeugter Musiker, nach viel zu langer Vernachlässigung und Nichtbeachtung, immer häufiger erscheint. Auch keinen Bericht über seinen so schmerzlich kurzen Lebenslauf will ich geben. Über all dies habe ich schon viel geschrieben; und wenn ich manches aus meinen zwei Büchern über seine Gestalt und den bedeutenden Einfluß, den sie auf seine Umgebung ausübte, hier wiederholen muß, so geschieht dies nicht etwa aus Nachlässigkeit, sondern aus der Überzeugung, daß ich das zu Sagende keineswegs mehr besser sagen könnte, als ich es damals tat. So, wie ich ihn vor Jahrzehnten sah, so sehe ich ihn noch heute, mehr als 40 Jahne nachdem er uns verlassen. Und ich kann nur wiederholen, was ich damals zum Schluß einer Veröffentlichung schrieb: „Ich suche zu sagen, was mir an Busonis Gestalt schön und merkwürdig erscheint und wert in einzelnen Zügen festgehalten zu werden, ehe die Jahre den frisch lebendigen Eindruck unmittelbaren Erlebnisses verblassen lassen.“ So viele Jahrzehnte später sind jene Eindrücke immer noch nicht im mindesten verblaßt…
Busonis Gestalt ist mir gegenwärtig wie je, als das wertvollste Erlebnis, welches meinem nunmehr so langen Dasein aufzunehmen beschieden war. Ferruccio Busoni, 40 Jahre nachdem er entschwunden, ist in mir, für mich, lebendig geblieben. Oft, wenn ich seine Bilder um mich herum ansehe, ist es mir, als wollte er zu sprechen beginnen, mit seiner wohllautenden Stimme, seiner Erregtheit über jedes Thema das zur Sprache kam, in seinem klassischen Goethe-Deutsch, aus welchem er zu jener Epoche nur selten in sein eigenstes, so wohllautendes Italienisch verfiel. Er konnte sich nachdenklich in irgendeinen Gegenstand vertiefen, der ihm wichtig schien, er konnte unangenehm ironisch werden oder auch heftig und streitbar, wenn ihn die Diskussion oder derjenige, der säe führte, langweilig, uninteressant oder unangenehm erschien. Den jungen Menschen, die sich in Berlin und Zürich allabendlich um seinen berühmten Abendtisch versammelten, waren seine plötzlichen Anfälle von lautem Gelächter, in welches er ausbrach, wenn ihm irgendeine Äußerung seiner Zuhörer komisch erschien, wohlbekannt.
Ich bin niemals Busonis Schülerin gewesen, obgleich ich später oft als solche betrachtet wurde. Was es in Musik zu lernen gab, habe ich alles, was den Regeln — in diesem Falle besser gesagt: was seinen Regeln — entsprach, in meiner Vaterstadt Budapest von Bėla Bartok gelernt: wie man eine Partitur liest; wie man eine schreibt, wie man sie ohne tonliche Wiedergabe beurteilt, wie man aus Eigenem schafft. Busonis freundschaftliche Teilnahme, das Interesse, das er meiner Arbeit entgegenbrachte, ist aber auch ohne eine einzige Unterrichtsstunde das entscheidende Erlebnis meiner Existenz geblieben. Einer Existenz — ich kann es nunmehr wohl sagen! —, die ohne jene Verbindung mit seiner Persönlichkeit, viel, viel ärmer geblieben wäre.
Das unverdiente Interesse, das er an meiner Arbeit nahm, wurde durch unser erstes Zusammentreffen dokumentiert. In meiner Vaterstadt lebte eine seiner früheren Klavierschülerinnen aus der Weimarer Zeit, die mir anbot, mich ihm anläßlich eines Konzertes, zu dem er kurz in jener Stadt weilte, vorzustellen. Recht aufgeregt über die Ehre, jenem bereits hochberühmten Musiker gegenüberstehen zu dürfen, erdreistete ich mich sogar, ihm eine meiner letzten Kompositionen „Orchestervariationen über ein Thema von Schumann“ zur Beurteilung vorzulegen. Der Brief, den er mir über dieses Zusammentreffen schrieb, steht noch in keinerlei Beziehung zu unserem fast ein Jahrzehnt später einsetzenden Briefwechsel. Der Brief, in dem der damals auf der Höhe seiner Virtuosenlaufbahn stehende, von tausenderlei Verpflichtungen in Anspruch genommene und überdies in die Komposition seiner „Brautwahl“ vertiefte Künstler, Zeit fand, um das Werk eines ratsuchenden jungen (noch dazu weiblichen!) Komponisten bis in alle Einzelheiten zu prüfen und mit so liebevoller Hingabe zu beurteilen, könnte als leuchtendes Beispiel für so viele andere stehen, deren Interesse an der zeitgenössischen Musik mit jenem, an ihren eigenen Werken erschöpft erscheint. „Arbeiten Sie nur fort und freudig“ — so heißt es in jenen Zeilen — „und lassen Sie die Blutwellen von und zum Herzen strömen in Ihren Werken.“ Dem Brief lag eine Partiturseite gleichsam als kritische Korrektur meiner Arbeit bei, auf der es heißt: „Ich entwerfe, zu meiner eigenen Übung, die Partiturskizze. Bitte es nicht .als Unbescheidenheit zu deuten, daß ich sie mitschicke.“
Als die kriegsbedingten Ereignisse das Leben in Deutschland recht unerfreulich zu gestalten begannen, beschloß ich, mir sozusagen „moralische“ Ferien zu gönnen, und übersiedelte für einige Sommermonate nach Weimar, wohin mich der von Busoni übernommene und von ihm ständig genährte Goethe-Kult stets gezogen hatte. Busoni selbst liebte Weimar; er hatte dort zweimal in den einstigen Räumen seines Abgottes Liszt, dem Tempelherrenhaus, Meisterkurse für besonders begabte Pianisten abgehalten und den Einfluß Goethes auf sein ganzes geistiges Sein allmächtig in sich zu spüren begonnen. Kurz vor meiner eigenen Übersiedlung hatte er auf einer seiner Amerikareisen den Text seiner Faust-Oper beendet, „Zur ersten Kriegsweihnacht schrieb ich wie im Fieber, in sechs Tagen, das Buch, bevor ich verließ, was hinter mir zusammenstürzte“ — heißt es in einem seiner Briefe an mich. Nun hatte der Gedanke seiner eigenen Version des Faust-Problems in den Räumen des Goethe-Hauses, an welches mich bald die freundschaftlichsten Beziehungen zu dessen Direktor, Dr. Hans Wahl, banden, intensiv von mir Besitz ergriffen, ich scheute keine Mühe und Überredungskunst, um meinen sonderbaren Plan verwirklichen zu dürfen. In der Tat wurde Busonis „Doktor Faust“ in dem Sacrosanctum, Goethes Arbeitszimmer, vor einem geladenen Publikum durch den hervorragenden Schauspieler Eduard Devrient zu unauslöschlicher Wirkung gebracht Mein Bericht an Busoniwurde mit gerührter Genugtuung auf genommen; in seinem nächsten Brief schrieb er mir:
„Was Sie für mich in Weimar getan haben (welche Beständigkeit es durchzuführen!) gehört zu den guten und schönen Dingen, zu den liebevollen Handlungen. Sie erwek- ken neu mein Vertrauen zu den Menschen! Und Herzensdank! — Heute kam Ihr recht ungeduldig erwarteter Bericht mit den beigefügten .Dokumenten' — Sie kennen meinen Aphorismus: Die Leute hören was sie glauben — glauben nicht, was sie hören. — Den beiden erlesenen Herren bin ich außerordentlich erkenntlich und verpflichtet; ich werde mir erlauben, denselben dieses schriftlich zu bekunden.“
Wenn ich auf noch ein späteres, mit jener selben Dichtung verbundenes Erlebnis zurückgreifen soll, so ist es das Gedenken an einen Abend im Zürcher Exil, an welchem Busoni selbst die ganze Faust-Dichtung vorlas; einem Kreis von Schülern und Anhängern, die ihm auch in jenen verworrenen Kriegszeiten folgte, soweit ihnen solches politisch und finanziell möglich war. Wir versammelten uns abends regelmäßig in der Scheuchzerstraße, allwo auf Nr. 36 seither eine Gedenktafel daran erinnert, wer dort einst allabendlich geistig-musikalisch (obwohl hauptsächlich menschlich!) Hof hielt. Um seinen bereits berühmten runden Tisch saßen in den Jahren knapp vor Ende des ersten Weltkrieges Franzosen, Engländer und Deutsche einträchtig beisammen, und es war wohl der einzige Ort der damaligen Welt, wo laut strenger Anweisung Busonis, das Wort Krieg nicht ausgesprochen oder auch nur berührt werden durfte. Die Magie dieses Menschen war so stark, daß sich ihr keiner seiner Zuhörer entziehen konnte; jene Jünglinge lebten, dachten, arbeiteten nur mit Beziehung auf ihr Idol, dessen Einfluß so übermächtig war, daß sie alle mit der Zeit, nach und nach, Züge seiner Handschrift in ihre eigene aufnahmen. An solchen Handschriften konnte ich noch viele Jahre später feststellen, daß der Schreiber in Busonis Bann gestanden hatte; meine Eigene trägt noch deutlich die Spuren jener Zugehörigkeit. Leider ist sie die einzige ihrer Art geblieben; jene Teilnehmer sind alle, alle dahingegangen, die Freunde, die Schüler, Egon Petri, Eduard Steuermann, Michael von Zadora, Leo Kestenberg.
Es sind kaum mehr welche da, die gleich mir von einem einzigartigen Zürcher Faust-Abend erzählen könnten. — Zu jener Vorlesung hatte eine mit Busoni befreundete Dame mit Busonis Einverständnis in ihr Heim geladen; sie selbst konnte sich, gleich ihren Gästen, dem geradezu visionären Eindruck des Vortrages nicht entziehen. Nachdem wir uns nach einigen verlegenen Dankesworten über die winterliche Straße auf den Heimweg wagten, schien es uns, als ginge uns der Meister selbst zögernden Schrittes in den Schnee voran und als müßte hinter jenen Schritten Unvergängliches aufblühen, um nie wieder zu verwelken. Und,manch einer fühlte sich als ein neuer Eckermann, der durch die Dunkelheit, voll von Worten und Gedanken eines Abgottes, dankbar nach Hause zog.
Busoni liebte die Jugend und fühlte sich bis zum letzten Atemzug zu ihr gehörig. Als er mit Kriegsende wieder beglückt in seine Berliner Wohnung zurückkehrte, erreichte ihn dort die Berufung, eine Meisterklasse für Komposition an der Akademie der Künste zu übernehmen; nun wurde er auch offiziell als die höchste Instanz seines Faches in Deutschland anerkannt. Allerdings erhoben sich so manche warnende Stimmen gegen diese Betrauung: Es hieß, eben sein faszinierender Einfluß würde bewirken, daß seine Schule keine ihr Innerstes behorchenden Tonkünstler erziehen werde, sondern bloß Nachahmer oder Karikaturen von ihres Meisters einmaligem, unnachahmlichem Ich. Jedes nicht ganz starke Talent müßte von der wirbelnden Dialektik, der fanatisch rücksichtslosen Überzeugung gestört werden, kein pflegebedürftiger Keim würde unter solcher Leitung zu Blüte, kein schwaches geistiges Rückgrat zur Kräftigung, kein Eigenleben zur Besinnung auf sich selbst kommen. Nun, es mag sich von solchen Einwänden manches bewahrheitet haben. Doch an den Hochschulkursen selbst herrschte einmütige Begeisterung, neue Schüler' meldeten sich zu den Alten, eines Tages hieß es, die jungen Österreicher Weill und Krenek hätten bei Busoni vorgesprochen, um seines Unterrichtes teilhaftig werden zu können. Und Busoni, der sich als Fünfziger jung fühlte, wußte, daß der Kontakt ihn selbst jung erhielt; er schien sich selbst berufen, an der Spitze einer neuen Musikergeneration ihr Leiter und Führer zu sein.
„Die der Jugend vorangehen“ — sagte er — „sollen sich fühlen als der Erdboden, der den neuen Samen willenlos aufnimmt und in reifer Kraft überraschende Pflanzengebilde hervorbringt.“
Er freute sich seiner wiedergewonnenen Bibliothek, wollte selbst immer noch lernen, phantasierte von Drittel- und Vierteltonsystemen, von seiner Sehnsucht nach einer neuen, im Verhältnis zur damals anerkannten und gebräuchlichen, unendlich erweiterten Harmonie. Eine Reihe von begeistert begrüßten Konzerten seiner Werke, die er selbst dirigierte, oder wenn er sich gelegentlich auch am Klavier zeigte, bedeutete ihm eine große Freude. Er dachte sogar an ein neues Repertoire, mit dem er sein früheres auf frischen konnte; doch blieb sein Abgott Mozart. Immer wieder kehrte er zu ihm, „dessen verklärtes Lächeln uns durch die Jahrhunderte strahlend ansieht“, zurück. Und die wieder auf genommenen abendlichen Zusammenkünfte, an denen er seine jugendlichen Hörer stets ermahnte „Lernen, immer nur lernen! Immer nur arbeiten, immer üben, immer denken, damit die in euch lebende Idee die selbsterschaffene Form findet, sobald sie aus unbewußten Tiefen ans Licht tritt!“, bereiteten ihm unveränderte Genugtuung. Aber das physische Leiden unterhöhlte stets mehr seinen durch unrationelle Lebensweise und Nachlässigkeit im Befolgen ärztlicher Ratschläge geschwächten Körper, und die Sorge, ob es ihm wohl vergönnt sein würde, den „Faust“ zu vollenden, zehrte dauern an ihm. Der Fortschritt an dieser seiner größten Arbeit war ihm zu langsam, er ahnte, das er ihre Vollendung nicht mehr erleben sollte.
Ich sah Busoni zum letztenmal im Herbst 1923, als ich Berlin verließ, um nach Italien zu übersiedeln; sah ihn — ahnungslos, daß es für mich wirklich das letztemal sein sollte. Ich fand ihn erschöpft und kraftlos, dauerndes Leiden und übermäßige Arbeit hatten tiefe Schatten über seine früh gealterten Züge geworfen. An jenem trüben, nebeligen Novembemachmittag schien das verarmte, unruhige, sich in den letzten Krämpfen der Inflation windende Berlin auch für ihn nicht mehr jene einzige Zufluchtsstätte darzustellen, nach der er sich in den Jahren des Schweizer Exils so heftig gesehnt hatte. Er sagte — und nie wie in jenen letzten Worten, die ich von ihm hörte, war es mir so gewärtig geworden, daß dieser Mensch, allem Anschein zum Trotz, doch zu innerst Italiener geblieben war: „Wenn Sie in Florenz ein hübsches Haus für mich finden — so etwas außerhalb der Stadt, etwa in Settignano — mit einem großen Bibliothekszimmer, aus dem man direkt in einen schattigen Garten kann — er muß aber wirklich schattig sein! —, dann schreiben Sie es mir. Vielleicht komme ich doch noch nach Italien — wenn der „Faust“ vollendet ist..
„Doktor Faust“ wurde nie vollendet, Busoni hat nie nach Italien heimgefunden. Im August 1924 traf mich die Nachricht von seinem Tode. Es ist schon lange her — doch ich habe den Schlag jener nicht unerwarteten Nachricht niemals vergessen. So oft sie mir im Gedächtnis wieder auftaucht, muß ich an die schönen Worte denken, mit denen Jakob Wassermann seine wunderbare Schrift „In memoriam Ferruccio Busoni“ einleitet: „Es ist zunächst nicht verständlich, daß dieser einzige Mensch nicht mehr lebt; es ist nicht ohne weiteres glaubhaft — auch abgesehen vom Gefühl des Verlustes …“ Und so oft ich aus meinem eigenen Bibliothekszimmer in meinen schattigen Garten hinaustrete, muß ich an Busoni denken. — „So hätte sich Busoni seine Heimkehr nach Italien vorgestellt…“ In mir lebt er und wird weiterleben, bis ich selbst ihm in die andere Welt folge…