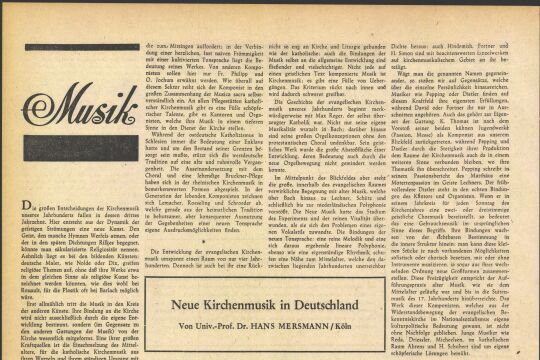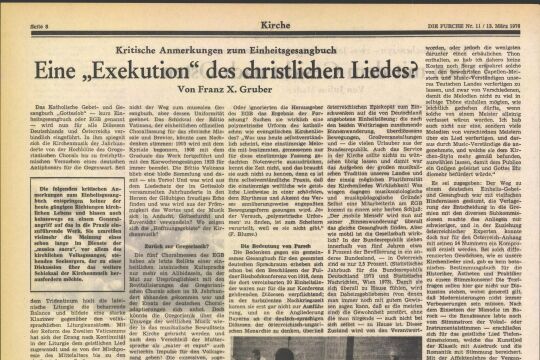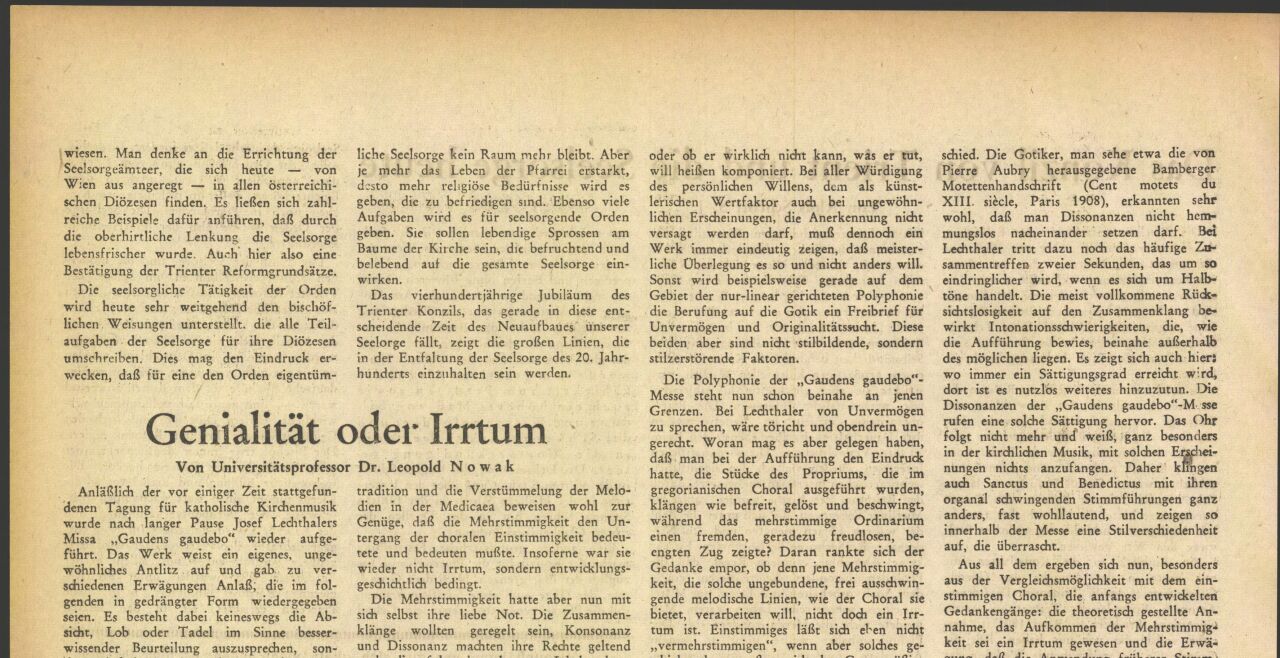
Anläßlich der vor einiger Zeit stattgefundenen Tagung für katholische Kirchenmusik wurde nach langer Pause Josef Lechthalers Missa „Gaudens gaudebo“ wieder aufgeführt. Das Werk weist ein eigenes, ungewöhnliches Antlitz auf und gab zu verschiedenen Erwägungen Anlaß; die im folgenden in gedrängter Form wiedergegeben seien. Es besteht dabei keineswegs die Absicht, Lob oder Tadel im Sinne besserwissender Beurteilung auszusprechen, sondern einfach den Versuch zu machen, eine Wesenheit zu erfassen. Die Forderung nach dem Begreifen von Kunstwerk und Künstler steht dabei obenan. Sie gilt ebenso für die Musik der Gegenwart wie für die der Vergangenheit. Da Lechthalers Messe eine sehr eigenwillige Polyphonie zu erkennen gibt, wird sie zu einem Merkpunkt in der gegenwärtigen Kunst der Mehrstimmigkeit. Die daran geknüpften Gedankengänge holen daher etwas weiter aus.
Das Mittelalter übernimmt unter manch anderem als kostbarstes Erbe seiner Vorzeit den gregorianischen Choral. Die einstimmig gesungene Melodie hat darin ein Meisterwerk ohnegleichen geschaffen. Schwerelos, ungehindert, schwingen sich Melodiebogen durch den Raum, die Tiefsinnigkeit liturgischer Texte so in das Gewand melodischer Intensität hüllend. Das geschieht aber nicht hemmungslos, sondern wohlgeordnet in wunderbarstem Ebenmaß. Durch Gliederuhg bis in kleinste Teile hinein wird ein „logisches Gleichgewicht“ innerhalb der Gesänge erreicht, das man geradezu als musikgewordene „ratio“ bezeichnen muß.
Die Wende in das zweite Jahrtausend bringt auch einen Umschwung in der Musik, vielleicht den schicksalsschwersten, der je sich in der abendländischen Entwicklung ereignete: die Mehrstimmigkeit. Was er bedeute, das können wir heute nur verstandesmäßig erfassen, aber nicht mehr fühlen. Man kann sich vorstellen, direkte Zeugnisse gibt es nicht, daß dieser Umschwung heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen den Anhängern des Chorals und den Vertretern der neuen Kunst zur Folge hatte, denn: vorerst bedeutete diese neue Richtung doch nur eine vollkommen unkünstlerische Fessel für den melodischen Schwung des Chorals. Die Tonfolgen wurden in die Breite gezogen, zerdehnt, ja schließlich von der französischen Motette des 13. Jahrhunderts in schematisch angeordnete Rhythmen, die Modi, gepreßt und so ihres eigentlichen Charakters vollständig entkleidet. Nicht genug damit, das aus einem Choralgesang herausgerissene kleine Stück bekam eine zweite, eine dritte Stimme übergesetzt, die, vollkommen verschieden geartet in Charakter und Stimmung, in eigenem, scharf aus-einandergehaltcnen melodischen Fluß dahin-singen.
Es ist eine Vergewaltigung des Chorals, die man, das sei mit aller wissenschaftlichen Vorsicht ausgesprochen, vom Choral her gesehen, geradezu als einen künstlerischen Irrtum bezeichnen muß; einen Irrtum, der darin bestand, daß man glaubte, Melodien, die, weil sie nichts neben sich zu dulden hatten, ausschwingend gebaut waren, mit anderen Stimmen gleicher Art verbinden zu können. Allerdings muß man auch, von der anderen Seite betrachtet, mit gleichem Recht ven einer genialen Leistung sprechen. Je:i=r Leistung nämlich, die; gotischem Konstruktionswillen entsprungen, kühnen Wölbungen gotischer Kathedralen gleich, Stimme Üb;r Stimme türmte und so in vollkommen neuartigem Geist das überkommene Kunst-we-k des einstimmigen Chorals gleichsam in Ketten untergehen iieß. Daß dieser Choral dabei die Ehre hatte, Fundament und später Camus firmus zu werden, ist eine andere Saihe. Das Erlöschen der guten Choraltradition und die Verstümmelung der Melodien in der Medicaea beweisen wohl zur Genüge, daß die Mehrstimmigkeit den Untergang der Chorälen Einstimmigkeit bedeutete und bedeuten mußte. Insoferne war sie wieder nicht Irrtum, sondern entwicklungsgeschichtlich bedingt.
Die Mehrstimmigkeit hatte aber nun mit sich selbst ihre liebe Not. Die Zusammenklänge wollten geregelt sein, Konsonanz und Dissonanz machten ihre Rechte geltend und die folgenden langen Jahrhunderte müssen sich mühen, das Miteinander der Stimmen in richtige Bahnen zu lenken. Es ist ein dornenvoller Weg, der von den ersten mehrstimmigen Kunstwerken des 12. Jahrhunderts über alle Formen und Stile bis zu Palestrina und Lasso führt. Aber damit war nach den Höhepunkten in Burgund und den Niederlanden die Fertigkeit erworben worden, mehrere Stimmen reibungslos im Auf und Ab von Konsonanz und Dissonanz zu künstlerisch wohlgebildeter Einheit zu verbinden.
Was dem Choral gegenüber als Irrtum erscheinen mußte, das hatte sich als eigenständiger, vollkommen neuer Kunststil erwiesen, der fähig war, die feinsten Stimmungen auf wesentlich andere Art wiederzugeben als der einstimmige Choral. Die Mehrstimmigkeit wurde daher auch die Kunst des Abendlandes.
Die einzelnen Entwicklungsphasen lassen nun deutlich erkennen, wie die Behandlung, genauer gesagt, Bewältigung der Dissonanz zum Kriterium der Satzbeherrschung wird. Man sieht es bestimmten Kompositionen an, wie sich in ihnen manchmal die einzelnen Stimmen noch aneinander reiben, wie oft gebrauchte Melodiefloskeln sich stoßen und so merkwürdige Zusammenklänge, Durchgänge und ähnliches entstehen. Der oberflächliche Beurteiler ist hier leicht geneigt von Primitivität und Unvermögen zu sprechen, wo doch nur das Bemühen vorliegt, in der Bewältigung der Drei- oder Vierstimmigkeit einen Schritt weiter zu kommen. Abgesehen davon hat jede Epoche ihre eigentümlichen Stilmerkmale, die in der Musik genau so wie in anderen Kunstgebieten respektiert sein wollen.. An solchen Stellen liegt nicht Primitivität, sondern Genialität vor, sofern es sich nicht um aus-gesprodiene Ungeschicklichkeiten schwächerer Talente handelt. Kühne Vorstöße in unbekanntes Neuland sind es, die, wenn sie echt sind, durch die folgenden Dezennien als richtig erwiesen werden. Dabei fallen die Schlad-ten der Ungeschicklichkeit ab, das Kunstwerk steht in Stilreinheit vor uns.
Erinnern wir uns noch kurz daran, daß mit Badi und Reger die Polyphonie in die Kunst der Akkorde eingebettet wird, zu Regers Zeit aber mit der Wiedererweckung des Chorals der Sinn für absolute Linearität wieder erwacht. Zusammen mit Wurzeln, die aus musikalischen Stilrichtungen um 1900 entspringen, bewirkt dieses lineare Bewußtsein wieder eine mehrstimmige Schreibart, die manche Eigenheiten früherer Zeiten an sich hat. Dadurch wird es jetzt gelegentlich sehr schwer zu entscheiden, ob der Komponist nur so tut als ob er nicht könnte,oder ob er wirklich nicht kann, was er tut, will heißen komponiert. Bei aller Würdigung des persönlichen Willens, dem als künstlerischen Wertfaktor auch bei ungewöhnlichen Erscheinungen, die Anerkennung nicht versagt werden darf, muß dennoch ein Werk immer eindeutig zeigen, daß meisterliche Überlegung es so und nicht anders will. Sonst wird beispielsweise gerade auf dem Gebiet der nur-linear gerichteten Polyphonie die Berufung auf die Gotik ein Freibrief für Unvermögen und Originalitätssucht. Diese beiden aber sind nicht stilbildende, sondern stilzerstörende Faktoren.
Die Polyphonie der „Gaudens gaudebo“-Messe steht nun schon beinahe an jenen Grenzen. Bei Lechthaler von Unvermögen zu sprechen, wäre töricht und obendrein ungerecht. Woran mag es aber gelegen haben, daß man bei der Aufführung den Eindruck hatte, die Stücke des Propriums, die im gregorianischen Choral ausgeführt wurden, klängen wie befreit, gelöst und beschwingt, während das mehrstimmige Ordinarium einen fremden, geradezu freudlosen, beengten Zug zeigte? Daran rankte sich der Gedanke empor, ob denn jene Mehrstimmigkeit, die solche ungebundene, frei ausschwingende melodische Linien, wie der Choral sie bietet, verarbeiten will, nicht doch ein Irrtum ist. Einstimmiges läßt sich eben nicht „vermehrstimmigen“, wenn aber solches geschieht, dann muß es sich den Gesetzmäßigkeiten der Polyphonie fügen, die selbstverständlich sehr weit gefaßt sein können. Die Messe will absolute Linearität die Stimmen sollen „den Gesetzen schöner Deklamation und Melodiegestaltung folgend“ vortragen und „besonders jede aufdringliche Betonung des Taktmäßigen“ vermeiden. Was nun im Notenbild vor allem in der Verarbeitung der Choralmotive von anziehendem Interesse ist, das wird in der klingenden Wiedergabe zu oft fremdartigem Beisammensein. Das Mittelalter wußte für seine Stimmführung, daß auf gutem Taktteil eine vollkommene Konsonanz stehen müsse, das ist in der modernen Kunst, so auch bei Lechthaler, nicht immer der Fall, darin liegt schon ein wesentlicher Unter. Die Gotiker, man sehe etwa die von Pierre Aubry herausgegebene Bamberger Motettenhandschrift (Cent motets du XIII. siecle, Paris 1908), erkannten sehr wohl, daß man Dissonanzen nicht hemmungslos nacheinander setzen darf. Bei Lechthaler tritt dazu noch das häufige Zih sammentreffen zweier Sekunden, das um so eindringlicher wird, wenn es sich um Halbtöne handelt. Die meist vollkommene Rücksichtslosigkeit auf den Zusammenklang bewirkt Intonationsschwierigkeiten, die, wie die Aufführung bewies, beinahe außerhalb des möglichen liegen. Es zeigt sich auch hier: wo immer ein Sättigungsgrad erreicht w:rd, dort ist es nutzlös weiteres hinzuzutun. Die Dissonanzen der „Gaudens gaudebo“-M sse rufen eine solche Sättigung hervor. Das Ohr folgt nicht mehr und weiß, ganz besonders in der kirchlichen Musik, mit solchen Erscheinungen nichts anzufangen. Daher klingen auch Sanctus und Benedictus mit ihren organal schwingenden Stimmführungen ganz anders, fast wohllautend, und zeigen so innerhalb der Messe eine Stilverschiedenheit auf, die überrascht.
Aus all dem ergeben sich nun, besonders aus der Vergleichsmöglichkeit mit dem einstimmigen Choral, die anfangs entwickelten Gedankengänge: die theoretisch gestellte Annahme, das Aufkommen der Mehrstimmig* keit sei ein Irrtum gewesen und die Erwägung, daß die Anwendung früherer Stimm'' führungsprinzipien in Kompositionen der Gegenwart leicht zu falschen Urteilen führt. Dies ganz besonders dann, wenn es sich um noch nicht voll ausgereifte Künstlerperfön-lichkeiten handelt. Die Annahme des Irrtums wird durch die weitere tatsächliche Entwicklung der Mehrstimmigkeit hinfällig, di% Problematik moderner Polyphonie aber erhärtet.
Im 13. Jahrhundert war das Zusammenfügen linearer Elemente eine entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit, die daraus sich ergebenden Härten des musikalischen Satzes eine Erscheinung, an deren Klärung jahrhundertelang gearbeitet wurde. Das 20. Jahrhundert hat aber aus seinen Vorgängern schon gelernt, wie man dieser Zufälligkeiten Herr wird. Das soll nun keine beckmesserische Engstirnigkeit beinhalten, die nur das „gute Alte“ gelten lassen will. Wo Härten im musikalischen Satz auch heute noch stehen, dort sollen sie stehen, wenn sie gerechtfertigt sind. Sie können aber nicht verhindern, daß der Hörer fragt, ob dem so 'recht sei, und nun beginnt, Vergleiche anzustellen. Ganz besonders die Kirchenmusik ist bei aller Aufgeschlossenheit kein Experimentierboden, trotzdem man auch problematischen Werken, und zu ihnen gcli'Jrt die „Gaudens gaudebo“-Messe Lechtha'ers, Daseinsberechtigung nicht absprechen darf. Oft ist es notwendig, daß ein Werk den Mut hat, Ungewohntes zu sagen. Mut aber ist eine seltene Sache, daher liegt auch darin ein Verdienst, das anerkannt werden muß.