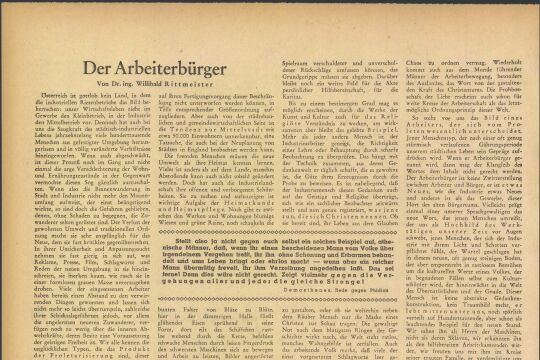Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Krise der Kritik
Die Klage über den Niedergang der Kunstkritik nimmt offenbar nur einen- Teil des allgemeinen Mißstandes wahr, den eine Zeitenwende größter Einstürze und Umschichtungen auch im musischen Bereich entstehen ließ. Schon rein soziologisch fehlt uns heute jegliche Voraussetzung auch für das Werden eines künstlerischen Stils, dessen Gesinnung alle Bezirke des werkenden Leibes und der feiernden Seele formen würde; eines Stils von so universaler Stimmungsund Bestimmungsmacht, wie er zum Beispiel der Barockzeit das Gepräge gab. Wir ver- - stehen einander nicht mehr; und der Mangel eines ästhetischen Generalnenners mag zugleich Folge wie auch wieder Urgrund jener hoffnungslosen Sprachverwirrung sein, in der nun Mensch an Mensch, ja Volk an Volk vorbeiredet.
Es kommt dazu, daß die kulturtragenden Schichten nicht nur diesen inneren Zusammenhalt einbüßten, sondern (wie in dieser Phase der Entwicklung stets) auch jenen äußern Wohlstand, ohne den sich schöpferische Leistung weder hoch noch breit entwickeln kann. Und mag die aktuelle Geldverknappung hierzulande auch begrüßt werden als erster Schritt zum wirtschaftlichen Wiederaufstieg, löste sie doch auf dem Markt der Kunst erst voll die Krise aus, die in vitioser Wechselwirkung ebenso „Verbraucher” wie „Erzeuger” trifft.
In dieser Lage nun, die in sich kaum mehr füllenden Theatern, in sich kaum mehr leerenden Verkaufspulten des Sortiments Kennzeichen nicht der Übersättigung des Geistes, sondern der materiellen Not in allgemeiner Wirrnis und Verwilderung liefert, muß überlegt werden, ob denn gerade doch der Kritiker sein Amt aus aller Fülle einstigen Sachwissens, aus feinnervigem Gefühl für Maß und Form ausüben könnte. In sich überschneidenden Kraftfeldern ist von einem Kompaß nicht wohl zu erwarten, daß er ohne Schwanken Richtung weise. Und gesetzt auch, daß er selbst taugliches Instrument geblieben wäre: soll der Kritikeres unternehmen, mit subtiler Sonde die Abgründe einer Weltkatastrophe auszuloten? An deren Rand beckmessernd vor Niveauverlust zu warnen? Haare zu spalten statt Rettungsseile auszuwerfen? Sich mit einem Wort so wie vor 50 Jahren zu gebärden? Stünde uns auch noch der überzüchtete Geschmack von damals zu Gebote, wir haben es nicht mehr nötig, künstlich ein Fin de siede zu beschwören. Wir stehen leibhaftig in seinem Inferno. Wohin kämen wir, Bettler, mit wählerischem Gaumen? Nicht, daß trotziger Proletenstolz uns überwältigte; im Gegenteil ertappen wir uns immer wieder bei wehmütiger Erinnerung an all die kulinarische Kultur des Geistes — noch der eigenen, entrückten Jugend oder schon der Väter. Aber wir verkennen doch nicht, dürfen nicht verkennen, daß wir unentrinnbar unserem Schicksal verhaftet sind, mit dessen Schatten in der Abendröte eines reichen Tages vorerst nur getändelt worden war. Aus den Ruinen einer untergehenden Epoche höben wir nicht mehr das alte Leben; wir müssen daraus dem kommenden zum Aufbruch helfen. Also ist da erst einmal Schutt zu beseitigen und, was von alten Fundamenten tragfähig geblieben scheint, darauf zu untersuchen, ob es für die Planungen des Wiederaufbaus von Bedeutung wäre. Einzig darüber besteht schon Einverständnis: diese einmalige Chance darf nicht durch Pfusch oder durch Eigenbrötelei verdorben werden.
Wessen Chance aber, wessen Berufung wäre es wie die des Kritikers, in diese Aufgabe als Denker und als Lenker einzutreten, wenn ob ihrer groben Größe erst auch nur mit primitiven Mitteln? Einzig diese sind am Platz, wo wirklich ganz neu angefangen wird. Arbeitsbedingungen und Aufgabe des Kritikers in dieser Zeit verstünde falsch, wer ihn als Epigonen größeren Bewandcrt- und Gewitztseins minder achtete — oder am Ende gar verdächtigte, noch in der meinungslosen „Kunstbetrachtung” des vergangenen Jahrzehnts zu stecken. Es spricht für ihn, wenn er jetzt nicht wieder grundsätzlich die eigene Person gegen das sachliche Anliegen seines Opfers wichtig macht, wenn er „besprechend” eher kommentiert als kritisiert. Kommt es nach langer Unterbrechung auch im Austausch geistiger Produkte nicht vor allem darauf an, erst überhaupt wieder den Hunger nach dem Rohstoff zu befriedigen, erst damit überhaupt wieder Verbindungswege herzustellen, ehe sich auf diesen dann die Diskussion allmählich auch verfeinern mag zu Fragen des Metiers, der Mache?
Diesem Heißhunger, sich in der neu geschenkten Welt des Geistes doch erst wieder zu orientieren, wuchs nach Kriegsende ein periodisches Schrifttum entgegen, dessen immer noch bei weitem nicht erfüllte Aufgabe es nicht verhindern konnte, daß Normalisierungstendenzen in der Wirtschaft eine offenkundige Überentfaltung seines Angebotes auf, ja unter das gesunde Maß herabschnitt. Doch vermag am Ende die erzwungene Konzentration fortan gerade dieser Aufgabe wirksamer zu entsprechen: in jeder Sparte — der Welt- und der Kulturpolitik, der Philosophie und der Naturwissenschaften wie vor allem natürlich der theoretischen, der praktischen Ästhetik — vorerst nur sachliche Berichte zu liefern, in denen die Kritik sich tunlichst auf den weltanschaulichen Standort und die von ihm bestimmte Gesamtperspektive beschränkt. Diesem Bedürfnis genügten freilich nicht sporadische Exzerpte, es verlangt nach einer Überschau, wie sie sich der einzelne unmöglich aus erster Hand verschaffen könnte; abgesehen davon, daß ihm heute immer noch sehr wesentliche Periodica nicht erreichbar wären, stünde der auf ihn beschränkte Nutzen nie für den erforderlichen Aufwand. Übrigens liegt auch in „unkritischen” Referaten, ja sogar in wortgetreuen Auszügen („Reader’s Digest”), in diesem Sichten und Akzentuieren sehr entscheidende Kritik. Es ist eine alte Erfahrung, daß das gute Buch durch unaufdringliche Hinweise ebenso gefördert wird wie andererseits das schlechte durch Verbot oder Entrüstung. Dies zumal auch angesichts der Schrumpfung, der unser Verlagswesen gerade unterworfen ist: sie wird auch ohne aktive Zensurmaßnahmen dem wertvollen Teil der Produktion zugute kommen, wenn nur für verantwortliche Aufklärung des Publikums gesorgt wird, das längst wählerisch sich nach der Decke streckt.
Natürlich wird mit der „Abfuhr” von Schutt wie mit der „Förderung” brauchbaren Baustoffs bloße Vorarbeit geleistet; aber um so wichtigere Vorarbeit, als sich dabei der Kritiker zugleich charakteristisch auf jene spätere Etappe zuschult, die von ihm wieder das eigenprofilierte Urteil fordern wird, es ihm wieder erlauben darf. Die Zeit dazu ist noch nicht wieder gekommen. Nur zersplittert, überspitzt hat sich der Totalitarismus unter dem Druck seines uniformen Staatsstils. Wieder einmal triumphiert das, was die Opposition siegreich bekämpfte, in ihr selbst. Und so tief wurzelt der Diktator nun in seinen Überwindern, daß denn auch der Kritiker der mächtigen Versuchung ausgesetzt ist, seinerseits ex cathedra das zu verurteilen, was ihm nicht zu Gesicht steht. Nimmer machte ihn Unduldsamkeit zum Wegbereiter jenes andern „Einheitsstils”, der uns von unten her tragend entgegenwächst, statt uns von oben nur bedrückend kleinzuhaltcn. Wir beseitigen die Tyrannei nicht, wenn wir selbst uns weigerten, den Gegner ernst zu nehmen, ihm das Wort zu gönnen und ihm zuzuhören — also in seinem eigenen Blickkreis gerecht zu werden.
Somit aber verwandelt sich voran auch für den Kritiker die Not sogar zur Tugend. Augenblicklich, in einem Zustand konfuser Wegsuche, gelänge es ihm ohnedies schlecht, selbstgefällig zu brillieren. Aufgeschlossene Hingabe an die fremde Leistung aber wird ihn auch recht eigentlich sich selber finden lassen; ihn, durchaus nicht gleichgeschaltet, erst zu seiner Aufgabe befähigen. Beweist uns nicht in einem Beispiel die Wiener Theaterkritik, die sich heute bei jedem Anlaß in den groteskesten Widersprüchen selbst aufhebt, daß schöpferische Vielfalt im Tiefsten doch einem Gemeinsamen entspringen müßte? Um die Beugung unter seine Verpflichtung kommen wir nicht herum. Der Stil des Totalitarismus (im Künstlerischen sowie im Politischen) unterscheidet sich vom Universalismus der Demokratie nur dadurch, daß seine Souveränitätsbeschränkungen erzwungen, anstatt frei und freudig angeboten werden. Und es ist nur ein Beweis mehr für die komplexe Problematik unserer Gesamtsituation, daß denn die Krise der Kritik sich nur als ein Symptom jener Entwicklung zu erkennen gibt, die allenthalben einen Ausgleich zwischen Herdentrieb und Einzelgängertum erstrebt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!