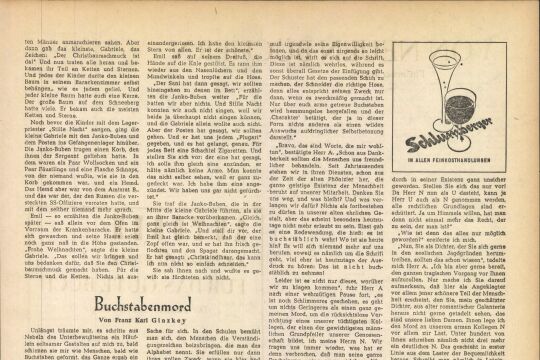Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Plagiat und Originalität
Mit unverkennbarer Vorliebe spürt ein Großteil des Publikums scheinbaren und wirklichen Entlehnungen eines Autors — sei es auf musikalischem oder literarischem Gebiete — nach; jener Großteil nämlich, der zu blasiert ist, um unvoreingenommener Hingabe fähig zu sein — zu wenig kenntnisreich und selbstsicher, um urteilen zu können. Und aus diesem Minderwertigkeitsgefühl erwächst die diabolische Lust, den Schaffenden einer ‘Schwarz auf weiß nachweisbaren Schwäche zu überführen, ihm zu beweisen, daß er keinen Anspruch auf höhere Wertung seiner Persönlichkeit besitze. Und gar in der Welt der Kunst, in der es so schwer ist, Soll und Haben säuberlich zu fixieren, tut es ihnen doppelt wohl, einmal dokumentarisch einen Rechenfehler festzustellen, mehr noch: eine betrügerische Absicht. Der Autor hat „ab- geschrieben”, hat versucht, sich mit fremden Federn zu schmücken.
Und doch, wie schwierig ist auch das Problem des Plagiats, wie völlig unzugänglich jeder rechnerischen Überprüfung. So unantastbar uns der Begriff des geistigen Eigentums sein muß, seit wir in einer individualisierten Welt leben: die Kriterien des „Tatbestandes” entziehen sich jeder Weisheit des Kontokorrents. Man mißverstehe uns nicht: es gibt Plagiate, e gibt geistigen Diebstahl und oft nehmen jene Neunmalklugen gar nicht Anstoß daran. Wo sie aber schmunzelnd meinen: jetzt haben wir ihn erwischt, den stolzen Himmelstürmer, da kommt ihr schulmeisterndes Besserwissen oft zu kurz.
Das Kriterium des geistigen Diebstahls liegt nämlich — was manchen seltsam dünken mag — keineswegs in der wörtlichen oder norengetreuen Übereinstimmung. Mit der befehlsgewohnten Selbstverständlichkeit eines Königs nahm Goethe auf ähnliche Vorwürfe Byrons dem „Faust” gegenüber Bezug, als er zu Eckermann sagte: „Was da ist, das ist mein… und ob ich es aus dem Leben oder aus dem Buch genommen, das ist gleichviel, es kam bloß darauf an, daß ich es recht gebrauchte! Walter Scott benutzte eine Szene meines jEgmont’, und er hatte ein Recht dazu, und weil es mit Verstand geschah, so ist er zu loben… Lord Byrons .Verwandelter Teufel’ ist n fortgesetzter Mephistopheles und das ist recht. Hätte er aus origineller Grille ausweichen wollen, er hätte es schlechter machen müssen. So singt mein Mephistopheles ein Lied von Shakespeare, und warum sollte er das nicht? Warum sollte ich mir die Mühe geben, ein eigenes zu erfinden, wenn das von Shakespeare eben recht war und eben das sagte, was es sollte? Hat daher auch die Exposition meines .Faust mit der des ,Hiob’ einige. Ähnlichkeit, so ist das’wiederum ganz recht, und ich bin deswegen eher zu loben, als zu tadeln.” (1. Buch, 18. Jänner 1825.)
Der Name Goethe allein entscheidet nicht. Aber mit der unvergleichlichen, hausväterlich einfachen und klaren Weisheit, die besonders seine Gespräche mit Eckermann auszeichnet, hat er das Entscheidende gesagt.. Darauf nämlich kommt es an, und allein darauf, daß einer sagen darf: „Was da ist, das ist mein.” Woraus aber leitet sich diese Berechtigung ab? Daraus, „daß ich es recht gebrauchte”. Genauer gesagt: daß das Übernommene nicht ein Fremdkörper im eigenen Werke sei, nicht äußerlich angeklebt als „Schmuck”, sondern aufgegangen im Geist und Sinnbild des Werkes, angeeignet in jenem innersten Wortsinn, in dem die Bibel sagt: „Fleisch von meinem Fleisch.”
So ist es, wenn Richard Wagner die leeren Quinten vom Anfang der Neunten Beethovens, jenes Oszillieren, das sich noch nicht zwischen Moll und Dur entschieden hat, kühnen Mutes in den „Holländer” übernimmt, wo es den bleichen Seemann zeichnet, der nicht Ruhe findet noch Erfüllung seiner Sehnsucht, und zugleich das ruhelose Element des Meeres. Nie wäre Wagner ohne das Erlebnis der Neunten auf jene Tonvision verfallen, und doch ist sie in Ausdruck und Bedeutung bei ihm ein völlig Neues, Unerhörtes, ihm selbst Eigengewordenes. — Einfacher liegen die Dinge am Beginn des „Rheingolds”, wo Wagner notengetreu die Wellenbewegung der Mendelssohnsdien „Melusine” benützte — um sie freilich anders weiterzuführen. Hier liegt eine an Zitat grenzende Entlehnung vor, die etwa mit dem aus Shakespeare übernommenen Lied des Mephisto zu vergleichen ist.
Die Beispiele ließen sich fortsetzen — aber nicht lang. Denn das Merkwürdige (für jenen Großteil des Publikums wahrhaft Merkwürdige) ist, daß der Aneignung im gedachten hohen Sinne natürlich nur die höchsten schöpferischen Potenzen, die stärksten Eigenpersönlichkeiten fähig sind. Nur sie sind imstande, Fremdes in sich aufzunehmen und als ein Eigenes im Eigenen auf gehen zu lassen. Alle Geister geringeren Ranges — und darunter auch sehr schätzenswerte, verdienstvolle, edle Künstler — laufen Gefahr, sich an den fremden Einfluß zu verlieren und, statt dem Fremden den Stempel ihres Geistes aufzudrücken, in der Zunge des anderen zu sprechen. Mit anderen Worten: sie werden Nachahmer, Epigonen. Und dazu bedarf es keines Zitats, keiner getreuen Entlehnung. Aus Theodor Körners Jambentragödien hören wir die Stimme Schillers, nicht aber den Gewittersturm seines kühnen nnd originalen Geistes; aus Hofmannsthal dringen die Stimmen Goethes, der alten Spanier, der Renaissance zu uns; in Karl Reinecke lebt Schumanns che Romantik, in Camillo Horn brahmsischer Emst — auch wenn nicht eine poetische oder gedankliche, melodische oder harmonische Wendung entlehnt wäre. Freilich liegen auch da die Dinge nicht immer so gradlinig, oft unterliegt e i n Geist verschiedenen Einflüssen, und es ist schon ein Zeichen weitgehender relativer Eigentümlichkeit, wenn er sie eklektizistisdh mit Geschmack vereint. Immerhin — sobald wir fremde Stimmen aus ihm za vernehmen glauben, vermissen wir jene höchste originale Schöpferkraft, der selbst eine getreue Entlehnung ohne weiteres verstauet ist.
Gerade diese Schöpferkraft aber, die aus eigenener Wurzel erwächst, darf aus dem Mutrerboden tausendfältige Nahrung saugen, die anderen Kräften entstammt. Auch dazu hat Goethe die entscheidende Erkenntnis gefunden: „Man spricht immer von Originalität, allein was will das sagen! Sowie wir geboren werden, fängt die Welt an, auf uns zu wirken, und das gebt so fort Ms ans Ende. Und überall, was können wir denn unser Eigenes nennen als die Energie, die Kraft, das Wollen. Wenn ich sagen könnte, was ich alles großen Vorgängern und Mitlebenden schuldig geworden bin, so bliebe nicht viel übrig” (zu Eckermann, 1. Buch, 12. Mai 1825). Ja, es ist ein Lieblingsgedanke, zu dem der alte Goethe immer wieder zurückkehrt.
Dies ist ja auch der tiefere Sinn des gern zitierten Spruches: „Vom Vater hab ich die Statur..der in den Schlußversen gipfelt:
„Sind nun die Elemente nicht Aus dem Komplex zu trennen, Was ist denn an dem ganzen Wicht Original zu nennen?”
Es ist unverkennbar, daß in diesem Vers das Wort „original” nicht ganz in dem Sinne gebraucht wird wie im vorherzitierten. Dort erscheint es gegenüber äußeren Einflüssen abgegrenzt, hier gegen innere, womit der Begriff ad absurdum geführt wird. Die beiden Zitate widersprechen sich aber nicht, sie ergänzen vielmehr einander. Auch der größte schöpferische Geist entfaltet sein Eigenleben nur auf Grund seiner inneren Anlagen, die er seinen Ahnen schuldet, und des Erlebnisses seiner Umwelt, die dauernd, am stärksten in seiner Jugend, auf ihn wirkt. Keiner ist, was er ist, aus sich. Das will Goethe sagen, und es läßt sich wohl nichts gegen diese weise Beobachtung einwenden.
Dennoch gibt es natürlich Originalität — wer wollte es leugnen? Und wer wollte sie missen? Aber sie besteht nicht in absoluter Eigenständigkeit, die Wurzellosigkeit bedeuten müßte, vielmehr in der eigenpersönlichen Ausprägung, in jener Kraft, die Ererbtes und Erworbenes zu etwas Eigenem und in diesem beschränkten Sinne Neuen bindet. Denn alles Neue ist bloß in diesem Sinne neu, in anderem „gibt es nichts Neues unter der Sonne”. Um nochmals Goethe zu zitieren: „Gestaltung, Umgestaltung, des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung.” Die Originalität wird sichtbar erst im Ergebnis des künstlerischen Schöpfungsprozesses, als Ergebnis freilich einer von Anbeginn wirkenden Kraft, daher ohne ihrem Wortsinn etwa untreu zu werden. Diese Kraft aber ist selbst wieder aus einem besonders glücklichen Zusammenwirken ererbter Komponenten erwachsen, daher nur im beschränkten Sinne „original”.
Solcher Kraft verdanken wir die Taten eines Michelangelo, Mozart, Goethe, an welchen ihr Volk, ihr Jahrhundert mitgeschaffen. Und wenn wir sie an vielen unter uns missen, so hat das kaum etwas mit jenen Rechenkunststücken und advoka- torischen Beweisführungen der geistigen Impotenz zu tun, die so gern an allen Ringenden und Schaffenden ihr Mütchen kühlt. Denn die Fälle, in denen wirklich ein Autor „abgeschrieben” hat, um sich mit fremden Federn zu schmücken, sind gottlob selten und richten sich selbst. Einer kritischen Betrachtung sind sie gar nicht würdig.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!