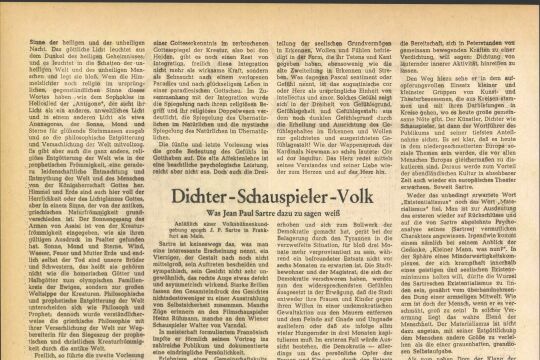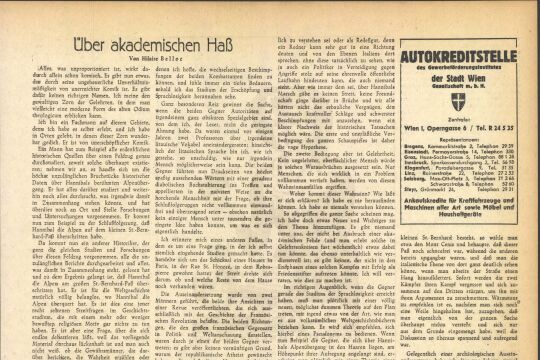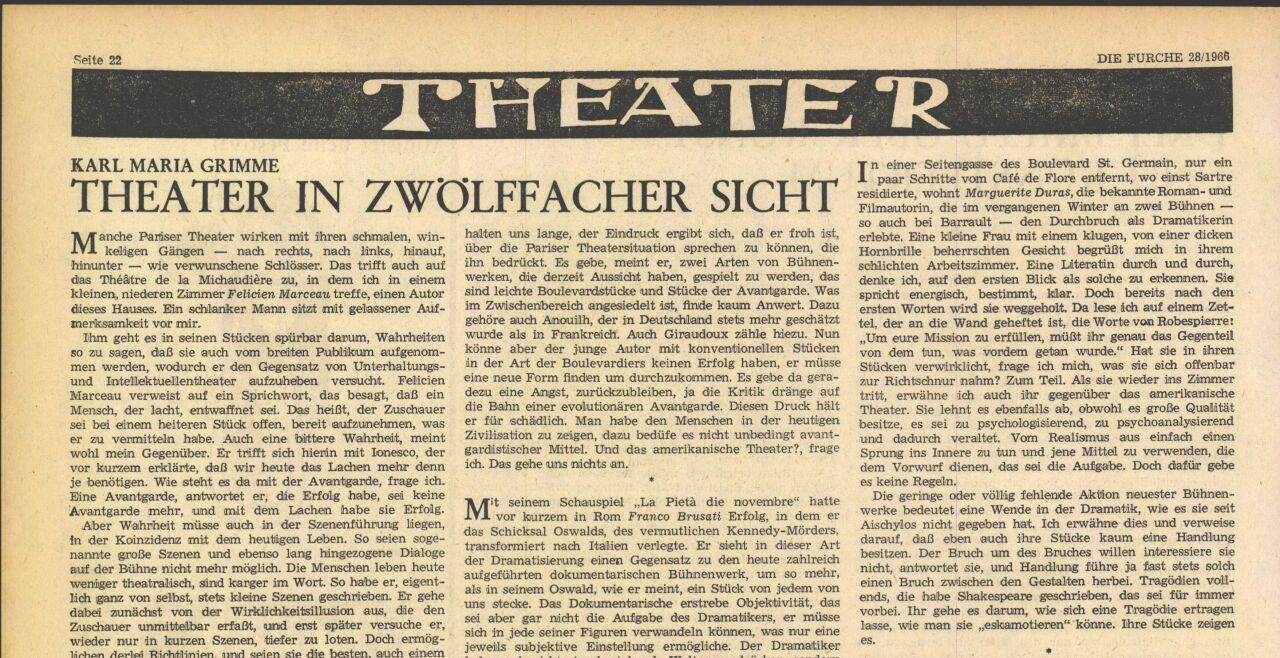
Manche Pariser Theater wirken mit ihren schmalen, winkeligen Gängen — nach rechts, nach links, hinauf, hinunter — wie verwunschene Schlösser. Das trifft auch auf das Théâtre de la Michaudière zu, in dem ich in einem kleinen, niederen Zimmer Felicien Marceau treffe, einen Autor dieses Hauses. Ein schlanker Mann sitzt mit gelassener Aufmerksamkeit vor mir.
Ihm geht es in seinen Stücken spürbar darum, Wahrheiten so zu sagen, daß sie auch vom breiten Publikum aufgenommen werden, wodurch er den Gegensatz von Unterhaltungs- und Intellektuellentheater aufzuheben versucht. Felicien Marceau verweist auf ein Sprichwort, das besagt, daß ein Mensch, der lacht, entwaffnet sei. Das heißt, der Zuschauer sei bei einem heiteren Stück offen, bereit aufzunehmen, was er zu vermitteln habe. Auch eine bittere Wahrheit, meint wohl mein Gegenüber. Er trifft sich hierin mit Ionesco, der vor kurzem erklärte, daß wir heute das Lachen mehr denn je benötigen. Wie steht es da mit der Avantgarde, frage ich. Eine Avantgarde, antwortet er, die Erfolg habe, sei keine Avantgarde mehr, und mit dem Lachen habe sie Erfolg.
Aber Wahrheit müsse auch in der Szenenführung liegen, in der Koinzidenz mit dem heutigen Leben. So seien sogenannte große Szenen und ebenso lanig hingezogene Dialoge auf der Bühne nicht mehr möglich. Die Menschen leben heute weniger theatralisch, sind karger im Wort. So habe er, eigentlich ganz von selbst, stets kleine Szenen geschrieben. Er gehe dabei zunächst von der Wirklichkeitsillusion aus, die den Zuschauer unmittelbar erfaßt, und erst später versuche er, wieder nur dn kurzen Szenen, tiefer zu loten. Doch ermöglichen derlei Richtlinien, und seien sie die besten, auch einem guten Autor keineswegs, daß er stets gute Stücke schreibt. Für ihn selbst, meint er, wäre es schlecht, wenn er immer nur gute Kritiken hätte.
In einem Nobelcafé gegenüber der Comédie Française spreche ich René de Obaldia, einen liebenswürdig eleganten Mann, von dem das Stück „Du vent dans les branches de Sassafras“ in der vergangenen Saison -auf Wochen hinaus ausverkauft war. Er betont, daß das Theater ein Spiel sei, wobei man aber den Fragen von heute nicht ausweichen dürfe. Große Probleme zu bieten, darum gehe es, aber sie unverfälscht so zu wenden, daß man dabei lacht, denn — hier berührt er sich mit Felicien Marceau — das Lachen befreit. Das fehle der Welt. Die Menschen, eingesperrt in sich selbst, warten darauf. Um das Publikum sofort zu packen, bedürfe es eines wirksamen Absprungs, einer spannenden Ausgangssituation; um nicht zu lar gweilen, sei Aktion nötig. Auch weiterhin. Vor allem aber dürfe man sidh in den Stücken nicht der Hoffnungslosigkeit ergeben. Doch habe er kein System, er halte sich frei davon, er sei gegen jeden Konformismus mit sich selbst.
Unfern der Piazza del Popolo, wo fast ein Antiquitätenladen an den anderen grenzt, wohnt der 74jährige Aldo de Benedetti. Wie viele italienische Dramatiker ist er mit der Theatersátuation in seinem Land unzufrieden und schreibt daher erstmals einen Roman. Immerhin spielten die italienischen Compagnias 16 seiner Stücke. Doch freuten ihn, wie er in einem Gespräch erklärt, die Auslanidserfoige stets mehr als die im Inland — er erhielt ais der außerhalb Italiens am meisten gespielte Autor eine Goldmedaille —, da diese Erfolge beweisen, daß seine Stücke universelle Probleme behandeln, Probleme, die geeignet sind, die Menschen überall unmittelbar zu berühren.
Befragt, ob es seiner Ansicht nach für dieses Universelle so etwas wie Richtlinien gebe, meinte er, vor allem dürfe aus den Gestalten niemals der Autor selbst sprechen, wie dies bei Ionesco und Beckett der Pall sei. Daher gebe es in ihren Stücken keine lebendigen Figuren. Man dürfe auch nicht den außerordentlichen Pall mit außerordentlichen Menschen bieten, denn der Zuschauer müsse sich fragen können, wie er sich selbst in der vorgeführten Situation verhalten würde.
Nur dann entstehe ein wirklicher Kontakt.
Wie Aldo de Benedetti in Rom ist Jacques Deval in Paris ein Autor, der gehobenes Boulevardtheater bietet. Er wohnt im Erdgeschoß eines modernen vierstöckigen Hauses, in dem die Mieten vermutlich sündteuer sind. Nur Glaswände trennen seinen reizenden kleinen Arbeitsraum, in dem sich mancherlei Antiquitäten befinden, von einem von hohen Hauswänden umgebenen Garten, der lediglich ihm und den Seinen zugämgig ist. Einen kleinen Jungen stellt er als „man fiis“ vor. Ruhig, fast wie selbstverständlich formuliert dieser Siebziger, nachdem er beinahe schwärmerisch von Österreich und vom Theater in der Josefstadt gesprochen hat, seine Gedanken. Die Avantgarde definiert er als gedanklich infiltriertes Grand Guignol. Fortschritt gebe es nur in der Wissenschaft, nicht in der Kunst, die Wissenschaft sei Entdeckung, der Dramatiker dagegen entdecke nicht, er erfinde. Im übrigen drehe sich das Theater ständig in seinem Bett.
Von Tragödien hält Jacques Devai nicht viel, Shakespeares tragische Bühnenwerke ausgenommen. Tragödien und philosophische Stücke seien 50 Jahre nach ihrem Entstehen nicht mehr spielbar. Dagegen erleben heitere Bühnenwerke eine zweite Karriere, wie die Stücke von Feydeau und Labiche beweisen. Bestrebungen, die danach zielen, totales Theater zu bieten, erscheinen -ihm verfehlt. Es gebe keine Vorwürfe dafür. Tue man dn eine Kasserolle alles, was sich in einer Küche findet, Fleisch, Obst, Käse, Konfitüren, Senf, Schokolade, so sei das eben nicht eßbar. Das Theater bediene sich gewiß einer Vielfalt von Mitteln, aber er sehe nicht ein, weshalb man alle auf einmal verwenden solle. In jedem Stück setze man jene Mittel ein, die es braucht, das totale Theater nimmt hinzu, was es nicht braucht. Ein Wort von Müsset lasse sich auf das Theater anwenden, auch das Theater biete immer wieder „neue Verse auf alte Lieder“. Ich stehe schon in der Tür, da vergleicht Jacques Deval den Dramatiker mit einem Baum. Die Einfälle, meint er, seien wie die Vögel, die sich auf die Zweige setzen. Sie kommen oder kommen nicht, man müsse warten.
Zu den jüngeren Pariser Dramatikern gehört Jean-Louis Roncoroni, der von Anouilh gefördert wurde. Ich treffe ihn in einem großen Café auf den Champs-Elysées, wir unter-
halten uns lange, der Eindruck ergibt -sich, daß er froh ist, über die Pariser Theatersituation sprechen zu können, die ihn bedrückt. Es gebe, meint er, zwei Arten von Bühnenwerken, die derzeit Aussicht haben, gespielt zu werden, das sind leichte Boulev-ardstücke und Stücke der Avantgarde. Was im Zwischenbereich angesiedelt ist, finde kaum Anwert. Dazu gehöre auch Anouilh, der in Deutschland stets mehr geschätzt wurde als in Frankreich. Auch Giraudoux zähle hiezu. Nun könne aber der junge Autor mit konventionellen Stücken in der Art der Boulevardiers keinen Erfolg haben, er müsse eine neue Form finden um durchzukommen. Es gebe da geradezu eine Angst, zurückzubleiben, ja die Kritik dränge auf die Bahn einer evolutionären Avantgarde. Biesen Druck hält er für schädlich. Man habe den Menschen in der heutigen Zivilisation zu zeigen, dazu bedüfe es nicht unbedingt avantgardistischer Mittel. Und das amerikanische Theater?, frage ich. Das gehe uns nichts an.
Mit seinem Schauspiel „La Pietà die novembre“ hatte vor kurzem in Rom Franco Brusati Erfolg, in dem er das Schicksal Oswalds, des vermutlichen Kennedy-Mörders, transformiert nach Italien verlegte. Er sieht in dieser Art der Dramatisierung einen Gegensatz zu den heute zahlreich aufgeführten dokumentarischen Bühnenwerk, um so mehr, als in seinem Oswald, wie er meint, ein Stück von jedem von uns stecke. Das Dokumentarische erstrebe Objektivität, das sei aber gar nicht die Aufgabe des Dramatikers, er müsse sich in jede seiner Figuren verwandeln können, was nur eine jeweils subjektive Einstellung ermögliche. Der Dramatiker habe auch nicht eine bestehende Weit auszudrücken, sondern eine Welt zu schaffen, eine andere Realität als die kommune, und zwar setzt man sie in Beziehung zu dem in der bestehenden Dramatik Vorgeführten, über die Avantgarde hinaus. Brusati versteht darunter die verdeckte Realität des Gesetzlichen hinter der unmittelbar erkennbaren Realität. Mit anderen Worten; Es sei Aufgabe des Dramatikers, Ordnung in das Chaos zu bringen.
Auch der Italiener Aldo Nicolai, von dem die vier letzten Stücke nicht in Italien, sondern in Wien üra-ufgeführt wurden, nimmt zu den Dokumentarstücken Stellung, von denen zahlreiche in der letzten Zeit in Westdeutschland herauskamen. Soweit in ihnen die Vergangenheit zu „bewältigen“ versucht wurde, wendet er sich gegen sie. Er -erklärt, man solle nicht zurückblicken, politische Situationen seien vergänglich, und daher bestehe keine Notwendigkeit, sie auf der Bühne darzustellen. Im übrigen sei es leicht, die Vergangenheit zu verurteilen. Daher betont Ndcolaj die Verantwortung gegenüber der Gegenwart, da müsse man versuchen, die Gewissen zu erwecken.
Gegen das Experimentiertheater spricht sich ein anderer italienischer Autor, Giuseppe Dessi, aus, dessen Stück „La Giustizia“ internationale Erfolge errang. Experimentelles wendet sich seiner Meinung nach nicht an das „wahre“ Publikum, sondern lediglich an kleine Kreise. Das zeige sich auch im Dramaturgischen, die Aktionslosigkeit vieler dieser Stücke biete dem Zuschauer viel zu wenig. Dessi führt sie einfach darauf zurück, daß man in einer Zeit der Experimente auch das Gegenteil der Aktion ausprobieren wolle. Bei der Aktionslosigkeit trete zum Nachteil des Stückes die Person des Autors stärker hervor, während er, Dessi selbst, der Romane in Ich-Form schrieb, Dramatiker wurde, um aus dem Gefängnis des Ichs auszubrechen. Lediglich die Abneigung der italienischen Theater, noch nicht bewährte Stücke aufzuführen, zwinge ihn, wieder Romane zu ‘schreiben.
In einer Seitengasse des Boulevard St. Germain, nur ein paar Schritte vom Café de Flore entfernt, wo einst Sartre residierte, wohnt Marguerite Duras, die bekannte Roman-und Filmautorin, die im vergangenen Winter an zwei Bühnen — so auch bei Barrault — den Durchbruch als Dramatikerin erlebte. Eine kleine Frau mit einem klugen, von einer dicken Hornbrille beherrschten Gesicht begrüßt mich in ihrem schlichten Arbeitszimmer. Eine Literatin durch und durch, denke ich, auf den ersten Blick als solche zu erkennen. Sie spricht energisch, bestimmt, klar. Doch bereits nach den ersten Worten wird sie weggeholt Da lese ich auf einem Zettel, der an die Wand geheftet ist, die Worte von Robespierre: „Um eure Mission zu erfüllen, müßt ihr genau das Gegenteil von dem tun, was vordem getan wurde.“ Hat sie in ihren Stücken verwirklicht, frage ich mich, was sie sich offenbar zur Richtschnur nahm? Zum Teil. Als sie wieder ins Zimmer tritt, erwähne ich auch ihr -gegenüber das amerikanische Theater. Sie lehnt es ebenfalls ab, obwohl es große Qualität besitze, es sei zu psychologisierend, zu psychoanalysierend und dadurch veraltet. Vom Realismus aus einfach einen Sprung ins Innere zu tun und jene Mittel zu verwenden, die dem Vorwurf dienen, das sei die Aufgabe. Doch dafür gebe es keine Regeln.
Die geringe oder völlig fehlende Aktion neuester Bühnenwerke bedeutet eine Wende in der Dramatik, wie es sie seit Aischylos nicht gegeben hat. Ich erwähne dies und verweise darauf, daß eben -auch ihre Stücke kaum eine Handlung besitzen. Der Bruch um des Bruches willen interessiere sie nicht, antwortet sie, und Handlung führe ja fast stets solch einen Bruch zwischen den Gestalten herbei. Tragödien vollends, die habe Shakespeare geschrieben, das sei für immer vorbei. Ihr gehe es darum, wie sich eine Tragödie ertragen lasse, wie man sie „eskamotienen“ könne. Ihre Stücke zeigen es.
Eine der pariserischsten Straßen ist die Rue de Seine. Da gibt es Buchladen neben Buchladen, Antiquitätengeschäft neben Antiquitätengeschäft, Geistiges spürt man überall. In einem der alten Häuser dieser Straße wohnt Jean Cau, der ehemalige Sekretär von Sartre, bei dessen „Parachutistes“ vor drei Jahren die Rechtsterroristen wochenlang jeden Abend Stinkbomben warfen und die Linksintellektuellen ebenfalls protestierten. Sein „Le maître du monde“, eine Hitler-Farce, erregte im Vorjahr bei einer Leseaufführung erhebliche Aufmerksamkeit.
In einem niederen Zimmer, wo Zeitungen am Fußboden liegen, empfängt er mich, ein schlanker, schwarzhaariger jüngerer Mann im Schl-afrock, die nackten Füße stecken in Pantoffeln. Im Gespräch findet er treffliche Formulierungen, so bezeichnet er gleich anfangs die Surrealisten als Terroristen der Realität. Man spürt, er kommt von der auf das Politische gerichteten Sicht Sartres her. Und schon zeigt er die Entwicklung der Dramatik seit dem letzten Krieg, eben seit Sartre und Camus, auf. Diese beiden wollten nicht „verstehen“, erklärt er, sondern ändern, sie waren politisch engagiert, ihr Optimismus postulierte die Freiheit. Danach kam mit Ionesco und Beckett, die er als die „kleinen Neffen Kafkas“ bezeichnet, eine neue Generation, die allen Optimismus, alle Freiheit negierte und davon überzeugt war, daß wir nichts ändern können. Aber auch das sei wieder vorbei, auch die pessimistische Einstellung hielt sich nicht, nun sind wir bei der Beschreibung angelangt, bei den Dokumentarstücken.
Als heute entscheidendes dramaturgisches Problem verweise ich auf das Fehlen der Handlung, zwar nicht bei seinen „Parachutistes“, wohl aber in sonstigen heutigen Stücken und frage, weshalb die Aktion seiner Meinung nach unterdrückt werde. Er antwortet, daß die Zukunft ehedem zu überblicken war, vieles ließ sich in den Folgen voraussehen, heute dagegen gebe es nur Ungewißheit, Unruhe, wir wissen nicht, was in fünf Jahren sein wird. Wie soll es da einen logischen Ablauf von Ereignissen, von Ursache und Wirkung auf dem Theater geben, meint er. Strenge Kausalität war tatsächlich die Forderung von früher. Weshalb aber der Konflikt eine so geringe Bedeutung für die heutige Dramatik besitzt, glaubt er damit zu erklären zu können, daß der Konflikt nur bei intakter Moral möglich sei, die heutefehle.
Eine eigenartige Meinung betreffs der -geringen oder mangelnden Aktion in neuen Bühnenwerken bekundet Rainardo Mainardi, ein jüngerer italienischer Dramatiker, der lediglich im Film, für den er ebenfalls arbeitet, nicht aber in Theaterstücken Handlung einsetzt. Auf den Brettern zeigt er die Folgen eines Vorausgegangenen, einer Handlung, die aber keine weitere Handlung provoziert. Dieses Enthüllen im Ibsenschen Sinn vermöge zu packen. Gegen das Vorführen einer Aktion wende er sich deshalb, weil, wie er im Gegensatz zu herrschenden Anschauungen meint, die handelnde Person während des Handelns viel weniger sie selbst sei als nach der Aktion. Das Handeln bilde für den Handelnden keinen Abschluß, wie es auf sein Inneres zurückwirkt, dies hält Mainardi für letztlich entscheidend.
Nicht weit von den Grünanlagen der Pariser Universitätsstadt entfernt befinden sich in einer schmalen Gasse Einfamilienhäuser, in deren einem François Billetdoux wohnt. Ein freundlicher, etwas behäbiger junger Mann bittet mich in sein „trau“, in einen winzigen Raum voll Bücher, in dem eine indische Drossel einen Höllenspektakel macht. Ihn stört sie nicht mehr, er fragt ob sie mich störe. Aus Höflichkeit sage ich „nein“.
Auch Billetdoux sieht die Dramatik generationsbedingt, je nach den Epochen drücken si-dh die Autoren seiner Meinung nach verschieden aus. Auf die Ionesoo und Beckett folgen die Fündunddreißi-g- bis Vierzigjährigen, die Pinter, Osbome, Peter Weiß, Mrozek und er, die man nicht mehr der Avantgarde zuordnen könne. Doch sei auch für sie das Vorführen einer Aktion, einer „Geschichte“ unmöglich geworden. Der Film mache das besser. Mit Gozzis 36 dramatischen Situationen sei es vorbei. Nur die innere Aktion habe man darzustellen, den Kampf gegen sich selbst. Auch der Konflikt sei nicht nach außen wirkend zu zeigen. Es gehe um die Erwek- kung des Gewissens in allen Erscheinungsformen, auf allen Ebenen, der sozialen bis zur metaphysischen. Dies bedinge die Größe Shakespeares. Doch liege es nicht mehr an uns, Lösungen zu zeigen.
Die Drossel ist wieder lebhaft geworden. Sie sei auf mich eifersüchtig, sagt Billetdoux lächelnd. Ich bin zartfühlend genug, das indische Federvieh nicht weiter aufzuregen und erheb® mich. Billetdoux begleitet mich bi vor die Haustür.