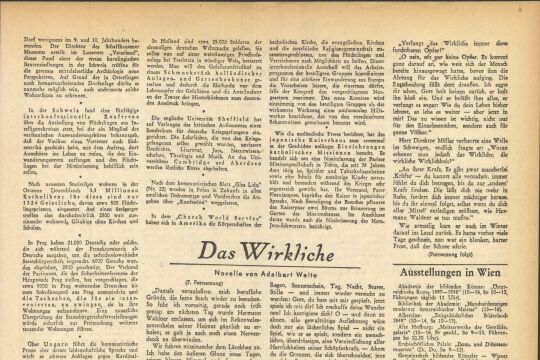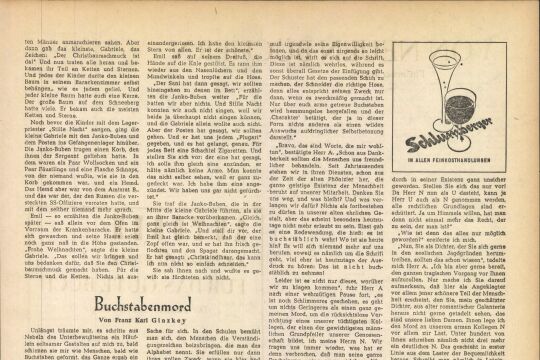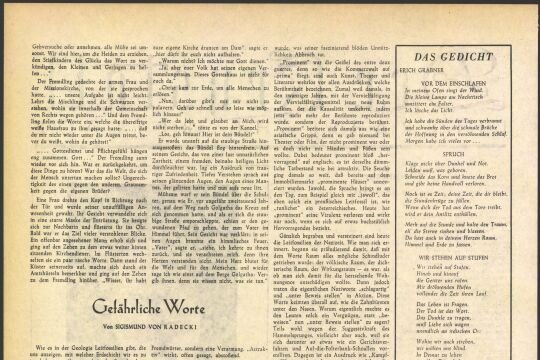Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
UBER DEN GESCHMACK
Selig sind, die Geschmack haben, auch wenn es ein schlechter Geschmack ist, sagt Nietzsche. Aber wer kann sich heute dieser Seligkeit rühmen? Geschmack hat, wer auf einen Reiz ganz unüberlegt antwortet; er mag nachher aus seinem Verstände Gründe dafür beibringen, aber diese rechtfertigen sein Urteil bloß, sie veranlassen es nicht, und es kann auch sein, daß jene Antwort sich durchaus vor dem Verstände nicht zu behaupten weiß. Geschmack hat, wer unmittelbar ja oder nein sagt, bevor er noch selber weiß warum. Geschmack hat, wer von Behagen oder Ekel überwältigt wird, ohne daß er sich helfen könnte. Aber das ist doch den „Gebildeten“ allmählich ganz abhanden gekommen. Ja, wir haben eine eigene Vorrichtung, um es auszutreiben: die sogenannte künstlerische Erziehung. Das Kind wird, bevor ihm noch irgendein Werk gefällt oder mißfällt, schon darüber belehrt, was ihm gefallen, was ihm mißfallen soll, *o daß sich dann das eigene Gefühl gar nicht mehr hervorwagt, sondern immer erst beim Verstände, bei den anerzogenen Grundsätzen anfragt, ob es denn auch erlaubt ist. Das Kind glaubt dem, der ihm ein schönes Bild zeigte. Es merkt sich, wie dieses schöne Bild aussieht, und wenn dann später irgendein anderes Bild es irgendwie daran erinnert, schließt es daraus, daß auch dieses Bild schön sein muß. Das Kind hat an Beispielen gelernt, was ihm zu gefallen hat, und sooft es später durch irgendein Werk an ein solches Beispiel erinnert wird, folgert es daraus, daß ihm auch dieses Werk zu gefallen hat. Was wir heute Geschmack nennen, besteht bloß aus solchen Erinnerungen.
Gerät einer aber nun plötzlich an ein Werk, das ihn an nichts erinnert, so erschrickt er. Und wenn er gar dabei selbst etwas empfindet, erschrickt er noch mehr. Seiner eigenen Empfindung traut er ja nicht; das ist ihm abgewöhnt worden. Er fragt also den Verstand nach Gründen. Aber auch den Gründen traut er nicht mehr. Denn davor warnt den „Gebildeten“ unserer Zeit das traurige Beispiel seiner Eltern. Er hat Angst, sich auch so zu blamieren. Er hat nämlich in jungen Jahren erlebt, daß das Urteil der Kenner in allen Künsten versagte. Es ächtete Wagner, es ächtete Bruckner und Hugo Wolf, es ächtete Mahler, Reger und Strauss, alle, die er heute als Meister verehrt sieht. Er hat dasselbe miit Hebbel und Ibsen, mit Hauptmann und Dehmel erlebt. Er weiß, daß Napoleon III. dem ersten Bilde Manets, das sich öffentlich zu zeigen wägte, voll Abscheu den Rücken kehrte, die Kaiserin aufschrie und der ganze Hof sich vor Lachen wand, und er weiß, daß heute jedes Museum einen Manet haben muß, und er weiß auch die Preise. Er weiß, daß Millet für seinen „Angelus“ ein paar tausend Franken erhielt und daß man denselben „Angelus“ dann mit achtmal hunderttausend Franken bezahlt hat. Er kann die Blamage seiner Eltern zahlenmäßig belegen. Er möchte vor seinen Kindern nicht auch einst so dastehen. Davor hat er Angst. Geschmack aber, eigenes Gefühl, das unmittelbar antwortet, ohne Gründe zu brauchen und ohne nach den Folgen zu fragen, fehlt ihm, das hat ihm die Kunst* erziehung ausgetrieben. Auf Grundsätze und Regeln mag er sich auch nicht verlassen, noch Autoritäten glauben, das verbietet ihm das warnende Beispiel der Eltern. Was soll er tun? Es bleibt dem Ärmsten nichts übrig als jene Angst. Auf ihr beruht, ja man kann sagen: aus ihr besteht sein Verhältnis zur Kunst. Wenn er ein Angstgefühl hat, hält er das für das Zeichen, wodurch sich ihm ein Kunstwerk ankündigt. Was ihm gefällt, hält er für unkünstlerisch, schon weil es ihm gefällt, und er wird also um keinen Preis eingestehen, daß es ihm gefällt. Wenn er zugeben soll, daß ihm etwas gefällt, muß es ihm vor allem mißfallen. Daran, daß es ihm mißfällt, glaubt er zu erkennen, daß es ein Kunstwerk ist, und so hält er 9ich für verpflichtet, daß es ihm gefällt. Kunst ist ihm, was ihn unruhig macht, was ihn beleidigt, was er scheußlich findet. Er sagt sich dann: Das wirkt auf mich genauso wie Wagner, Ibsen, Manet auf meine Eltern, folglich wird es in 30 Jahren anerkannt, und ich will dann nicht der Dumme gewesen sein!
Daher kommt es, daß unsere Zeit ein Vorurteil für alles Neue hat; dadurch unterscheidet sie sich von allen Vergangenheiten.
Der Bildungsphilister ist von Grund aus umgekehrt worden: er stand früher nach gestern hin, er steht heute gegen morgen zu; sein Hauptmerkmal war einst der Widerstand, sein Hauptmerkmal ist heute die Wehrlosigkeit. Man erkannte ihn sonst daran, daß er nicht vorwärtszubringen war, man erkennt ihn jetzt daran, daß es ihm nie geschwind genug geht. Er setzt jetzt seinen Stolz darein, daß er sich bemüht, jeder neuen Erscheinung gerecht zu werden. So nennt er das, aber es bleibt freilich die Frage, ob ihr gerecht wird, wer sie nur nach ihrer Neuheit schätzt. Und das ist ja das einzige Kennzeichen, nach dem er sich an Kunstwerken orientiert. Er ist dazu erzogen worden, für ein Kunstwerk bloß gelten zu lassen, was ihn an ein Schulbeispiel erinnert; da£ hat er, aus. Angst, sich zu blamieren, überwunden, und so laßt er seitdem für ein Kunstwerk bloß gelten, .was ihn an läSteJjtjjfoinnert. Es muß noch nie dagewesen sein, und das bemerkt er an seinem eigenen Entsetzen. Er ist darum auch dem Werke, für das er im Augenblick schwärmt, schon im nächsten wieder untreu, weil er ja nur dafür schwärmt, solange es das Neueste bleibt, und weil er immer Angst hat, daß inzwischen vielleicht schon wieder ein noch Neueres das Neueste verdrängt hat.
Daher auch seine Gereiztheit, weil er das Gefühl hat, doch immer betrogen zu sein: er will ja stets das Letzte, und kein's bleibt je das Letzte, morgen muß er es wieder verleugnen. Daher auch die Eifersucht der Bildungsphiilister untereinander in ihrem Wettrennen. Sie wird noch verschärft dadurch, daß keiner mehr glaubt, dem anderen gefalle das wirklich, sondern jeder bei sich jeden für einen Schwindler hält, sich selbst aber vor seinem eigenen Gewissen damit entschuldigt, man dürfe doch „nicht hinter seiner Zeit zurückbleiben“, man müsse doch „mitkommen“. Es ist niemals so schwer gewesen, so anstrengend, ein Bildungsphilister zu sein (1916).
Aus den Essays von Hermann Bahr, erschienen im H.-Bauer-Verlag, Wien
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!