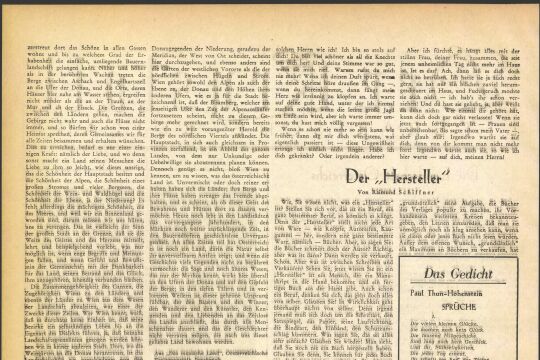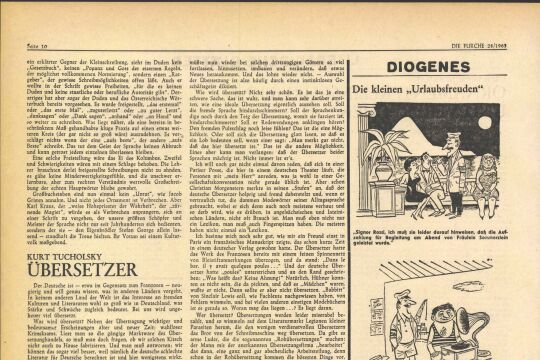Es bestehen recht unklare Vorstellungen darüber, wie ein Buch entsteht; wenige nur wissen etwas von seinem Werdegang, den wir hier schildern wollen, angefangen von der ersten Idee im Kopf des Dichters, bis hin zur Lektüre, also bis zum Kopf des Lesers. Es lassen sich über den allerersten Anlaß, der den Dichter inspiriert, ein Buch zu schreiben, keine allgemeingültigen Aussagen machen, da er tausendfach verschiedener Natur ist. Ein winziger, rein äußerer Vorfall kann die Idee zu einem großen Romanwerk geben. Der flämische Dichter Felix Tirrvnermans, der unter anderem das bezaubernde Buch „Pallieter“ geschrieben hat, erzählte mir einmal, als ich ihn in seiner Heimatstadt Lier besuchte, das folgende Erlebnis:
In seinem Rumpelkasten hatte er eines Tages ein altes Bild aus der Biedermeierzeit entdeckt. Es stellt eine junge Frau mit wehmütigen Augen und einem verlangenden Mund dar. Als seine Mutter das Bild sah, sagte sie, daß diese junge Frau eine Verwandte von ihnen sei. Timmermans dachte dann nicht weiter an das Bild. Jahre später aber, in einer Winternacht, hörte er einen Mann auf der Straße ein wehmütiges Lied singen. Er kannte das Lied nicht, und er hat es auch später nie wieder gehört. Aber es ließ ihn an Rußland denken, an etwas sehr Fernes und Mystisches. Timmermans lauschte dieser Stimme nach, bis er sie nicht mehr hören konnte. Das Lied hatte auf ihn einen tiefen Eindruck gemacht und wieder die Erinnerung an das alte Bild geweckt. Er stellte sich nun in seiner Phantasie vor, daß die junge Frau mit den wehmütigen Augen diesem Lied gelauscht hatte und daß sie in den nächsten Nächten wieder sehnsüchtig und ängstlich dieser Stimme lauschen würde. Drei Nächte würde sich das wiederholen, und das Lied hatte in ihr die Liebe zu diesem unbekannten Mann entfacht. Einige Tage später würde sie ihm bei irgendeiner Gelegenheit begegnen. Sie würde ihn lieben, aber dann müßte sie erfahren, daß er verheiratet sei. An dem Kampf in ihrer Seele zwischen ihrer Liebe und ihrem Gewissen würde sie zugrunde gehen. „Da hatte ich plötzlich eine Geschichte“, erzählte mir Timmermans, „gewachsen aus diesem Lied und dem alten Bild in meinem Rumpelkasten.“ Diese Geschichte nannte er „Die Delphine“. Später schrieb er mir dann noch einmal: „Viel ist manchmal nicht nötig, um ein Buch entstehen zu lassen: ein fallendes Blatt, ein Lied oder ein Vogel, der durch den Abendhimmel zieht, und gleich öffnen sich uns Horizonte, die man bis dahin nicht vermutet hatte. Nur das Schreiben erfordert ein wenig Geduld und Hingabe, und natürlich auch Feder und Papier.“
Wir, die Leser, die keine Dichter sind, können nur vermuten, wie eine Geschichte oder ein Roman entsteht. Nur das dürfen wir sagen: Immer wird die Vision, die Idee oder wie wir jenen geheimnisvollen Vorgang sonst nennen wollen, entscheidend sein für die Komposition der ganzen Dichtung; sie wird die Grenzen und den Umfang des Werkes bestimmen, wobei aber noch nicht einmal endgültig feststeht — viele Schriftsteller haben hierüber schon ausgesagt —, ob ein Stoff, der ursprünglich : ir eine Novelle vorgesehen war, sich nicht später zum Rcvnan entwickelt, ja nicht selten entdeckt der Dichter erst bei der Arbeit, daß sein Entwurf einen stärkeren dramatischen als epischen Charakter hat, und daß er das als Erzählung begonnene Werk zum Drama umgestalten muß.
Was geschieht nun weiter, wenn der Dichter glaubt, einen tragfähigen Stoff für einen Roman „gefunden“ zu haben? In den meisten Fällen vergeht wohl eine längere Zeit, ohne daß der Verfasser eine einzige Zeile schreibt. Unablässig aber arbeitet in ihm die Idee weiter; sie wird immer klarer und umfassender. Das Beispiel vom Samenkorn ist hier am Platze: so wie dieses entwickelt sich organisch die Idee. Der Dichter macht sich im Verlauf der Vorarbeit Notizen, Bemerkungen über diese und jene Einzelheit, er umreißt die Hauptpersonen und macht Studien vielfältiger Art. Von Frank Thieß wissen wir, daß er bei größeren Werken mit historischem oder zeitpolitischem Hintergrund einen „Kompositionsplan“ anlegt, in dem schon der Ablauf der zu erzählenden Geschichte in großen Umrissen festgehalten wird. Der Poet setzt sich also nicht einfach hin und fabuliert drauflos! O nein — wäre es so einfach, dann wäre das Schreiben ein Vergnügen. In Wirklichkeit besteht dieses „Vergnügen“ in harter Arbeit, die nur dem leicht erscheint, der nie in die Werkstatt eines Schriftstellers geschaut hat!
Einige Autoren arbeiten, wenn sie erst einmal mit einem Werk begonnen haben, unter einem so starken inneren Druck, daß sie es in kurzer Zeit abschließen. Aber das sind die Ausnahmen. — Ich meine, es ist gut, das zu wissen, denn von aller Mühe und Plage merkt der Leser später nichts. Und je mehr es dem Dichter gelingt, seine Leser die von ihm aufgewendete „Arbeit“ nicht spüren zu lassen, je spielerischer oder „gekonnter“ uns sein Werk erscheint, desto schneller und'inniger sind wir ihm verbunden.
Ist ein Roman endgültig abgeschlossen und liegt er nun in Schreibmaschinenschrift vor — was geschieht dann? Ein bereits „bekannter“ Aufor sendet das Manuskript seinem Verleger, der es durch seinen Lektor prüfen läßt. Lektoren sind jene Mitarbeiter des Verlegers — viel gescholten und wenig gelobt —, die sagen müssen, ob dem Verfasser ein Buch geglückt ist. Keine leichte Aufgabe, denn auch ein anerkannter Dichter kann einmal ein schwaches Werk schreiben. Wenn der Verleger sich zur Herausgabe des Buches entschließt, wird zuerst an Hand des Manuskriptes der voraussichtliche Umfang des Buches geschätzt. Die Schriftgröße und der Satzspiegel — die Größe einer Buchseite — Werden festgelegt, wonach der Hersteller dann die Seitenanzahl des Buches genau berechnen kann. Daraus ergibt sich der Papierverbrauch für die ganze Auflage, deren Höhe dem zu erwartenden Erfolg des Buches entsprechend festgesetzt wird. Jeder Verleger träumt von großen Auflagen, natürlich auch der Verfasser. Aber die „Bestseller“ sind selten, und man kann sie nicht „machen“. Keine Reklame hilft und keine Werbung, die sehr teuer ist, kann das Wunder vollbringen! Ob ein Buch ein „Bestseller“ wird, hängt von tausend Imponderabilien ab. Die meisten Bücher — die besten oft — führen ein Schattendasein, zum Kummer der Verleger und Autoren, die voller Hoffnung waren, als sie ihr Buch in die Welt sandten. Auch hier gilt das alte Wort „Habent sua fata libelli“.
Erst wenn alle technischen Kleinarbeiten vom Verleger abgewickelt sind, wird das Manuskript an die Druckerei gegeben, die es „absetzt“1, das heißt, das ganze Manuskript wirderst einmal vollständig gesetzt, und von diesem Satz erhält der Verleger die ersten Abzüge. Diese „Fahnen“, früher auch „Bürstenabzüge“ (Korrekturabzüge) genannt, liest zuerst der Korrektor des Verlages, dann der Lektor und natürlich auch der Verfasser. Der Korrektor achtet vor allem auf Druckfehler, die sich natürlich immer einschleichen. Für den Autor aber beginnt aufs neue eine konzentrierte Arbeit, denn jetzt bietet sich ihm unweigerlich die letzte Möglichkeit zu Korrekturen oder Änderungen. In diesem Stadium ist die Selbstkritik des Schriftstellers ganz besonders wach und empfindlich. Denn was er jetzt versäumt, ist für die ganze erste Auf-
läge nicht mehr gutzumachen, und der Kritiker kreidet ihm dann alle Sünden an, wobei er auch manches harte Wort gegen den Verleger und seine Lektoren sagt. Manche Schriftsteller fangen nun erst, beim Lesen der Korrekturfahnen, an — zum berechtigten Kummer der Verleger —, ganze Seiten oder gar Kapitel zu streichen und neu zu schreiben. Dadurch entstehen hohe Korrekturkosten, die oft unnötig wären, wenn Verfasser und Lektoren vorher das Manuskript genauer überarbeitet hätten. Es hilft nichts, wenn sich ein Autor auf Balzac beruft, dessen Korrekturfahnen wie Schlachtfelder aussahen. Nicht jeder ist ein Balzac! Stefan Zweig, der gern einschneidende Änderungen an den gedruckten Korrekturen vornahm, hatte dann auch mit seinem Verleger, Anton Kippenberg, dem Inhaber des Insel-Verlages, das Abkommen getroffen, daß er alle Kosten für nachträgliche Korrekturen selber zahlte.
Wie dem auch sei: für den Dichter beginnt in diesen letzten Augenblicken der Kampf mit der Sprache. Immer wieder tau-
chen Zweifel auf, und nicht selten wohl mag der Schriftsteller mutlos werden und den ganzen Wert seiner Arbeit in Frage stellen. Seit langem mit seinem Stoff tief verbunden, zu nahe noch allen Wirrnissen und Geschehnissen seiner erdichteten Welt, die doch für ihn eine überdeutliche Wirklichkeit ist, hat er nun nicht immer den nötigen Abstand, die klare, unparteiische Distanz zu seinem Werk.
Nachdem der Verfasser die Korrektur gelesen hat, seine Berichtigungen oder Änderungen vom Setzer ausgeführt sind und der Hauskorrektor des Verlages den gesamten Satz noch einmal auf Druckfehler überprüft hat, erhält die Druckerei die Anweisung, die Fahnen zu „umbrechen“, das heißt, die langen Satzspalten auf die Größe der Buchseite zu bringen Der „Umbruchabzug“ wird nochmals vom Verfasser und auch von den Lektoren gelesen, denn jetzt schleichen sich neue „Druckfehlerteufel“ in den verschiedensten Maskierungen ein. Da werden ganze Seiten verwechselt oder einzelne Zeilen „verhoben“, so daß sie nun irgendwo an einer falschen Stelle stehen usw. Wenn diese letzte Station — „Revision“ genannt — durchlaufen ist, kann mit dem eigentlichen Druck begonnen werden. Sind erst einmal die großen Maschinen, die 16 oder 32 Seiten in einem Arbeitsgang drucken, angelaufen, dann ist es zu spät für jede weitere Überlegung, denn nun rollt Bogen auf Bogen über die Maschinen, die gewissenhaft und getreu nur das drucken, was Verfasser und Verleger „imprimiert“ — „es werde gedruckt“, bedeutet dieses vom Verleger gegebene Placet — haben!
Die Druckbogen kommen zur Buchbinderei, wo sie gefalzt, zu Buchblocks zusammengestellt und gebunden werden. Da das Buch ein „Kleid“ haben muß, bekommt es einen „Schutz- umschlag“, der von einem Graphiker entworfen ist. Diese Aufgabe fällt zum Teil in das Aufgabengebiet des „Herstellers“, das ist derjenige Mann im Verlag, der die gesamte technische Herstellung des Buches betreut: ein wichtiger Mann, dessen Arbeit oft nicht genügend gewürdigt wird, den man aber immer dann verantwortlich macht, wenn irgend etwas schief geht, und dem die Lektoren und Drucker gern alles in die Schuhe schieben, wenn es einmal „Pannen“ gibt.
Ist das Buch fertig, dann beginnt für den Verleger die schwierige Arbeit der Propaganda, der Werbung, denn der neue Roman soll ja auch verkauft werden. Er soll in der Presse Beachtung finden und möglichst gute und ausführliche (bitte: lobende!) Kritiken erhalten. So ausgerüstet, erscheint dann eines Tages das neue Buch in den Schaufenstern der Buchhandlungen, und so gelangt es zu ihm, für den alle Mühe auf gewendet wurde: zum Leser.