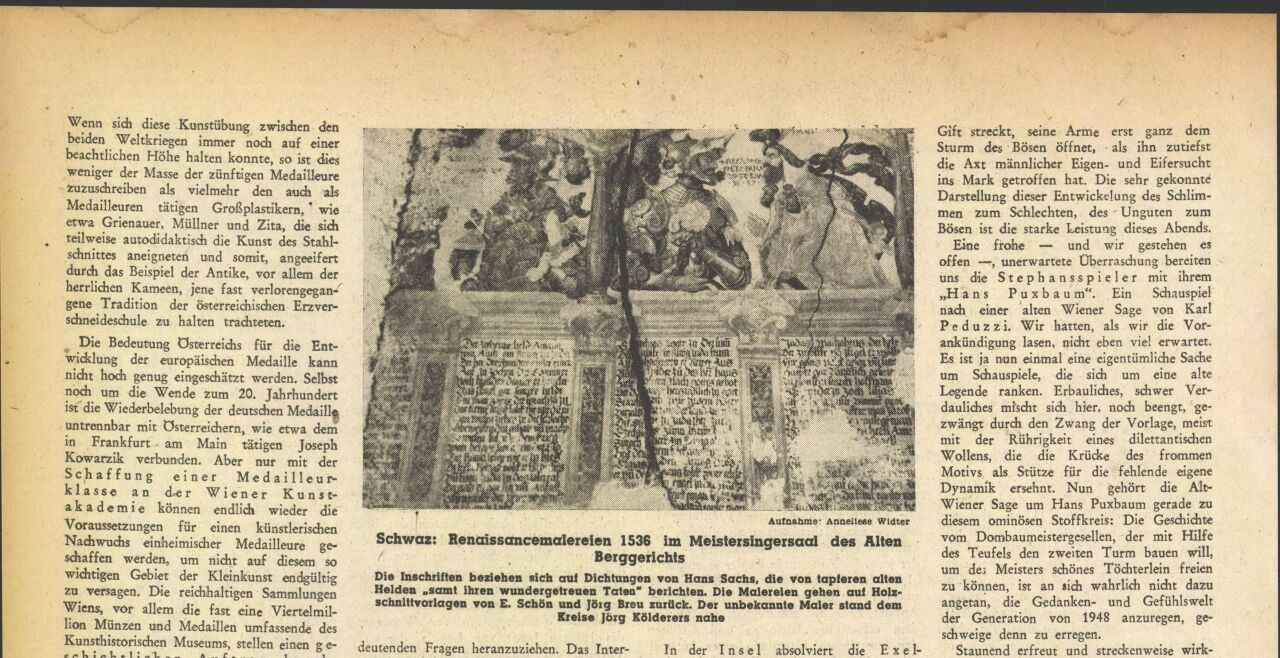
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wiener Bühnen: Jugend und Experimente
Das „Theater der Jugen d“, bekannt durch seine rührigen Anstrengungen Jugend und Theater, Jugend und Kunst einander nahe zu bringen, besitzt eine eigene Spielgruppe der Abteilung „Jugend spricht zur Jugend". Nun hat sich diese als eine „Bühne j u n g t r Menschen“ konstituiert und sich den bescheidenen Titel „D 3S Experiment“ gewählt; sie will kein Laientheater und keine Dilettantenbühne sein, möchte vielmehr der Selbsterziehung und unmittelbaren Begegnung junger Menschen mit dem Kunstwerk dienen. In einer Sondervorführung in der Insel spielten diese jungen Leute Hugo von Hofmannsthals „Der Tor und der Tod“ und Josef Gregors dramatische Ballade „Der Ackermann aus Böhmen“. Beide Aufführungen waren bemerkenswert und interessant, weil sie einen Einblick in die heutige mentale Situation einer neuen jungen Generation boten. Vor 15 und 20 Jahren, nicht mehr vor 10 Jahren, spielten Gymnasiasten und Jugendliche von 17, 18 Jahren Hofmannsthals früh- und überreife Elegie mit jener dekadenten Verfeinerung, mit jener sensiblen hellhörigen Nervosität, die dem Stück, dem Verfasser und der Zeit selbst eignen. Nichts davon ist geblieben; diese Jugendlichen von 1948 — und schon jene vielfach von 1938 — sind „primitiver“, „linearer", „barbarischer“
— wenn man dies Wort ursprungnah ohne schlechten Beiklang nimmt —, aber auch robuster, gesünder, stärker. Dabei kann man freilich diese letzteren Attribute nicht nur als Aktivposten verbuchen. Vieles ist unleugbar verlorengegangen — an seelischer Differenziertheit, an Polyphonie, an Vielstimmigkeit des Seelischen '—, manches wurde doch auch gewonnen: Eine schlichte Kraft, eine Wärme und naiv-starke Geradheit, vielleicht auch ein neues Vertrauen und eine verborgene Gläubigkeit. Jedenfalls: Das Spiel um Hofmannsthals verdämmernde Figuren zerbrach völlig. Nichts, gar nichts von seiner Atmosphäre, vom Zauber Hofmannsthals blieb erhalten. Dafür erblühte Josef Gregors problematische Ballade (problematisch schon deshalb, weil sie das berühmte frühhumanistische Streitgespräch des . Johannes von Saaz in eine ganz andere, fremde Welt transponiert) zu einer eruptiven, von innerer Kraft geschwollenen Aussage elementaren Erlebens und Geschehens. Die Besitz- und Herrschgier des Ackersmanns aus Böhmen, die Sucht und Sehnsucht seines Eheweibs — der Tod selbst: Nicht schimärische Symbole, sondern lebendige, lebengärende Gesellen standen da auf der Bühne.
So hat das „Experiment“, vielleicht wider den Willen der Veranstalter, eine wichtige Prüffunktion erfüllt; es zeigt die innere Reichweite — Gesinnung und Lebensgefühl
— der neuen Jugend an, dadurch, daß es ihr Vermögen, fremde „Rollen“ nachzugestalten, aus lotet. Jugendbildner und Erzieher sollten dies nach1 drücklidi zur Kenntnis nehmen — hier ergeben sich neue Möglichkeiten nicht nur der Erforschung, sondern auch der echten Führung, Leitung und Erziehung der so sdiwie- rigen Psyche unserer jungen Generation;
Mit dieser Generation befaßt sich, von einer anderen Seite herkommend, ein Experiment der Retxaissancebühne. Fritz H a b e c k nennt sein Stück „Zwei und zwei ist v i e r“, einen „Protest auf zwei Klaviere n“. Gewollter, bewußter Anklang ans Kabarett also, dazu viel Schnoddriges und Holperndes, Brettl und Überbrettl- gemäßes, Schrilles und Schreiendes und wieder Papieren-langweilendes. Songs aus der Kiste der ersten Zwanzigerjahre. Und doch: Nein, meine Damen und Herren! Sie hatten nicht recht, als sie hüstelnd unruhig . nach zwanzig Minuten unter Aufklappert Ihrer Stühle das Theater verließen! Denn S i e ging
— das heißt uns alle ging und geht es hier wahrlich an. Allerdings — das geben wir gerne zu: Angenehm ist es nicht, die Wirklichkeit derart platt wirklichkeitsgetreu vorgesetzt, das heißt gespielt zu bekommen! Habeck gibt nämlich nichts anderes als eine Reportage vom Lebe eines jungen Menschen, der im ersten Weltkrieg geboren, den zweiten als Soldat und Kriegsgefangener überlebt und nun, ein Durchschnittsmensch, ohne große Tugenden, ohne große Laster, verzweifelt seinen Weg in eine Zukunft sucht. „Konrad Herz, ein Mensch wie viele andere“, ist von den Beamten-Bürokraten mindestens dreier Reiche registriert, numeriert, verwaltet worden und schickt sich nun, mit Hilfe eines Mädchens und nicht ganz ohne ein zages, verschämtes Hoffen auf eine gesellschaftliche Neuordung dieser alten Erde an, ein neues Leben zu beginnen. Daß diese seine beschwerlichen zaghaften Anfänge von allen Seiten von einer lemurenhaften Meute ewig gestriger Kreaturen umkläfft, umstanden sind — ist dies wirklich seine Schuld — die Schuld unserer jungen Generation, der man heute wieder von allen Seiten Prügel in die Wege wirft — nicht nur bei Fritz Habeck in der Renaissancebühne —?
Dies Stück ist also weniger, wie einige Kritiker vermeinen, zum Ansehen für die junge Generation bestimmt, wohl aber für ihre Väter. Wir plädieren sogar für Zwangsvorstellungen: Etwa am Sonntagvormittag, so wie es bekanntlich schon vor Jahren Lehr- und Schulungsstunden für unverbesserliche Verkehrssünder gab.
In der Insel absolviert die Exel- bühne ein Gastspiel mit Karl Schön- h e r r s „W eibsteufe 1“. Ilse Exl, Ernst Auer, Walter Reyer falten das große Schauspiel des bäuerlichen Pandämoniums in ein breites Gemälde der Leidenschaften aus. Es ist nicht nur das Weib allein — alle drei, Bauer, Grenzjäger und Frau (und hinter ihnen spürt man noch die fratzenhaften Schatten ihrer engen, bösartigen Umwelt) sind besessen von ihrem Herrsdi-, Geld- und Geltungswillen. Bemerkenswert jedoch, wie stark zumal Ilse Exl ihre Rolle ins Humane, ins allgemein Menschliche hinein auszufächem weiß. Ihre Bäuerin ist nicht, nur der „Weibsteufel“, sondern vor allem der Weibs-Mensch — ein starker, sturmharter Baum, der seine Wurzel erst ins
Gift streckt, seine Arme erst ganz dem Sturm des Bösen öffnet, als ihn zutiefst die Axt männlicher Eigen- und Eifersucht ins Mark getroffen hat. Die sehr gekonnte Darstellung dieser Entwickelung des Schlimmen zum Schlechten, des Unguten zum Bösen ist die starke Leistung dieses Abends.
Eine frohe — und wir gestehen es offen —, unerwartete Überraschung bereiten uns die Stephansspieler mit ihrem „H ans Puxbau m“. Ein Schauspiel nach einer alten Wiener Sage von Karl Peduzzi. Wir hatten, als wir die Vorankündigung lasen, nicht eben viel erwartet, Es ist ja nun einmal eine eigentümliche Sache um Schauspiele, die sich um eine alte Legende ranken. Erbauliches, schwer Verdauliches mischt sich hier, noch beengt, gezwängt durch den Zwang der Vorlage, meist mit der Rührigkeit eines dilettantischen Wollens, die die Krücke des frommen Motivs als Stütze für die fehlende eigene Dynamik ersehnt. Nun gehört die Alt- Wiener Sage um Hans Puxbaum gerade zu diesem ominösen Stoffkreis: Die Geschichte vom Dombaumeistergesellen, der mit Hilfe des Teufels den zweiten Turm bauen will, um des Meisters schönes Töchterlein freien zu können, ist an ich wahrlich nicht dazu angetan, die Gedanken- und Gefühlswelt der Generation von 1948 anzuregen, geschweige denn zu erregen.
Staunend erfreut und streckenweise wirklich ergriffen folgen wir jedoch dem Spiel, das sich hier begibt. Es ist das Spiel einer Jugend, das zu packen weiß, weil es mit echter Leidenschaft und starkem schauspielerischem Ausdrucksvermögen wirkliches Leben gestaltet. Um es vorwegzunehmen: Es kommt kein metaphysischer Teufel vor, kein Teufel auch der Legende. Die Teufel sitzen hier alle in der Brust lebensvoller, ja lebenstoller Erdenmenschen; zutiefst in jener des Herrn Dombaumeister Prachatiz. Samuel, der hinkende genialische italienische Baugeselle, der des Teufels irdisches Kleid trägt, ist mit Buckel, Klumpfuß und Hahnenfeder ein schwer gezeichneter, hochbegnadeter Sohn des höchsten Meisters. — Dies Spiel ist wirklich sehenswert. Das Absinken des Schlusses geht auf Kosten des Dichters, nicht der Schauspieler. Popp, Pekny, Köll — eine wirklich mitreißende Ensembleleistung, der sich der junge Schweizer Gast — Margarete
Lendi — erfreulich stark im- eigenen Ton einfügt.
Audi dies ein Experiment der Jugend; ein glänzend geglücktes.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































