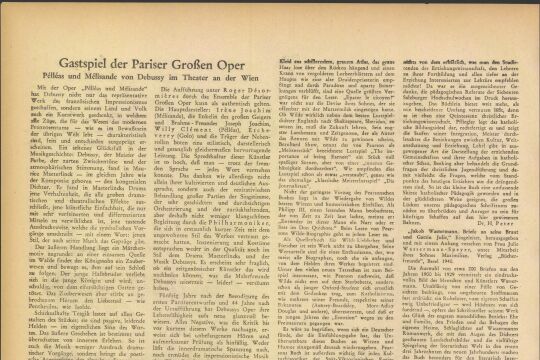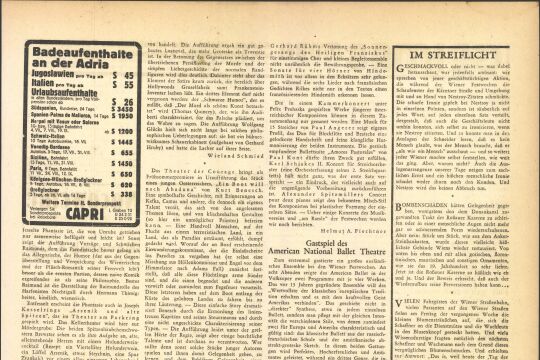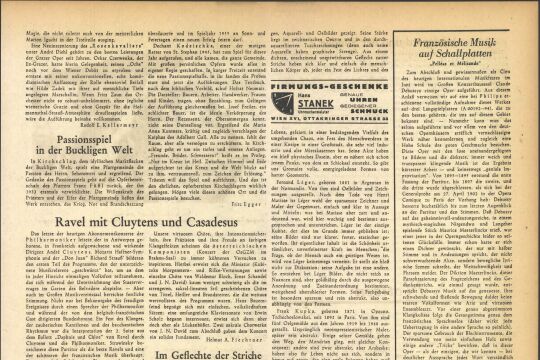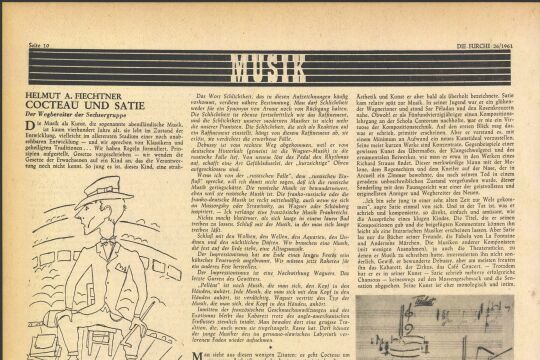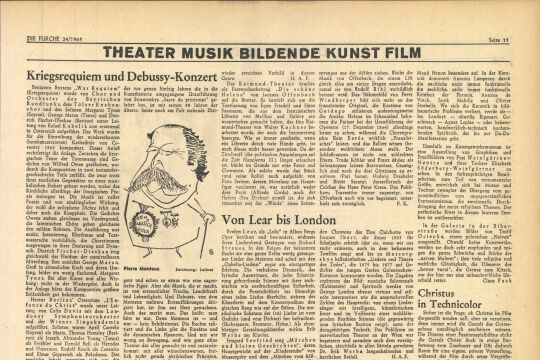Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wir wollen Farben nicht, nur Schatten
Clau.de Debussys Oper „Pelleas et Melisande“. eines der Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, hat nicht nur eine merkwürdige Entstehungsgeschichte, sondern auch ein sehr eigentümliches Büh-nenschicksn! 183 sah Debussy-in einem kleinen Pariser Theater, der ..Maison de l'Oeuvre“ (das übrigens auch Ibsen in Frankreich durchsetzte), das Stück eines fast gleichaltrigen flämischen Dichters: Maurice Maeterlincks, des späteren Nobelpreisträgers Drama „Pelleas et Melisande“. Kurz vorher hatte er das Buch gegekauft und sofort erkannt, daß er hier in Händen hielt, wonach er immer schon gesucht hatte: eine Tragödie ohne Pathos und ohne dramatische Explosionen, passive Helden (im doppelten Wortsinn), Andeutung statt Dialektik, verhaltene Stimmung statt effektvoller Schwarzweißzeichnung, vor allem aber jenen poetischen Märchen- und Legendenton, den die Oper, wie er sie träumte, haben mußte. Für dieses Stück wie für die Musik, die er später dazu schrieb, gilt die in den berühmten Versen Verlaines definierte Kunstanschauung: ..Wir wollen Farben nicht, nur Schatten, den leisen, feinen Übergang, die Schwingungen, den halben Klang, daß Träume sich mit Träumen gatten.“
Noch im gleichen Jahr (1893) begann der dreißigjährige mit der Komposition, aber nach einigen Wochen vernichtete er das Niedergeschriebene, weil er sich — der schon ein beachtliches, keineswegs epigonales Oeuvre geschaffen hatte — immer noch nicht im Besitz jener Zauberformel, jener geheimnisvollen Alchimie wußte, mit deren Hilfe das absolut Neue in der Musik, wie sie ihm vorschwebte, zu schaffen war. Im Frühjahr 1895 war die erste Fassung von „Pelkas et Melisande“ beendet. Aber noch weitere sieben Jahre arbeitete Debussy an der Musik — bis er sie zur Aufführung freigab, die am 30. Mai 1902 in der „Opera comique“ stattfand, mit dem unermüdlichen Andre Messager am Pult und Mary Garden in der Titelrolle, deretwegen es zu einem höchst betrüblichen Zerwürfnis zwischen Debussy und Maurice Meater-linck gekommen war. — Die Premiere verlief deprimierend, die Kritik war geteilt, aber das Publikum zeigte Interesse: Innerhalb weniger Wochen finden sieben Aufführungen statt, und auch für die folgende Saison kann die neue, auch ein wenig von Skandal umwitterte Oper auf den Spielplan gesetzt werden. Einer der Kritiker, Gaston Garraud, hatte erkannt, daß die französische Musik, naV/dqnExiessen 'er Romantik, in Debussys „PcITeas“ - wieder ein klassisches Meisterwerk erhalten hatte, das sich dvch K'arheit, Sicherheit des Geschmacks, Takt. Sinn für Proportionen .gezügelte Leidenschaft, Fehlen von Übertreibungen jeder Art, völlige Abwesenheit von Schwulst und grobem Effekt auszeichnete.
In der Tat ist Debussy mit dieser Partitur, an der er noch während der Proben herumfeilte und deren zauberhafte Zwischenspiele in kürzester Zeit, gleichfalls während der Bühnenproben, entstanden sind, etwas gelungen, das man in Frankreich bald als typisch französisch erkannte und akklamierte. Im Ausland konnte sich „Pelleas et Melisande“ nicht so leicht durchsetzen, nicht zuletzt wegen der Gebundenheit von Debussys Musik an den französischen Text, dessen Rhythmus, Diktion und Sprachmelodie sich die melodische Linie so überaus eng anschmiegt. Diese Oper hat nämlich weder Arien noch Ensembles, sondern besteht in ihrem vokalen Teil aus einer Folge von Rezitativen, in denen die kleinen, der Wortmelodie des Französischen entsprechenden Intervalle durchaus vorherrschend sind. Im Orchester dominieren vielfach geteilte Streicher und solistisch behandelte Holzbläser, während das Blech nur an wenigen Stellen „massiver“ eingesetzt ist und das auf leise murmelnde oder diskret grollende Pauken beschränkte Schlagwerk — in vielen modernen Werken zur vierten Großmacht avanciert — kaum eine Rolle spielt. — Das Sujet selbst, märchenhaft und mit jenet ..künstlichen Einfachheit“ gestaltet, die e! Debussy von allem Anfang an angetan hatte, bot keine Schwierigkeit: An einer einsamen Quelle im Wald findet der Königssohn Golo ein Märchenwesen, das er bewegt, ihm auf sein Schloß zu folgen. Der junge Halbbruder Golos. Pelleas. verliebt sich in die junge Königin Meüsande und wwd, unschuldig, von deren Gatten getötet. Das Zauberwesen aber stirbt an gebrochenem Herzen, betrauert von dem uralten König Arkel und Genevieve, der Mutter der feindlichen Brüder.
Die Wiener Premiere fand erst 1911, und zwar unter Bruno Walter, statt. Immerhin erlebte Debussys Werk in jener ersten Wiener Inszenierung zwölf Reprisen. Dann gab es eine lange Pause, bis zum Gesamtgastspiel der Kölner Oper 1928. Zuletzt wurde „Pelleas et Melisande“ im November 1946 von einem Ensemble der Pariser Oper unter Roger Desormieres im Theater an der Wien dreimal gegeben. — Nun hat Herbert von Karajan das kostbare Werk aufs Programm gesetzt und unter eigener musikalischer Leitung und Regie, trotz der bekannten Schwierigkeiten mit dem technischen Apparat, herausgebracht. Karajan wollte für die Musik ein optisches Äquivalent schaffen und ließ sich von dem jungen deutschen Bühnenbildner Günther Schneider-Siemssen Kulissen und Projektionen anfertigen, die den Eindruck des traumhaft Entrückten vermitteln sollen. Das tun sie auch, zumal zwischen die Bühne und den Zuschauer noch ein — leider unschöne Falten werfender — Schleier gespannt ist, der allerdings nicht nur die Farben, sondern auch die Stimmen dämpft. So können wir, trotz des anerkennenswert guten Französisch, das von allen Sängern zu hören war, keineswegs bestätigen, was an dieser Stelle über das Gastspiel der Pariser Oper („Die Furche“ vom 16. November 1946) geschrie-bei wurde: daß nämlich, trotz der für uns fremden Sprache, jedes Wort verständlich war. — Hierauf hat Debussy nämlich bei der Führung der Singstimmen und der stets transparenten Orchestrierung peinlich genau geachtet und einen hundertprozentigen, von keinem anderen Komponisten auch nur annähernd erzielten Erfolg errungen. Die Besetzung kann als erstklassig bezeichnet werden, und auch in ihreT Erscheinung entsprachen die von Georges Wakhewitsch eingekleideten Gestalten durchaus der Vorstellung, die man sich von ihnen macht: in den beiden Titelrollen Henri Gui und Hilde Güden, Niecola Zaccaria (Arkel), Elisabeth Höngen (Genoveva), Eberhard Wächter (Golo), der kleine Yniold (Adriana Martino) und ein Arzt (Alfred Poell).
Zu agieren gab's in den 13 episch angelegten Szenen, die durch kurze Zwischenspiele verbunden sind, nicht eben viel. Trotzdem passierten der Regie einige Ungeschicklichkeiten. So sollte zum Beispiel dem Pelleas an einer der poetischesten Stellen („Je vois une rose dans les tene-bres“) nicht gestattet werden, über die Bühne zu schlendern; das nicht vorhandene, im Text genannte Fenster in rjer Balkonszene; Melisandes Goldhaar, das die auch unglücklich Gewandete zunächst wie ein Bündel vor sich herträgt u. a. Fast alle Bilder waren dunkel, die vorherrschenden Farben ein gräuliches Blau und Schwarz; nur die Kostüme schufen Kontraste. Und immer wieder: Schleier. Das ist zwar stimmungsvoll, aber auf die Dauer ermüdend. Es wäre nämlich auch ein ganz anderer Inszenierungsstil denkbar: eine verkleinerte, sezessionistisch gerahmte und ausgestattete Bühne, mehr Licht, lebhaftere Farben, klare Formen: eben wie in Mär-chenbildem, die ja auch nicht dunkel, schleirig und verschwommen sind ...
Keinen Einwand, sondern nur höchstes Lob kann es für den orchestralen Teil dieser Aufführung zu Beginn des Debussy-Jahreä 1962 geben Schon die Interpretation der drei Nocturnes und von „La roer“ durch Karajan ließ Bestes erwarten. Aber hier, bei der Wiedergabe der „Pel-leas“-Partitur, bewährte sich sein unwahrscheinlich sensibler Klan?sinn, sein Gefühl für schwebende Übergänge, seine Genauigkeit und Deutlichkeit im Detail vielleicht noch glänzender. An dieser mustergültigen Wiedergabe der Meisterpartitur Debussys hat das Orchester der Philharmoniker, das zauberhaft zart und klaneschön spielte, seinen wohl-eemessenen Teil. Viele Vorhänge vor der Pause und lananhaltender Beifall am Schluß.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!