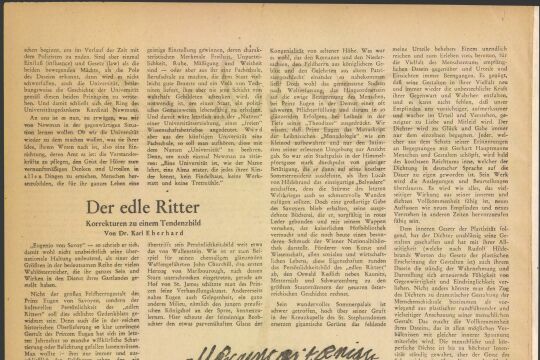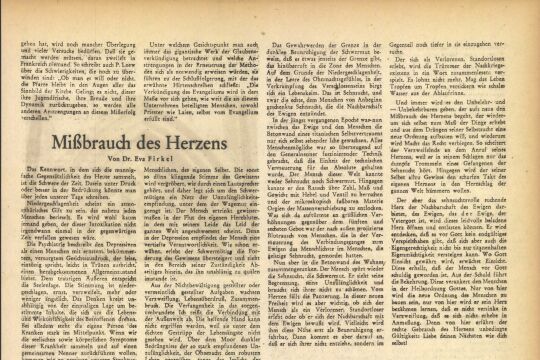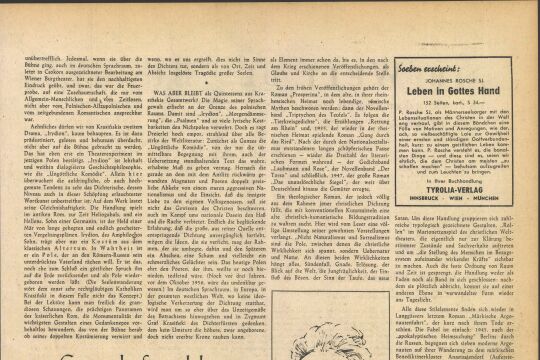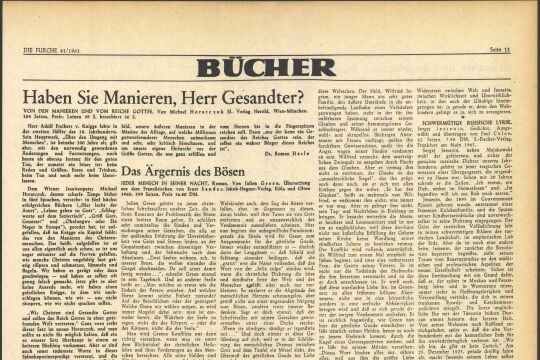Als George Saiko zu Weihnachten 1962 starb, war nur ein kleiner Kreis vom Rang dieses österreichischen Autors überzeugt. Saiko hatte noch wenigstens knapp vor seinem Tod die Genugtuung, durch die Verleihung des österreichischen Staatspreises von seinem Vaterland gewürdigt zu sein. Dann wurde es still um den legitimen Nachfahren in der glanzvollen Reihe österreichischer Epik von Musil, Broch, Kafka bis zu Gütersloh und Doderer.
Es ist kaum zu glauben, aber Saikos Werk hat heute keinen Verleger. Niemand hat sich bis jetzt gefunden, um sein Hauptwerk „Auf dem Floß“, einen der wenigen großen österreichischen Romane, neu herauszubringen — die alte Auflage wurde von einem verständnislosen Verlag verramscht. Lediglich in einer polnischen und demnächst in einer italienischen Übersetzung findet dieses Zeugnis großer Epik seine Leser.
Auch die Literaturwissenschaft hat sich bisher nur zaghaft George Saikos angenommen. Nur einige wenige kleine Aufsätze wurden über sein Werk veröffentlicht. Es besteht aus den beiden Romanen „Auf dem Floß“ (1954) und „Der Mann im Schilf“ (1956), sowie den beiden, im Jahre 1962 erschienenen Novellenbänden „Giraffe unter Palmen“ und „Der Opferblock“. Einige Novellen und Aufsätze liegen noch ungedruckt vor.
Der aus dem nordböhmischen Raum der Monarchie gebürtige Autor, in Wien Schüler des großen österreichischen Kunsthistorikers Max Dvorak und selbst durch Forschungen zur österreichischen Barockkunst bekanntgeworden, steht auch im Rahmen einer großen österreichischen Erzählertradition, ja knüpft bewußt an sie an. Sehr spät erst, nach einer Beschäftigung vorwiegend mit geistes- und kunstwissenschaftlichen Fragen, ist dieser Durchbruch zum Roman mit dem Werke „Auf dem Floß“ erfolgt, zweiundzwanzig Jahre nach Brochs „Schlafwandler“-Trilogie und achtzehn Jahre nach Musiis Romanfragment „Der Mann ohne Eigenschaften“. Auf diese beiden bahnbrechenden österreichischen Erzähler hat sich auch Saiko ausdrücklich berufen.
Im Jahre 1956 veröffentlichte Saiko den Roman „Der Mann im Schilf“, dessen Stoff aus der unmittelbaren Vergangenheit Österreichs genommen ist: aus dem bewegten Jahr 1934, in dem der nationalsozialistische Putsch seine Wellen in ein Salzburger Dorf wirft. Hier sind es politische Motive, die sich in die einzelnen Individuen, also ins Persönliche hinein, verästeln, dadurch eigentlich unkenntlich werden, verzerrte Spiegelungen des Unbewußten, der aufsteigenden Triebe — auch das in jener Erzählertradition und mit den neuen Mitteln dargestellt, die unser Zeitalter der Entdeckung der menschlichen Seele zur Verfügung stellt und die schon Musil und Broch der Literatur dienstbar gemacht hatten.
Von der „Sehlafwandler,c-Trilogie sagt Saiko, daß es Brochs Hauptabsicht bei diesem Werk im Sinne Freuds war, „das Ungesagte sagbar, das noch Unausgedrückte ausdrückbar zu machen, das Irrationale als solches zu formulieren, es in die Bewußtheit zu heben, um ihm den Stachel der Bedrohung zu nehmen“ (in dem Aufsatz „Zur Erneuerung des Romans“, 1955). Das bedeutet nun nicht den Rückfall in einen neuen Rationalismus. Die vielfältigen Erscheinungen des menschlichen Seelenlebens sollen nicht etwa vernünftig und formelhaft aufgelöst, erklärbar, überschaubar gemacht werden. Saikos „magischer Realismus“ will vielmehr allein der Dichtung dienen. Ihr soll der ganze Reichtum an Motiven erschlossen werden, die sich aus den Erkenntnissen der modernen Tiefenpsychologie ergeben.
Die Themen des „magischen Romans“ sind also nach Saiko „die effektiven Vorstellungen und Vorstellungsverbindungen, das Triebhafte, die subjektiven Symbolbildungen, kurz die vorbewußten, eigentlich gestaltenden Kräfte, die im Dasein des einzelnen eine so entscheidende Rolle spielen. Die Aufgabe des Künstlers aber ist es, zu zeigen, wie dieses Agens der Tiefe', wie die untergründigen, hintergründigen Mächte durch die' oberste Konventionsschicht hindurchbrechen und zum Konflikt mit ihren Instanzen die eigentliche Ursache beisteuern“.
*
In dem Roman „Auf dem Floß“ hat Saiko seine hochgespannten Forderungen realisiert, als Dichter konkret gemacht. In dem Roman „Auf dem Floß“ geraten wir in eine Atmosphäre hochfeudalen Gutsbesitzes. Der „Fürst“ ist ein Souverän über sein Gesinde, und seine Herrschaftsform mutet angesichts der zeitlichen Festlegung des Geschehens in die ersten Jahre der Republik anachronistisch an. Aber Saikos Anliegen ist es ja gar nicht, einen Zeitroman zu geben. Sein eigentliches Thema ist das der menschlichen Beziehungen und ihrer Erhellung aus dem Unbewußten und Unterbewußten.
Zu diesem Zweck untersucht Saiko die Gesellschaft zunächst in der Vertikalen, im Herren-Diener-Verhältnis. Der Diener Joschko, die Hauptperson des Romans, dem allein zwölf der vierunddreißig Kapitel gewidmet sind, stellt in der Halle des fürstlichen Schlosses, angetan mit einem langen verschnürten Mantel, einem hohen Dreispitz und einem goldenen Stab, eine Art von monumentalem Portier dar. Er ist auf geheimnisvolle, nur noch tiefenpsychologisch deutbare Weise mit seinem Herrn verbunden: „Wenn Joschko in der Nähe Seiner Durchlaucht steht und nur die Hand auszustrecken brauchte, um ihn zu berühren, ist es ein banges Gefühl von Sicherheit, der Schutz, der von Joschko ausgeht und sich auf Seine Durchlaucht erstreckt, aber dennoch zurückwirkt und nun Joschko erfaßt. So, als ob beide sich wechselseitig hielten.“
Hier ist mit den Mitteln der Tiefenpsychologie eine zwischenmenschliche Verbindung deutlich gemacht, die innigste zwischenmenschliche Verbindung, die der Roman überhaupt aufweist, eine Art von Symbiose, die durch das Dazwischentreten Dritter zerstört wird. Damit ist der vordergründige Handlungsstrang des Romans gegeben: die großartige Menschlichkeit dieses Herren-Diener-Verhältnisses ist für die kleinen, bösen Seelen ringsum nicht mehr erträglich. Vor allem nicht für die Zigeunerin Marischka,' die vom Fürsten abgelegte Geliebte, von ihm mit Joschko verheiratet, zerissen von Haßliebe zum Fürsten, vom Haß gegen Joschko, rastlos in ihren Intrigen, hemmungslos in ihrer Leidenschaft. Ihr Gift wirkt langsam auf den bärenstarken Joschko, aber es wirkt. Allmählich stirbt er dahin, sein Todeskampf zieht sich durch mehrere Kapitel und es ist der Trost seiner Sterbestunde, daß der Fürst ihm verspricht, ihn nach seinem Tode im Glaskasten der Halle hinter der Portierloge aufstellen zu lassen.
*
An dieser Stelle muß man sich in Erinnerung rufen, was Saiko zur Theorie des „magischen Realismus“ im Roman gesagt hat. In seinem Aufsatz „Die Wirklichkeit hat doppelten Boden“ spricht er davon, daß das unerschöpfliche Thema des Romans die affektiven Vorstellungen und Vorstellungsverbindungen seien, „das Triebhafte, die subjektiven Symbolbildungen, kurz, die vor- und unibewußten, eigentlich gestaltenden Kräfte, die im Dasein des einzelnen eine so entscheidende Rolle spielen: die Auslöser jener Oberflächenrealität, in der das Triebhafte... in Sprache und Geschehen umgesetzt wird“.
Um eine solche „Symbolbildung“ handelt es sich hier. Die posthume Erhöhung Joschkos, dieser makabre Scherz eines mumifizierten Weiterlebens nach dem Tode, bleibt zwar im Zustand des Plans und kann nie Realität werden. Aber es ist eine, wenigstens gewünschte, Oberflächenrealität, die aus der seelischen Tiefe des Fürsten herausdrängt: „Mit einer lähmenden Gewißheit stieg es in ihm auf, daß er über das Lebendige niemals Gewalt haben würde. Ja, man mußte den Dingen das Leben nehmen, damit sie einem völlig zu eigen wurden. Und unwillkürlich sah er Joschko an Stelle des ausgestopften Wisent im Glasgehäuse paradieren,“ Dieser Trieb, sich selbst auszudehnen, Joschkos Gestalt in sich hineinzunehmen, sich sozusagen in Joschko darzustellen, verbindet Sich mit dem Versuch einer Kaschierung der eigenen menschlichen Unzulänglichkeit, eines persönlichen Versagens, einer Beruhigung des Gewissens. Denn der Fürst selbst war es ja, der Joschko das Zigeunerweib Marischka zum Geschenk machte und damit Joschko mittelbar ins Verderben stürzte.
Die posthume Erhöhung Joschkos durch seine Ausstopfung würde außerdem seine Ermordung rückgängig machen. Daraus entsteht für Marischka die Notwendigkeit, ihn sozusagen noch einmal zu töten. Sie versenkt seine Leiche, die nach dem Plan des Fürsten im Glaskasten zu einem neuen, einzigartigen Leben erwachen sollte, im Sumpf und macht damit den Plan des Fürsten unausführbar. Denn der ausgestopfte Joschko wäre für Marischka ein unerträgliches Symbol, ein Symbol des Triumphes über sie selbst. Nach diesem zweiten Mord entflieht sie und läßt den Fürsten vor dem leeren Glaskasten zurück, in einer furchtbaren Einsamkeit, in die ihn seine Niederlage warf. Er hatte vergeblich versucht, einer einzigartigen menschlichen Kommunikation Dauer zu verleihen. Und am Ende steht er nun dort, wo er schon zu Anfang des Romans stand: „Wozu sind wir als einzelne überhaupt noch imstande? Wir haben exzelliert in individuellen Abspaltungen, wir sind zerbröckelt in Nuancen, so schwierig zu fassen von jedem andern und erst recht von uns selber, daß uns die Hauptsachen längst zwischen den Fingern zerstäubt sind. Wo gibt es eine Magie, die uns betete und einander verbände, auf daß die Einsamkeit wieder ein Heeres Wort würde und die Angst ein belächeltes Schemen?'“
*
Mit der Joscbko-Handlung ist allerdings nur ein Teilaspekt des Romans gegeben, der in der sozial Vertikalen. Dem Herren-Diener-Verhältnis steht noch ein sozial horizontales, also im Standesniveau bleibendes Beziehungsverhältnis zwischen dem Fürsten und der schönen Nachbarin, Mary von Tramblaye, der Frau mit der bewegten Vergangenheit, und ihrer Kinder, des sechzehnjährigen Mick und der achtzehnjährigen Gise gegenüber. Hier tritt die handfeste Handlung zugunsten der Seelenstudie zurück: Die in der Abenddämmerung des Lebens stehende Frau, die ein spätes Liebesglück sucht und die tief in ihrem Pubertätstrauma steckenden Kinder, nur einig darin, daß sie über ihre Mutter zu Gericht sitzen.
Wir geraten hier, um in den Dimensionen und Traditionen des österreichischen Romans zu sprechen, in eine späte Schnitzlerwelt. Das Neue gegenüber Schnitzler ist aber der viel fruchtbarere und zielbewußtere Einbau des Unbewußten. Saiko kann auf diese Weise ein Feuerwerk von Nuancen spielen lassen, in dem Gegeneinander der Figuren, in der Auseinandersetzung, obwohl der Dialog selbst sparsam verwendet wird und mehr zwischen den Zeilen steht. Und doch ist Saikos Roman viel weniger monomanisch, als Musils „Mann ohne Eigenschaften“, das Gewicht liegt überhaupt weniger auf die Seele, als auf der Harmonie oder der Dissonanz der Seelen und ihrer Instrumentierung aus dem Unterbewußten.
Das Unterbewußte wurde in diesen Seelenlandschaften sichtbar gemacht, um den ganzen Menschen, um seine ganze Wirklichkeit zu zeigen. Saiko ist Realist, er zeigt den Menschen so, wie er ist, er zeigt ihn aber auch in seinem ganzen Elend. Auch das Unbewußte ist kein HeümitteL von dem etwa die Erlösung zu haben wäre, es ist nur ein Teilaspekt des seelischen Bestandes „Mensch“. Das Irdische, diese unsere Welt, hat überhaupt kein Mittel, keine Magie bereit, durch die der Mensch zu erlösen wäre. Es gibt im Diesseits nur Täuschungen, nur Ersätze, nur Triebbefriedigungen und Schuldgefühle, nur einen kurzen Glücksrausch und eine lange Nacht der Einsamkeit und der Furcht. Auf diesem „Floß, das ins Ungewisse treibt“, gibt es keine Illusion — und Saikos Werk birgt seinen tieferen Sinn darin, uns keine zu machen. Aber dieses eine, über die Welt Hinausweisende gibt es auch, ohne das wir in dieser so schonungslos gezeichneten Welt in ein sinnloses Nichts stürzen würden: „Am Anfang und Ende steht eine göttliche Tatsache, das Oben und Unten, zwischen dem sich alles erhebt und aus dem es sich rechtfertigt, und ohne das ist es nichts —.“ Der Sprecher dieser Worte ist der bischöfliche Bruder des Fürsten, jenes andere, in der Befreiung von irdischen Verstrickungen erfolgreichere Ich des Fürsten.
Erst wenn man diesen größeren Rahmen des irdischen Spieles hinzudenkt, kann man das Leben „Auf dem Floß“ ertragen, an das wir gekettet sind und das uns dazu zwingt, eine Gemeinschaft zwischen uns Menschen zu bilden, die, so unvollkommen sie auch ist, die Aufgabe hat, daß sie — wieder mit den Worten des Dichters —, „tätig und voller Zuversicht die Gestalt des Lebens vermehrte und intensiver machte und die Unvollkommenheit jener Verwirklichung nicht als lähmende Schranke empfand'1.