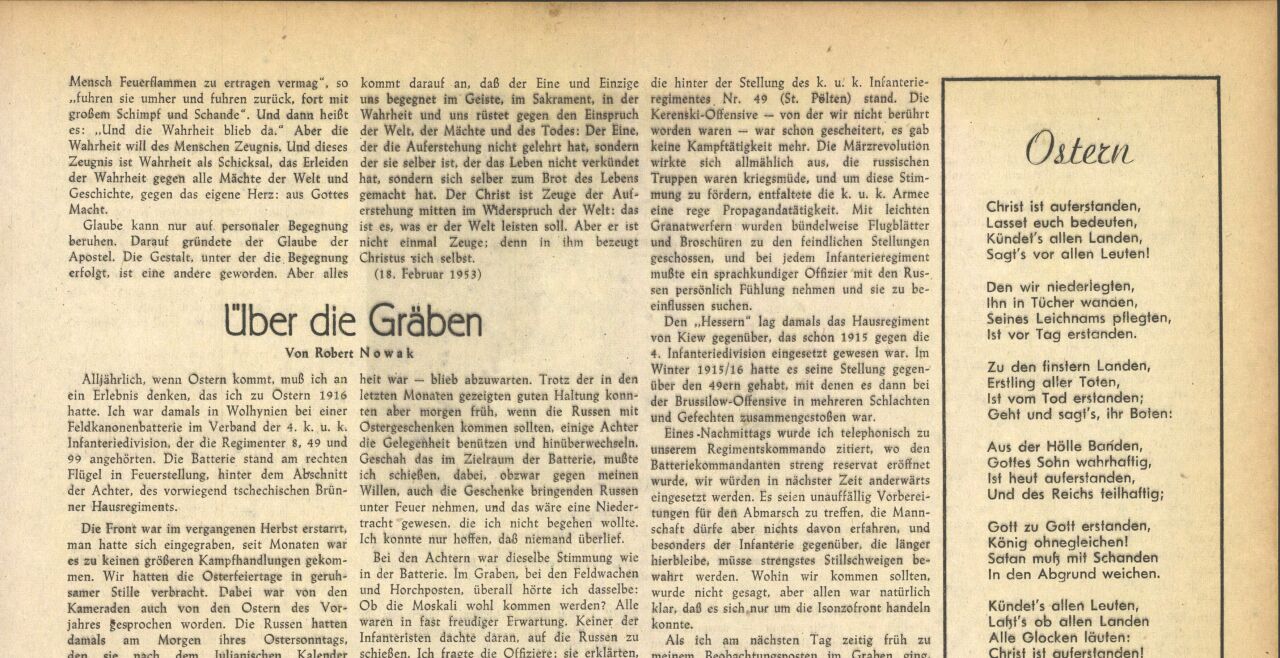
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zdisslawitz
Wer mit Einzelheiten aus dem Leben Marie von Ebner-Eschenbachs vertraut ist, kennt den Namen. So heißt ein kleines mährisches Dorf, das aus zwei kurzen, senkrecht aufeinander zulaufenden Straßenzügen besteht und an dessen Ende ein altes, inmitten eines stillen, verträumten Parkes befindliches Schloß liegt. Hier hat sie am 13. September 1830 das Licht der Welt erblickt und mir, als dem Sohn ihres ältesten Bruders, wurde, genau auf den Tag um 5 3 Jahre später, das gleiche Los zuteil. So kam es, daß ich nicht nur unter ihren Augen aufwuchs und bereits meine ersten Eindrücke unzertrennlich mit ihr verknüpft sind, sondern daß sie und mich, neben unzähligen anderen, auch die gleiche Liebe zu' diesem unserem gemeinsamen Vaterhaus verbunden hat.
Das Schloß ist ein langgestrecktes, einstöckiges, hufeisenförmiges Gebäude, an dessen Hofseite zwei Marmorlöwen den Abschluß einer auf das Dorf zu führenden, doppelreihigen, mit mächtigen alten Bäumen bepflanzten Lindenallee bilden, während die Vorderfront, die ein unter einem Giebel vorspringender, von Säulen getragener Vorbau schmückt, über einen kleinen Teich mit einem leise plätschernden Springbrunnen hinweg in ein welliges, von Feldern übersätes Hügelland blickt... einen Ausläufer der fruchtbaren Hanna, die sich von hier aus bis zu einem stattlichen, in der Ferne bläulich schimmernden Gebirgszug, dem Marsgebirge, erstreckt.
All diesem vermochte selbst das Jahr 1945 nichts anzuhaben.
Wie aber sieht es nun im Inneren des Schlosses aus?
Seinerzeit waren die hellen, hohen und geräumigen Zimmer mit den spiegelglatten Parketten und den unzähligen Bildern an den Wänden, vorwiegend im Empire- oder Biedermeierstil, also mit jener anheimelnden Rückständigkeit eingerichtet, die Dauer im Wechsel zumindest vortäuscht. Besonders eines von ihnen — der gerade in der Mitte des Hauses gelegene große Saal — war bemerkenswert. Ihn hatte kein Geringerer als Winterhalter verziert und hier, vermittels der sogenannten illusionistischen Wandmalerei, die mit Hilfe von perspektivischen Verkürzungen und Ueberschneidungen die Wandflächen dem Scheine nach zu einem dreidimensionalen Raum erweitert, ein echtes Kunstwerk geschaffen.
Wenn ich heute, nach so vielen Jahren, auf meine dort verlebte Kindheit zurückschaue, so kann ich es keineswegs als verwunderlich bezeichnen, daß die so tiefgreifenden politischen Ereignisse der letzten Jahre auch vor dem Zdis-slawitzer Schloß nicht haltgemacht, sondern es so grundlegend gewandelt haben, daß innerhalb seiner Mauern nicht einmal mehr die leiseste Spur des Einstigen, Vergangenen zurückgeblieben ist. Wofür ich aber vergebens eine Erklärung suche, ist: Wohin sind die Menschen von damals gekommen? Ich meine die Einheimischen, die Bodenständigen, die Dorfbewohner .. . natürlich nicht sie selbst in eigener Person, denn die meisten von ihnen waren schon damals ziemlich bejahrt, so daß sie die Lebensgrenze längst überschritten haben müßten .. . sondern der Stoff, aus dem sie geformt waren, ihre Art, zu denken, zu fühlen . .. wohin? Alle diese einfachen, unverbildeten, ursprünglichen Menschen, die das große, so vielen anderen ewig verschlossene Geheimnis kannten, daß Zufriedenheit ausschließlich nur aus dem Innern geschöpft werden kann, weil erfüllte Wünsche immer neue Wünsche hervorrufen?
Da war beispielsweise der Bauer Jaschek. Einst einer der Reichsten im Dorf, hatte er teils infolge von Schicksalsschlägen wie Hagel, Mißernten und dergleichen, teils aber auch durch eigene Schuld, weil er das Geld aus vollen Händen um sich zu streuen pflegte, Feld auf Feld verkaufen müssen, bis sein gesamtes Hab und Gut in alle Winde, verstreut war und ihm nichts mehr blieb, wirklich nichts, außer einer alten Fiedel, auf deren Handhabung er sich seinerzeit vortrefflich verstanden hatte. Darauf besann er sich nun, lud sie sich auf den Rücken und machte sich, in der Absicht, fortan, wo es sich eben treffen mochte, den Leuten zum Tanz aufzuspielen, auf den Weg in die Fremde. Aber nicht etwa gebrochen und gebeugt, wie es woM anzunehmen gewesen wäre, sondern seelenvcr-gnügt, mit einem unverkennbaren Lachen in den Augen, so daß er bei jedem, der ihn bei seinem Auszuge aus dem Dorf begegnete, den Eindruck hervorrief, nun endlich am Ziele seiner Wünsche angelangt zu sein.
Oder die alte Tonika Duchalik, deren einziger, von ihr über alles geliebter Sohn auf Abwege geraten war, Wechsel fälschte und schließlich irgendwo in der Welt ein geheimnisvolles Ende gefunden hatte, das nie aufgeklärt worden ist. Die Schuld daran schob Tonika aber nicht etwa ihm, sondern eben jener, ihr zeitlebens unbekannt gebliebenen Welt zu, die seither den Inbegriff alles Schlechten, Niedrigen und Unheilvollen für sie bedeutete.
Auf diese Weise gelang es ihr nicht nur, ihn in ihren Augen nachträglich zu entsühnen, sondern sich mit seinem Verlust auch viel leichter abzufinden, als es sonst der Fall gewesen wäre. Infolgedessen hielt sie mit einer Zähigkeit an ihrer Ansicht fest, die an Starrsinn grenzte. Die „Welt“ wurde in ihrer Vorstellung eine Stätte des Lasters und des Grauens, die jeden, der sich in sie hinauswagte, in den Abgrund ziehen mußte. Demgegenüber begann sie Zdisslawitz in einer Art Verklärung zu sehen, weil es hier
— wie sie es nicht müde wurde zu behaupten
— nicits gab außer Geborgenheit und Frieden. Und tatsächlich hat sie sich einen solchen auch erkämpft, noch dazu einen so dauerhaften und echten, daß sie sein Widerschein auch auf ihrem Totenbette nicht verließ, sondern in ihren Zügen eingemeißelt blieb, gleichsam für immer.
Natürlich gab es da auch Schattenseiten, recht düstere sogar, wie Neid. Mißgunst. Engstirnigkeit und dergleichen. Aber es war ein Dorf, das damals noch weit abseits von allen größeren Verkehrswegen log, so daß sich die Menschen, die dort lebten, eine gewisse innere Selbständigkeit bewahrten. Demzufolge hatten sie ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Wünsche und eigenen Gedanken, fühlten sich noch nicht in der Masse aufgelöst und sahen sich dadurch gezwungen, das Leben viel natürlicher und urwüchsiger anzupacken, als es sonst der Fall gewesen wäre. So haben sie Marie Ebner zu mancher ihrer Erzählungen angeregt und sind aus ihrem künstlerischen Gesamtbild ebensowenig wegzudenken, wie sie sich selbst nicht aus Zdisslawitz wegdenken läßt.
Ist sie doch mit den Dorfbewohnern immer in naher Berührung gestanden; sie hat das Leid und die Sorgen jedes einzelnen von ihnen gekannt und dann geholfen, so gut es nur anging. Das letztere sogar über ihren eigenen Tod hinaus, da sie den Erlös für den testamentarisch verfügten Verkauf ihrer Uhrensammlung zur Errichtung eines Armenhauses in Zdisslawitz bestimmte. Jedenfalls hat sie für dieses getan, was nur in ihren Kräften stand. Aber auch für das Schloß — und da in erster Linie für die darin befindliche Bibliothek.
Diese war zwar schon an und für sich statr-lich, wurde durch sie aber noch dadurch bereichert, daß sie es sich angewöhnt hatte, die ihr von auswärts zugesandten Bücher dort zu hinterlegen. Und da sie fast mit allen Dichtern und Schriftstellern ihrer Zeit zum mindesten in brieflichem Verkehr stand — darunter mit keine Geringeren als Grillparzer, Gottfried Keller, Gerhart Hauptmann und so weiter —, kam auf diese Weise eine Sammlung von Widmungsexemplaren hier zusammen, die sich sehen lassen konnte. Und jetzt?
All dies ist zerflattert, zerstoben, als ob es niemals vorhanden gewesen wäre. Der verträumte Park mit seinen zum Teil uralten Bäumen umgibt das Schloß zwar immer noch, und vor dessen Eingang plätschert nach wie vor leise der Springbrunnen. Und doch ist das Schloß kein Schloß mehr.
1945 wurde es zum Kulturhaus der Gemeinde umgewandelt. Nunmehr dient es der Abhaltung von Vorträgen und Schulungen. Winterhalters Gemälde ist weiß übertüncht und die gesamte Inneneinrichtung des Hauses im Wege einer Lizitation an den Meistbietenden vergeben. Der Bibliothekbestand aber wurde auf offenen Lastwagen als Makulatur einer Papiermühle zugeführt.
So ist im Bereiche des ZdissJawitzer Schlosses nichts mehr übrig geblieben, das heute noch an Marie Ebner erinnern könnte, außer iener Lindenallee, die noch immer auf das Dorf zuführt und der sie sowohl in ihren „Kinderjahren“ wie in ihrem „Zeitlosen Tagebuch“ ein so wunderschönes und wahrhaft zeitloses Denkmal gesetzt hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































