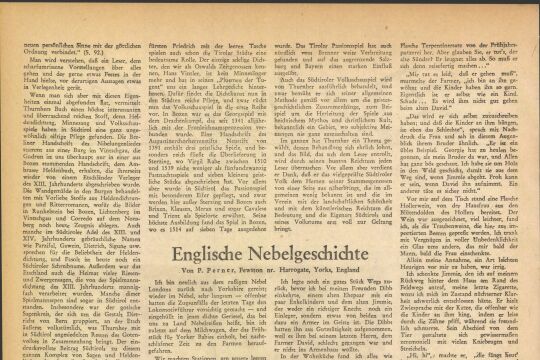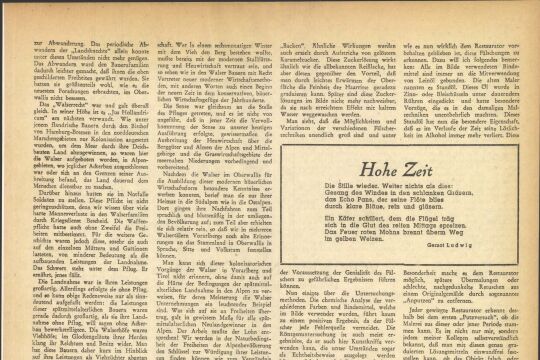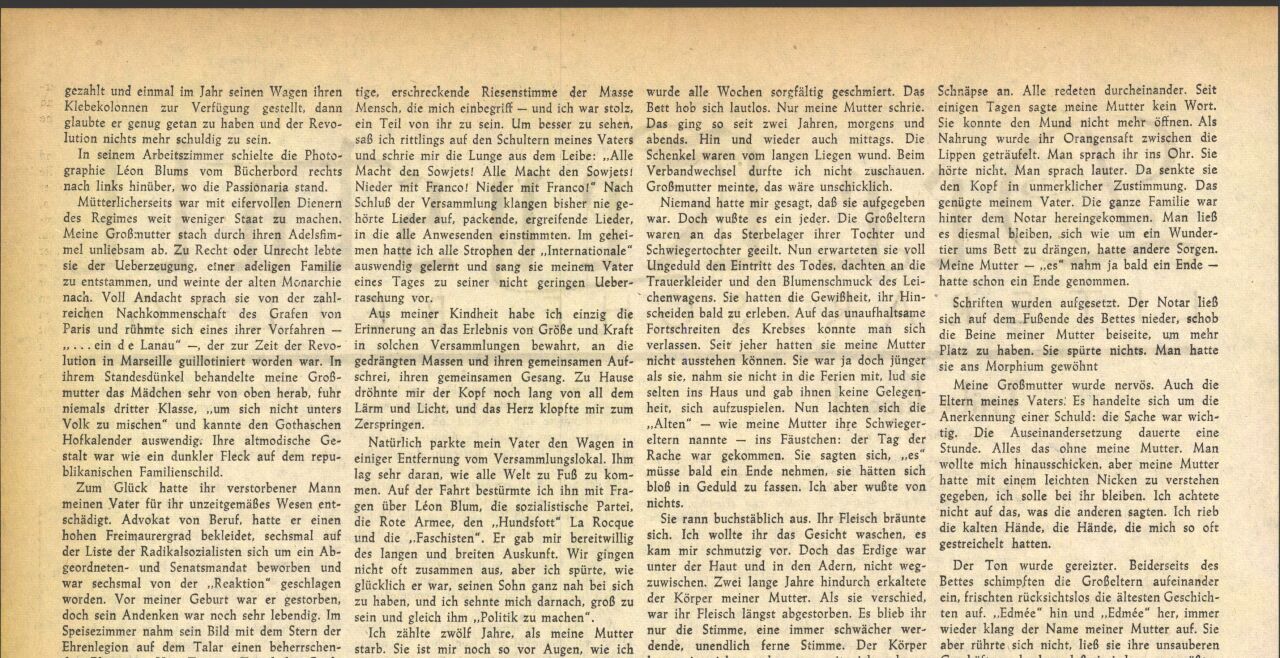
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zeidten Wirer Votawa
Wir waren von heftigem Schrecken befallen. Daß sich die Zeichenstunde, die wir als reine Erholung oder Gelegenheit betrachteten, uns für Mathematik und Latein vorzubereiten, so störend gestalten könnte, hätten wir nie vermutet. Beim früheren Professor, dem guten, alten Mann mit seinem Käppchen und runden Gelehrtenbart, hatte immer selbstverständliches Gemurmel den Zeichensaal erfüllt. Aber dieser von uns viel Gepeinigte war gestorben und sein Nachfolger erwies sich als sein wahres Gegenteil. Er hatte“ sich nach einigen einführenden Höflichkeiten und, als wir eben die Zeichenstunde in gewohnter Weise beginnen wollten, plötzlich auf das Podium geschwungen und stand nun so schrecklich da oben, daß uns geradezu das Blut stockte. Es war eine ganz ungewöhnliche, furchtbare Stimme, die er aus seiner Brusttiefe hervorholte. Sie schien, locker in der Kehle sitzend und offenbar beim geringsten Anlaß entfesselt, gewissermaßen geübt, auf lange Dauer einen Raum mit dröhnendem Krawall zu erfüllen.
Dieser Mann hieß Wotawa. Er hatte ein gelbliches Gesicht mit rollenden schwarzen Augen und dünnem Schnurrbart und Kinnbärt-chen wie ein Slave der Vorzeit. Das Dämonische seiner hageren Erscheinung verstärkte ein allzu langer Ueberrock, den er nie ablegte: dieses Kleidungsstück schwang, wenn er auf den Katheder sprang, um uns von erhöhtem Ort aus zu bändigen, in der wilden Wallung seiner Erzürntheit mit. Unübertrefflich schüchterte uns sein Strafgericht ein. Er tobte auch mit den Augen. Denn seine hinter den Lidern fast verschwindenden Pupillen zeigten an, daß Ekstase ihn erfaßt hatte. Schon das erste Geschrei, wovon die Wände mit den Gipsfiguren widerhallten, genügte, um uns alles Unbotmäßige gründlich auszutreiben. Dann erfolgte ein Vergleich zwischen den schlichten Landkindern der Provinzstadt Przemysl, wo er früher unterrichtet hatte, und uns mißratenen Großstadtsöhnen, der für uns hoffnungslos beschämend ausfiel. Endlich stieg er in die Lautlosigkeit des verängstigten Saales, wo nun alles dicht über die Zeichenbretter gebeugt saß und seinem Befehl gemäß hellblaue, scharf gerandete Schatten anzulegen sich bemühte, und hielt Wache im Mittelgang.
So gefährlich sich Wotawa anfangs auch angelassen hatte — wir brachten doch bald heraus, daß er eigentlich ein harmloser, nur sehr leicht erzürnbarer Mann war. Wenn sich jemand rechtschaffen mühte, fand er kaum einen seine Arbeit besser Anerkennenden als ihn. Er hielt dann das Zeichenbrett wie ein Weitsichtiger von sich gestreckt und sagte in seinem stark slawischen Deutsch: „Gutt! No ssähr gutt!“ Und mit dem üblichen Kennerzeichen der aneinandergepreßten Daumen und Zeigefinger die Umrisse nachfahrend und das Ganze mit einer wohlwollenden Gebärde überschlagend, lobte er weiter: „Das haben S' ssähr gutt beobachtet. A freindliches, liebliches Kepfchen. So sind S' auf guttem Wege.“
Durch Zufall erfuhr ich mehr von ihm als meine Kameraden, wodurch der Schrecken, den er anfangs verbreitet, für immer verschwand und ganz anderen Gefühlen Platz machte. Ich begegnete ihm einmal nahe dem roten Ziegelbau des Gymnasiums in einer einsamen Gasse, die er gerade in seinem langen Rock durchwandelte. Da er mir anbot, ihn zu begleiten, ging ich mit ihm. Ich erzählte, daß ich mich jetzt an Gesichtern meiner Bekannten im Modellzeichnen übe, doch dies fand nicht seine ungeteilte Billigung. Man lerne freilich dabei, doch wolle er mir ernsthaft um die Kunst Beflissenen einen besseren Rat erteilen: ich möge mich einmal in eine Kirche setzen, am Nachmittag, wenn nur wenige Leute anwesend seien, und bloß dort sitzen, stillsitzen. Seine Pupillen waren wieder verschwunden, als er mir das schilderte. Ich sah nur das Weiß der Augen. „Ja, da ham S' heilige Ruh“, sagte er mit eigentümlich ironischen Falten um die Mundwinkel, als wäre es lächerlich, jemals sonst auf den Frieden dieser Erde zu hoffen. „Ruh vor den lieben Näbenmenschen, die soviel scheen tun und hinterem Rücken arbeitens.“ Aufseufzend fügte er hinzu: „Und Ruh vor sich selbst.“ Dies letzte schien ihn besonders zu beschäftigen. Denn nach einer Pause gab er mir zu verstehen, daß es eben seine Ruhelosigkeit sei, die den Grund seines Künstlerelends ausmache: er komme durch die Not des Daseins nicht mehr zum Malen, sein eigentlicher Beruf sei dahin.
Ich kannte seine Gemälde. Sie waren manchmal in der Auslage einer Kunsthandlung auf dem Ring zu sehen, und wir pflegten hinauszu-pilgern, wenn ein Mitschüler ein neues Werk an der großbuchscabigen Signatur „Wotawa“ entdeckt hatte. Meistens befand sich ein gelblicher, bis ins Feinste ausgeführter Totenkopf im Vordergrund, der, auf einem Faltentuch ruhend, mit der Schwermut einer Herbstvase oder schräg liegenden Violine, mit herumliegenden Früchten oder einem offenen Buch in Beziehung gebracht war. Diese Stilleben galten uns zwar, was die Nachbildung des Wirklichen betraf, als unerreichbare Vorbilder der Malerei, aber ihr zu deutlicher Hinweis auf Trauer und Vergänglichkeit sprach uns nicht an. Wir hielten sie für mittelmäßig.
Aber der Professor empfand es als ein schweres Geschick, daß er durch äußere Umstände verhindert war, sich seiner Kunst zu widmen. Er klagte, daß Verwandte seiner Frau bei ihm wohnten und daß dies über seinen Kopf geschehen, daß er nicht mehr Herr im Hause sei. Gestern habe er sich in ein ungeheiztes Kabinett zurückgezogen, während vor der Tür Nähmaschinengeknatter und laute Unterhaltungen von Frauen und Kindern ihn nicht zur Sammlung kommen ließen. Da sei er auf dem kleinen Fleck zwischen Fenster und Wand auf und ab gegangen, lange Stunden auf und ab. Und er ließ durchblicken, daß er dieses selbstquälerische Mittel gewählt hätte: aus Furcht vor sich selbst. „Wenn man a so unseliges Blut hat ...“, meinte er kleinlaut. Die Stimme, die ich sonst so schrecklich und raumerfüllend gekannt hatte, bebte fast neben mir. Er beichtete mir, einem Jungen.
Dann erzählte er von dem einzigen Menschen, bei dem er einst Ruhe gefunden. Ich weiß nicht mehr, ob er damit seine Großmutter oder eine andere alte Frau der Verwandtschaft oder Nachbarschaft gemeint hatte, er nannte sie immer zärtlich „Mitterchen“ und schilderte ihr feines Faltengesicht, das von einem duftigen Spitzenhäubchen umrahmt gewesen, während die Schultern ein ebenso sorgfältig wie sauber gehaltener Wollkragen umhüllt hatte. N i e hätte diese Greisin ihn gescholten. Was auch immer ihn gepeinigt, sie hätte es ihm mit ihrem stillen Sitzen im Lehnstuhl weggenommen. Nun aber, so lange nach ihrem Tod, hoffe er immer, sie würde ihm einmal, nur ein einziges Mal, im Traume erscheinen, da er doch so voll Dankbarkeit sich ihrer erinnere. Aber nichts dergleichen sei jemals geschehen, nie hätte sie ihn aus ihrer jenseitigen Abgeschiedenheit gegrüßt, nie ihn wie bei Lebzeiten ermuntert, die Leiden des Lebens zu tragen. „No, so sehn S' “, schloß er wieder ironisch, „was soll ich da glauben an ein heheres Leben und an ein Wiedersehn und an all die scheenen Dinge?“
Ich weiß, daß mir damals vor der Hoffnungslosigkeit des Lehrers bangte, der mir verloren schien in der finsteren Enge eines vollerwachsenen, enttäuschten Daseins. Ich war noch jung und begriff nicht, daß es Menschen gab, die einfach täglich daran zugrunde gingen, weil sie immer gerade das tun zu müssen glaubten, was sie nicht wollten, Menschen mit „unseligem Blut“. Und daß ein scheinbar unwiderstehlicher Strom von Schicksal die sich Sträubenden mit sich forttrug.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!