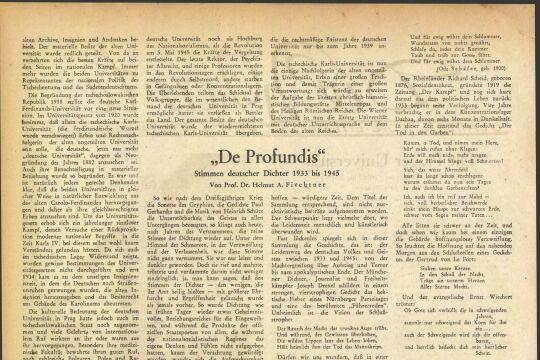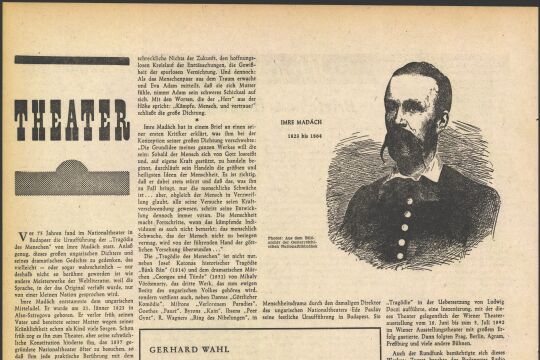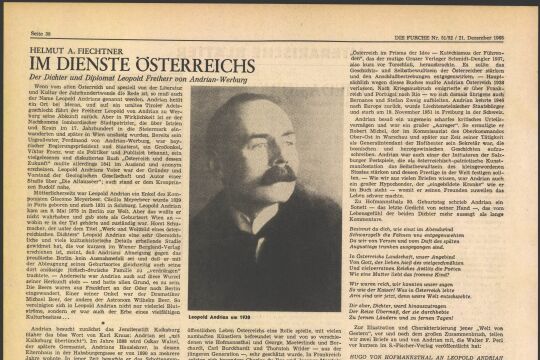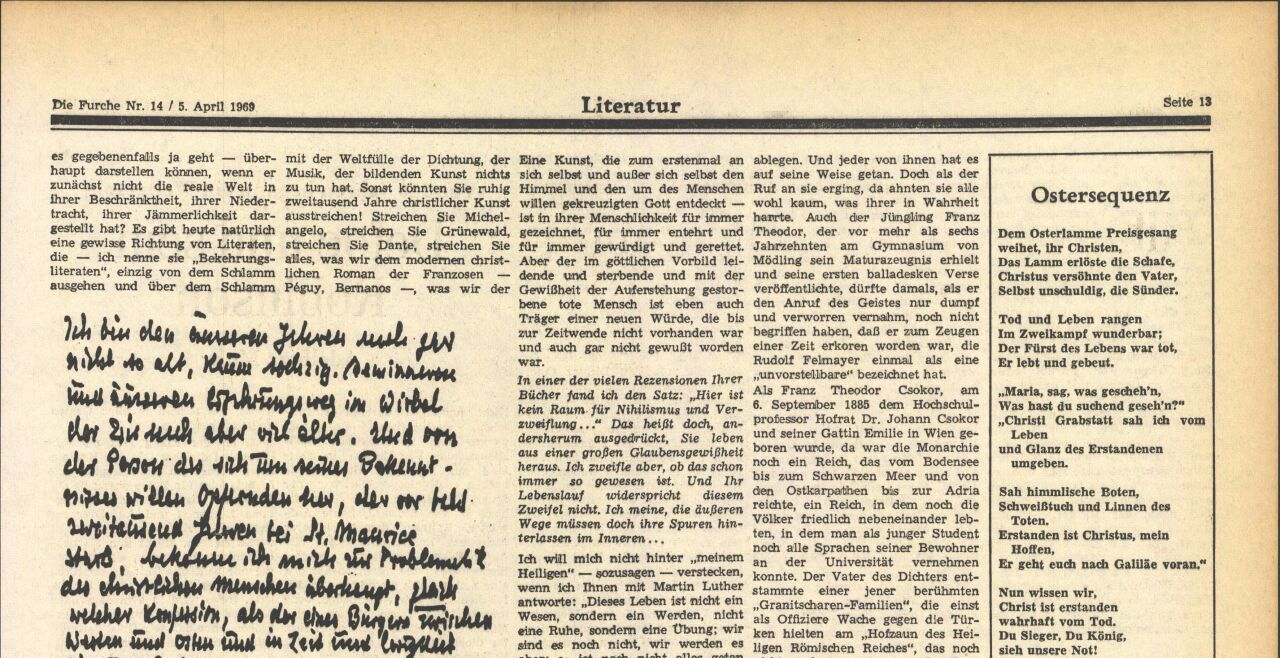
Zeuge der Menschlichkeit
Am 14. Jänner 1968 wurden die sterblichen Beste eines großen Österreichers zu Grabe getragen, dessen Leben und Werk in einer barbarischen Zeit Zeugnis von der Menschlichkeit ablegte, die Franz Theodor Csokor bis zu seinem letzten Atemzuge am 5. Jänner 1968 erfüllte.Vor mehr als dreieinhalb Jahrzehnten war es, am Ende der heute als „golden“ gepriesenen zwanziger Jahre, da wehte uns von den deutschsprachigen Bühnen etwas an, das uns ebenso erschauern machte wie die Menschen vor bald zweihundert Jahren in Mannheim. Da drang eine Stimme an unser Ohr, die klang wie jene des jungen Schiller:„Ja, nach unserem Ebenbild forme ich Menschen, doch ihr Atem ist Baserei, ihr Trieb vermählte sich dem Tode, ihre Gedanken entthronen Gott! Ich greife in eine riesige Wolke aus Blut, die mir zu zucken anhebt unter den formenden Fingern! Ich erschaffe die Welt noch einmal im Werk, ja: ich hinfällig verwes-licher Mensch, ich zwischen Nichts und Nichts schmale Vergänglichkeit ...“
Am 14. Jänner 1968 wurden die sterblichen Beste eines großen Österreichers zu Grabe getragen, dessen Leben und Werk in einer barbarischen Zeit Zeugnis von der Menschlichkeit ablegte, die Franz Theodor Csokor bis zu seinem letzten Atemzuge am 5. Jänner 1968 erfüllte.Vor mehr als dreieinhalb Jahrzehnten war es, am Ende der heute als „golden“ gepriesenen zwanziger Jahre, da wehte uns von den deutschsprachigen Bühnen etwas an, das uns ebenso erschauern machte wie die Menschen vor bald zweihundert Jahren in Mannheim. Da drang eine Stimme an unser Ohr, die klang wie jene des jungen Schiller:„Ja, nach unserem Ebenbild forme ich Menschen, doch ihr Atem ist Baserei, ihr Trieb vermählte sich dem Tode, ihre Gedanken entthronen Gott! Ich greife in eine riesige Wolke aus Blut, die mir zu zucken anhebt unter den formenden Fingern! Ich erschaffe die Welt noch einmal im Werk, ja: ich hinfällig verwes-licher Mensch, ich zwischen Nichts und Nichts schmale Vergänglichkeit ...“
Der diese Worte schöpferischen Rausches dem jungen Dramatiker Georg Büchner in den Mund gelegt hat, erläuterte Ihren Grundgedanken ein halbes Jahrzehnt nach ihrer Niederschrift, am 2. September 1933, nochmals seinem Freunde Ferdinand Bruckner: „Seit acht Tagen sitze ich hier (Csokor weilte damals bei Freunden in Polen) in unerbittlicher Arbeit und denke, noch bis über meinen Geburtstag zu bleiben. Von Schwindelanfällen durch das Über-gangs-wetter ausgiebig geplagt — die Inschrift der Trappistendormitorien ,peut-etre cette nuit' vor den geteti-gen Augen —, erlebe ich doch neben Müdigkeit und Verzweiflung bei meinen Versuchen, meinen Stoff zu meistern, so reine und freudige Augenblicke der Sinnsetzung im sinnlos Scheinenden, der siegreichen Ordnung im Chaos — nur der Dramatiker kann die schöpferische Lust eines Gottes erfahren, der aus Gedanken Gestalt und Geschehen erschafft, und den Triumph seines siebenten Tages, wenn die Welt, die er aus dem Nichts hob, die Augen aufschlägt.“
Dieses schöpferische Grundgefühl verband sie alle, die in der Welt eines heraufkommenden Chaos eine neue menschliche Sinnordnung schaffen wollten: Georg Kaiser, Ferdinand Bruckner, ödön von Horvath und Franz Theodor Csokor. An sie war ein Ruf ergangen, ähnlich dem, der einst an die Sendboten des Herrn ergangen war, das Evangelium einer neuen Menschlichkeit zu verkünden. Und jeder von ihnen spürte die Verpflichtung, die ihn ganz allein engagierte:
„Du bist gemeint, Nicht der neben dir, Komm!“
Jeder sollte auf seine Weise Zeugnis ablegen. Und jeder von ihnen hat es auf seine Weise getan. Doch als der Ruf an sie erging, da ahnten sie alle wohl kaum, was ihrer in Wahrheit harrte. Auch der Jüngling Franz Theodor, der vor mehr als sechs Jahrzehnten am Gymnasium von Mödling sein Maturazeugnis erhielt und seine ersten balladesken Verse veröffentlichte, dürfte damals, als er den Anruf des Geistes nur dumpf und verworren vernahm, noch nicht begriffen haben, daß er zum Zeugen einer Zeit erkoren worden war, die Rudolf Feknayer einmal als eine „unvorstellbare“ bezeichnet hat. Als Franz Theodor Csokor, am 6. September 1885 dem Hochschulprofessor Hofrat Dr. Johann Csokor und seiner Gattin Emilie in Wien geboren wurde, da war die Monarchie noch ein Reich, das vom Bodensee bis zum Schwarzen Meer und von den Ostkarpartihen bis zur Adria reichte, ein Reich, in dem noch die Völker friedlich nebeneinander lebten, in dem man als junger Student noch alle Sprachen seiner Bewohner an der Universität vernehmen konnte. Der Vater des Dichters entstammte einer jener berühmten „Granitscharen-Familien“, die einst als Offiziere Wache gegen die Türken hielten am „Hofzaun des Heiligen Römischen Reiches“, das noch nicht zerfressen war von der Teufelspest des Nationalismus. Aber „die Grenze mit ihren Spannungen und Zwisten ging durch ihn und sein Blut“. Der Dichter bezeichnete sich selbst einmal als ein „richtiges österreichisches 31end', wie die Angelsachsen ein würziges Gemenge aus verschiedenen Tabak- oder Teesorten nennen.“ Und erklärend fährt er fort: „Mischten sich im Vater serbische und kroatische Ahnen, so in den Vorfahren der Mutter Deutsche, Tschechen und Ungarn, und geboren wurde ich im Völkerkessel Wien: Und fast gehört es dazu, daß das erste meiner Stücke, das ich auf der Bühne sah“ — es war das Revolutionsdrama „Thermidor“ — „mir unverständlich blieb, weil die Aufführung 1912 in Budapest in einer Sprache übersetzt geschah, die ich trotz meines madjarisierten Namens nicht beherrsche: Ungarisch.“ Nur wer die Erfahrungen seiner vielfältig gemischten Ahnen im Blute und im Herzen trug, wer noch den letzten Abglanz der „dementia Austriaca“, jener österreichischen Staatstugend gerechter Milde in den besten Geistern seiner Zeit walten sah, der konnte einmal das Stück vom Sterben des alten Österreich schreiben, den „Dritten November 1918“, dessen Prophetie sich so furchtbar erfüllen sollte 1
Im gleichen Jahr 1912, in dem des Dichters „Thermidor“ in Budapest uraufgeführt wurde, erschien die erste Sammlung seiner balladesken Verse unter dem Titel „Die Gewalten“. Ihr inhaltlicher Aufbau verrät uns schon, mit welchen Gewalten der Dichter damals kämpfte: mit dem „Spuk“ der Gespenster, mit den „Kämpfern“ jeglicher revolutionären Haltung, mit den „Mächten“ des Geldes, des Ehrgeizes, mit den erotischen „Gewalten“ und jenen, die den Menschen zum „Gezeichneten“ machten. In diesen Versen blitzt bereits der Dolch auf, der die Wunde schlägt, in die jene spätimpressionistische Zeit der Rilke, Schaukai, Hofmannsthal sich so gerne vergrub. Sie sagte sich mit Baudelaire: „Je suis la pWe et le couteau! Je suis le soufflet et la joue! Je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau!“
„Die Wunde bin ich und der Dolch, die Wange und der Backenstreich! Bin Rad und draufgeflochtm.es Glied zugleich,das Opfer bin ich und des Henkers Streich!“
Es ist bezeichnend, daß Csokors nächster Gedichtband „Der Dolch und die Wunde“ nicht nur unter diesem Motto des großen französischen Dichters stand, der ihm auch den Titel für seine Verse gab, sondern daß in dieser zutiefst gefühlten Zweipoligkeit schon die objektive Spannung seiner späteren dramatischien und epischen Werke aufklingt, die ihn sowohl die Opfer wie ihre Mörder so objektiv gestalten ließen. Denn die Welt, von der der Dichter in seinem Werke Zeugnis geben sollte, sollte eine Welt des Mordes und der Barbarei werden und mit Blut bestätigen, was Grillparzer um die Mitte
das vorigen Jahrhunderts prophezeit hatte:
„Der Weg der neueren Bildung geht von der Humanität über Nationalität zur Bestialität.“
Es ist zunächst das Confiteor menschlicher Leidenschaften, die sich aus der sie beengenden bürgerlichen Stickluft des späten neunzehnten Jahrhunderts befreien wollten, das in den frühen Gedichten Csokors ebenso erklingt wie in den verwandten Versen seines Freundes Wildgans und anderer Zeitgenossen. Es war dies jene Generation der damals Zwanzigjährigen, deren sich nach Erhard Buschbecks treffender Schilderung „eine große Unruhe bemächtigt hatte,, in denen Angst vor. einem Kommenden. mächtig wurde, die,.sie oft' ah die Grenze der Verzweiflung und in Todesnot brachte.“ An jenem Ubergang vom müde gewordenen Impressionismus zur neuen Ausdrucksform eines expressionistischen Lebensgefühis sind die frühen Werke Osokons anzusiedeln, der vor allem mit seinem dramatischen Werk einer der bedeutendsten Vertreter des österreichischen Expressionismus werden sollte und dabei doch — so paradox es klingen mag — der österreichischen Urtradition des Barocktheaters, als einer Bühne des Gleichnisspieles, zutiefst verbunden blieb. „Die Welt fängt im Menschen an!“ hat Franz Werfel in jenen Tagen verkündet. Der Ruf nach dem neuen Menschen, der überall in der expressionistischen Dichtung laut wurde, ist vielleicht am reinsten im lyrischen Werk Werf eis und im dramatischen Schaffen Csokors aufgenommen worden. Seit jenen Tagen, die ja schon 1910 mit der Gründung des „Brenner“ begannen hatten, hieß sein Generalthema: „Humanität und Achtung vor den Menschenrechten“, und Csokor ist aus der von Pastor Waldig und Georg Büchner gegründeten „Gesellschaft der Menschenrechte“ niemals ausgetreten! In jenen Tagen wurde die „litterature enga-gee“ unserer Zeit neu begründet, und ihre hohen ethischen Ziele hat Csokor in seinem Lebenswerk, das 30 Dramen, mehrere Gedichtbände, einen großen Roman und andere Prosaschriften umfaßt, kompromißlos verfochten. Dieses eminent politische und mitmenschliche Engagement für die Unterdrückten gegen ihre Bedrücker bestimmte sowohl seinen menschlichen als auch seinen künstlerischen Rang in dieser „unvorstellbaren Zeit“!
Schon in dem 1917 erschienenen Gedichtband „Der Dolch und die Wunde“ wurde nicht nur Selbstgericht, sondern auch Gericht über die Zelt gehalten, die sich eben in die Barbarei des ersten Weltkrieges gestürzt hatte. Jenes Krieges, der der Anfang vom Ende der Monarchie, vom Ende Alteuropas wurde, die böse Furcht nationalistischer Saat und völkischen Irrwahns. Csokor hat diesen Krieg als Soldat von Anfang
Ostersequenz
Dem Osterlamme Preisgesang weihet, ihr Christen, Das Lamm erlöste die Schafe, Christus versöhnte den Vater, Selbst unschuldig, die Sünder.
Tod und Leben rangen Im Zweikampf wunderbar; Der Fürst des Lebens war tot, Er lebt und gebeut.
„Maria, sag, was geschehen, Was hast du suchend geseh'n?“ „Christi Grabstatt sah ich vom Leben
und Glanz des Erstandenen umgeben.
Sah himmlische Boten, Schweißtuch und Linnen des Toten.
Erstanden ist Christus, mein Hoffen,
Er geht euch nach Galiläe voran.“
Nun wissen wir, Christ ist erstanden wahrhaft vom Tod. Du Sieger, Du König, sieh unsere Not! bis zum bitteren Ende mitgemacht. Er hat seinen geliebten Bruder vor Kiew verloren. Gleich Karl Kraus hat er gegen den ■Wahnsinn dieses Menschen- und Völkermordes seine Stimme erhoben. Ebenso vergeblich wie Jahrzehnte später gegen die Barbarei des Nationalsozialismus in jener berühmten gegen die Bücherverbrennungen und Menschenverfolgungen gerichteten Erklärung des PEN-Clubs vom Jahre 1933. Er zählte mit Thomas Mann und allen denen, die damals warnend ihre Stimme erhoben haben, zu jenen Beispielhaften, die sehr wohl gewußt haben, was da an Grauen und Unheil heraufkam — schon 1933! — während es leider noch immer manche Zeitgenossen gibt, die gar nichts davon gewußt haben wollen, obwohl es in den Zeitungen und literarischen Zeugnissen jener Tage sehr wohl zu lesen war. Für diese tapfere Haltung gegenüber dem Ungeist einer ganzen Zeit nahm der Dichter, der sich standhaft weigerte, seine Unterschrift unter die PEN-Erklärung zu widerrufen, auch das Schicksal der freiwilligen Emigration im Jahre 1938 auf sich, die ihn zwar nicht vor dem allgemeinen Grauen, doch wenigstens vor den Folterknechten des braunen Regimes bewahren sollte. *
Es geschah dies zu einer Zeit, da der Dichter auf dem Höhepunkt seiner ersten Schaffensperiode angelangt war, die uns das Büchner-Drama „Gesellschaft der Menschenrechte“ — Csokors „Räuber“! — das Revolutionsdrama „Die rote Straße“, das Schauspiel „Besetztes Gebiet“ und vor allem sein Meisterwerk „Der dritte November 1918“ beschert hat. Der Dichter erhielt dafür noch 1937 den Grillparzer-Preis und den Burgtheaterring. In dieser Zeit fand er auch das dichterische Gleichnis für den Massenwahn der Zeit und gestaltete es sowohl in seinem Wieder-täuferdrama „Der tausendjährige Traum“ als auch in dem Romain „Der Schlüssel zum Abgrund“, den er erst nach seiner Rückkehr in die Heimat vollenden konnte. Die zweite Schaffensperiode fällt in die bitteren Emigrations- und Kriegs jähre, die den Dichter nach Polen, Rumänien, Jugoslawien und schließlich nach dem von den Alliierten befreiten Brindisi führten. Seine Bücher „Als Zivilist im Polenkrieg“, „Als Zivilist im Balkankrieg“ und das 1964 erschienene Buch „Zeuge einer Zeit — Briefe aus dem Exil“, geben erschütterndes Zeugnis von der Odyssee eines Dichters, der um seiner Menschlichkeit willen durch den brennenden Erdteil gejagt worden ist und der — wiederum im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen — sich selber mitschuldig fühlte an dem Unheil dieser Zeit. Sein in der Emigration fertiggestelltes Loyola-Drama „Gottes General“ zeugt davon ebenso wie so manche Stelle seiner Kriegstagebücher und die Verse seiner „Männergediichte“. Osokor weiß um die
„Schuld aus dem Ursprung, die unsre Schuld wird vor dem Gericht dieser Zeit!“ Mitten im Weltbrand schrieb er sein Jadwiga-Drama von der heiligen Hedwig Polens, sein verloren gegangenes Stück „Die Arche Satans“, sein Odysseus-Drama „Kalypso“ sowie die Schauspiele „Der verlorene Sohn“ und „Pilatus“. Wieder in der Heimat, begann 1946 die dritte Schaffensperiode des Unermüdlichen. „Casars Witwe“ wurde vollendet, der Wiedertäuferroman abgeschlossen und die vier Jahrzehnte umfassende lyrische Ernte in „Immer ist Anfang“ eingebracht, die Stücke „Hebt den Stein ab“, „Treibholz“, „Das Zeichen an der Wand“, „Zosimir“ entstanden, und der Dichter konnte noch 1965 sein Diokletian-Drama „Kaiser zwischen den Zeiten“ abschließen. Sein „Alexanderzug“, an dem er bis zuletzt arbeitete, ist vermutlich Fragment geblieben. Sein Werk und seine Staunen erregende Lebenskraft spottet seiner dreiundachtzig Jahre und die Worte Franz Werfeis zum fünfzigsten Geburtstag Csokors waren noch bis an sein Totenbett wahr: „Er war mit Fünfzig derselbe junge Dichter, der er mit Zwanzig war, und er ist es geblieben.“
Wenn wir, die wir um ihn, den vielleicht mutigsten Dichter Österreichs im letzten Halbjahrhundert, trauern und in der rechten Weise für das Lebenswerk eines großen Humanisten, der in einer entmenschten Zeit das Evangelium der Menschlichkeit nicht nur verkündet, sondern auch vorgelebt hat, danken wollen, dann werden wir dieser Dankesschuld und Pflicht vielleicht am besten gerecht, wenn wir uns daran erinnern, daß Csokor nicht nur sein lyrisches, nein sein ganzes Lebenswerk jenen vermeint hat, denen der Band „Immer ist Anfang“ gewidmet ist: „Den schuldlos Verfolgten, den rechtlos Gerichteten, den maßlos Gemordeten aller Völker und Zeiten.“ Wenn wir dies niemals wieder vergessen, dann erhalten Csokors Zeilen ihren schönsten Sinn:
„Sag, wofür war es denn wert zu
leben — ? Um zu leiden! Um zu träumen! “Um
zu geben!“ Erst unser Leiden und unser schöpferischer Traum kann seinem Werk, auch über seinen Tod hinaus, gerecht werden, wenn sie sich umzusetzen vermögen in die gebende, helfende, mitmenschliche Tat. Denn Csokor lehrte uns ebenso wie sein antiker Kollege Sophokles: „Nicht mitzuhassen, mitzulieben, sind wir da!“