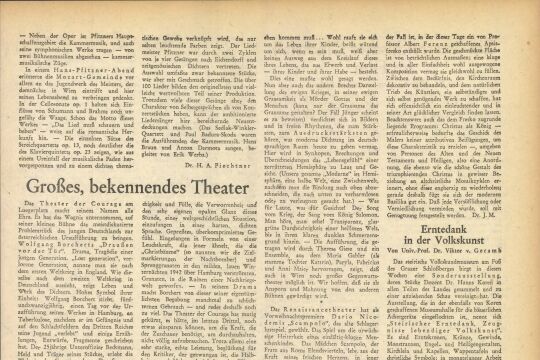Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zu kleine Perspektiven
uvi eugusvue raioigsautor reier Howard, mit dessen Stück „Durch die Gartenmauer“ ein eigenes Ensemble gastiert, hat sich nicht wenig vorgenommen. Howard ist Präsident der internationalen Bewegung „Moralische Aufrüstung“ (Caux) und will, wie uns versichert wird, in seinem Bühnenwerk „den Weg der Überwindung der beiden unausgeglichenen Ich im Menschen, des gestörten Zusammenlebens innerhalb der Familie, der kleinen und großen Gemeinschaften, der Völker und der Welt weisen und „ein neues Denken anregen.“ Gezeigt wird alles das im Stile eines eher humorvollen Volksstückes an zwei Nachbarsfamilien, die nur durch eine erst niedrige und allmählich höher wachsende Gartenmauer voneinander getrennt leben. Hier die satten, hochnäsigen, profitgierigen Reaktionäre, dort die heraufgekommenen, proletenhaften, nicht minder aufs Geld versessenen Revolutionäre. Aber die Kinder der beiden Familien, Romeo und Julia von heute, finden auch über die Mauer hinweg zueinander. Durch ihr Zutun und das rechtzeitige Eingreifen eines geheimnisvollen Dr. Gold, eines Spezialisten für Sympathieerwecken und Friedenstiften, der als Deus ex machina immer rechtzeitig zur Stelle ist, erfolgt am Ende die große Versöhnung der beiden getrennten Welten.
Ein Teil des Publikums, das zunächst wohlgelaunt den mehr heiteren Auseinandersetzungen zwischen „Ost und West“ im Theater an der Wien folgte, war über das Ende, als die „Schocktherapie des Herzens und des Verstandes“ im Tendenzsirup steckenzubleiben drohte, doch einigermaßen überrascht. Unter der routinierten Regie von Viktor de Kowa (der sich im Programmtext als Gegner von „Haß, Mißtrauen, Neid und Unmoral“ bekennt) boten recht ansprechende schauspielerische Leistungen: Eva Lissa, Hilde Ziegler, Adolph Spalinger (bekannt aus dem „Stellvertreter“), Kurt Müller-Graf, Hans E. Berger, Andreas Adams und dazu zwei Schauspieler aus Wien: Georg Bucher und Georg Corton.
Große Dinge in Kleinformat bringt auch das Schauspiel „Frauengefängnis“, von Claude Baldy (Jahrgang 1904). Es spielt in einem Gefängnis, wo weibliche Häftlinge in Untersuchungshaft gehalten werden oder geringere Strafen verbüßen. Die Aufsicht über sie haben Schwestern des — fiktiven — Maria-Joseph-Ordens inne. „Les vigies“, wie der Originaltitei lajitet, bedeutet im Frapgqspschen „Schiffswache“, also eine, „besonders konzentrierte Form der Wache“ oder, übertragen: Wachter, Hüter in "gefahrvollster Position. Es geht dem Autor, wie er sein Stück erläutert, um den „Konflikt zwischen zwei außergewöhnlichen Daseinsformen“: Hier die Bedrohten und Strauchelnden der „Welt“, dort die Glaubenden, die sie meinen „hüten“ zu müssen. „Gefährdet die werktätige christliche Liebe im Glauben die Vollkommenheit des Glaubens?“ Baldys Stück will eine Antwort auf diese Frage versuchen. Die gutmütige, naive, ältere Schwester und die engelhafte, schöne, gütige, jüngere Schwester helfen den Menschen in barmherziger Liebe und erlauben den Gefangenen Erleichterungen, die eigentlich verboten sind. Gewissenskonflikte bleiben nicht aus. Im schroffen Gegensatz zu den beiden verharren die gestrenge Prokuratorin und vor allem eine bekehrte Gefangene, die selbst Nonne werden will. Sie bekennt sich als Hüterin des Seelenheils zu dem Gott, dem man sich nur durch Entsagung, Härte und schonungslose Wahrhaftigkeit nähern dürfe. Wohl behalten die Eiferer die Oberhand über die Barmherzigen, doch bleiben am Ende Konflikt und Lösung offen.
Das etwas konstruiert anmutende Schauspiel (mit dem „Grand Prix Dra- matique“ ausgezeichnet) erwies sich als
senr tneaterwirKsam und kam unter der Regie von Otto Ambros im Renaissance- Theater zu einer eindringlichen und pak- kenden Aufführung. Gretel und Sissy Löwinger, Marianne Schönauer, Elisabeth Stemberger, Hilde Nerber, um nur einige von den mehr als ein Dutzend Mitwirkenden zu nennen, belebten die nicht immer besonders profilierten Figuren des Stückes aus eigener Kraft.
Nicht minder konstruiert, allerdings völlig andere Perspektiven eröffnend, erweist sich das Schauspiel „Das Haus der guten Söhne“ der bereits erfolgreichen Wiener Dramatikerin Beatrice Ferolli, das im Kleinen Theater der Josefstadt uraufgeführt wurde. Bezeichnend, daß im Programmheft ein Beitrag mit dem Titel „Ein Psychiater assoziiert“ abgedruckt ist, was über den Chrarakter des Stückes genügend aussagt. Eine Mutter kann ihre beiden Söhne nicht aus ihrer gewaltsamen Liebe entlassen, vor der der ältere,
der sich während des Krieges in Frankreich in einer Gewitternacht an einer Minderjährigen vergangen hat, nach Afrika entfloh. Heimgekehrt, findet er just jenes französische Mädchen als „Ersatztochter“ in der Jamjlie vor. Vermehrt und kompliziert um einige Außenstehende, kommt es zu.'heftigen Konflikten, die. Onkel Seelendoktor, 'Hausfreund uttd Psychiater in Person, zwar nicht lösen aber einigermaßen entwirren kann. Man muß die sympathischen Sätze der Aütorin zitieren, die in einem Almanach nachzulesen sind: „Was ich mit meiner Arbeit von ganzem Herzen möchte, ist, die Mauer lockern, die unsere Gegenwart auf dem Theater einengt: Die Angst vor dem Natürlichen, die Angst vor der Gesundheit, die Angst vor dem Gefühl. Ich glaube nicht an die Zukunft des Morbiden und Unverständlichen auf der Bühne “ Man kann nur hoffen, daß sich die österreichische Dramatikerin in ihren nächsten Werken nicht so weit wie diesmal von ihrem Leitspruch entfernt.
Hans Hollmann vollbrachte als Regisseur auf der kleinen Bühne des Konzerthauses wahre technische Wunder des Ein-, Rück- und Durcheinanderblendens, wie man es vom Film und Fernsehen her kennt. Von den Schauspielern konnte nur Elfriede Ramhapp, durch eine Schocktherapie von ihrem Trauma befreit, beeindrucken. Weniger Erna Korhel als Mutter, Peter Eschberg und Rainer Artenfels als die braven Söhne, Fritz Schmiedel als Psychoanalytiker sowie Christine Prober und der leider immer verkrampftere Nikolaus Paryla. Lebhafter Beifall
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!