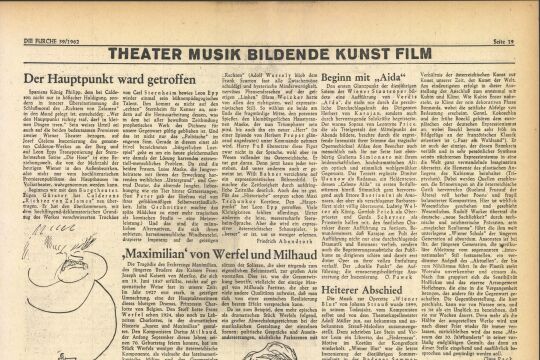Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zwei theatralische Pole
Bei den Salaburger Festspielen des Jahres 1961 brachte Leopold Lindt-berg seine Inszenierung des „Faust“, erster Teil, heraus. Sie war in dem übergroßen Raum des Neuen Festspielhauses durch die Antithese des optisch gewordenen Weltumfassenden dieser Dichtung und der kleinbürgerlichen Enge der Gretchentra-gödie gekennzeichnet. Bei der Übertragung ins Kleine Haus der Festspiele im Jahr 1964 rückten die Himmlischen dem menschlichen Bereich näher; die Geschehnisse des irdischen Teils der Tragödie gewannen an Dimension. Das ist nun, abermals drei Jahre später, auch die Wirkung der ins Burgtheater übernommenen, nur geringfügig abgeänderten Inszenierung.
Auch hier sieht man — Bühnenbild von Teo Otto — seitlich der Bühne entmaterialisieit wirkende Türme, in denen zwei der Sprechchöre vorübergehend postiert sind; linear Glitzerndes versinnbildlicht die himmlische Region, deutet vage die gotische Kathedrale an, in der Gretchen betet; flächig wie von Bergkristallen Blinkendes läßt den Schauplatz der Walpurgisnacht als ein Märchenreich erstehen. Den stärksten Eindruck ergeben die ungekürzt gesprochenen Chöre, die sich hinter Fausts oder Gretchens Monologen manchmal gleichsam wie mehrere Sprachwände aufrichten. Daß man diesmal jedes Wort versteht, ist ein Verdienst der Ghorleiterin Ellen Widmann. Die Hexenküchen-Szene mißlingt, sinkt au Grottenbahneffek-ten ab. Dagegen bietet die szenisch kaum zu bewältigende Walpurgisnacht — die Crux jeder Aufführung — unter der choreographisch guten Führung von Dore Hoyer Mögliches; die Vorstellung „Ballett“ verliert man freilich nicht. Vielleicht wäre die Szene noch mehr abzudunkeln. Die Musik von Rolf Langnese wirkt unaufdringlich, verhalten.
Der hochgewachsene Thomas Holtzmann hat als Faust an Format gewonnen; seine vordem geradezu bellende Sprechweise wich der Verständlichkeit. Man glaubt ihm den geistigen Kämpfer gegen die Widerstände, die sich dem Ergründen des Unergründbaren entgegenstellen. Die verinnerlichten Momente wirken überzeugender. Zum Liebhaber vermag er sich nicht zu wandeln. Will Quadflieg ist als Mephisto ein Elegant der Hölle von geschmeidiger, ja federnder Beweglichkeit; es eignet ihm eine selbstverständlich wirkende Überlegenheit. Dämonie fehlt. Christiane Hörbiger enttäuscht als Gretchen; man vermißt die Ausstrahlung des liebenswerten, naturhaft-sinnlichen Geschöpfs. Günther Haenel als Wagner, Bruno Dallansky als Schüler, Sttsi Nicoletti als Marthe Schwerdtlein bieten die weiteren entscheidenden Eindrücke der Wiedergabe. . Jedenfalls ist diese Inszenierung von „Faust I“ die weitaus beste derer, die man im Bürgtheater seit vielen Jahren sah.
Der englische Ausdruck Gant bedeutet Pharisäertum. Das heißt, der Pharisäer hält sich auch dann noch für untadelig, wenn er ein Verbrechen begeht, sofern es nicht publik wird. Der Schein ist alles. Diese Haltung ironisiert Oscar Wilde mit Bitterkeit in der Erzählung „Lord Saviles Verbrechen“. Eine Dramatisierung durch die Franzosen An-toine Blondin und Paul Guimard unter dem Titel „Ein junger Ehemann“ brachte das Volkstheater zur deutschsprachigen Erstaufführung.
Der junge Lord Arthur glaubt unter einem Zwang des Schicksals zu stehen, irgend jemanden, beliebig wen, ermorden zu müssen, nachdem ihm ein Chiromant vorhersagte, er werde einen Mord begehen. Mit größter Selbstverständlichkeit, ohne nennenswerte Gewissensregung, wnteraieht er sich dieser Aufgabe.
Nach etlichen Mißerfolgen gelingt ihm dies in Wildes Erzählung durch Tötung des Chiromanten, der sich nachträglich als Schwindler herausstellt; im Stück dagegen, das als Lustspiel angelegt ist, bleibt ihm der Mord erspart; der Chiromant tötet sich durch einen Zufall selbst. Es entsteht eine zwittrige Wirkung: Das ist nicht ganz eine Gesellschaftskomödie, nicht ganz eine scharf facettierte Satire, nicht ganz eine makabre Groteske, doch von allem etwas. Oskar Willner hielt sich als Regisseur an die Gesellschaftskomödie. Mit Wolfgang Hübsch als Lord Arthur, weiter vor allem mit Margarete Fries, Christine Buchegger und Dorothea Neff, mit Joseph Hendrichs, Viktor Gschmeidler und Hans Weik-ker ergab sich eine ansprechende Aufführung.
Der 24jährige Kärntner Peter Handke hat mit der Vorführung der als „Sprechstück“ bezeichneten „Publikumsbeschimpfung“ im deutschsprachigen Raum ein Aufsehen erregt, wie dies bei kaum einer anderen Bühnendarbietung in den letzten Jahren der Fal war. Die Uraufführung brachte aber bezeichnenderweise weder eine Wiener noch eine österreichische, sondern eine westdeutsche Bühne (Frankfurt). Handke ist auch bereits nach Westdeutschland übersiedelt. Nun wird diese „Beschimpfung“ im Kleinen Theater der Josef Stadt nachgespielt.
So abwegig manchem die „Publi-kumsbeschimpfung“ erscheinen mag, gliedert sie sich doch in die Entwicklung dessen, was auf der Bühne in den letzten Jahrzehnten an Neuem geboten wurde, ein. Das Verbale hat seit geraumer Zeit gegenüber dem einstigen „gehöhten“ Stück eine erhebliche Abwertung erfahren; die neuaufgekommene Pantomime verzichtet gänzlich auf das Wort; dem entgegen haben zwei Österreicher, Konrad Bayer und Gerhard Rühm, eben das Verbale mit puristischer Vehemenz neu verwendet, wobei Rühm auf Begriffsinhalte verzichtete und bis zur Vereinzelung des Sprachlichen in Konsonanten und Vokale vorstieß. So weit geht Handke nicht; er verzichtet nicht auf Begriffsinhalte.
In der „Publikumsbeschimpfung“ wird die Bühne zum Podium; vier Sprecher stellen keine Bühnenfiguren dar; sie führen auch weder eine Handlung noch ein Geschehnis vor, sondern sie wenden sich ausschließlich in einer drei Viertelstunden währenden Ansprache an das Publikum, in der sie in einer kataraktartigen Variation, sprachlich verknappt, ihre Beziehungen au den Zuschauern und deren mögliche Gedankenreaktionen hierauf sowie die rationale Negation bisheriger dramatischer Ausdrucksformen provokativ formulieren. Es wird laut, heftig, rasend rasch gesprochen, mitunter ersterbend leise oder litaneienartig, singend, im Chor oder durch Verteilen des Satzes auf mehrere Sprecher. Wie bei Rühm bedarf es auch hier nun doch des Bewegungsmäßigen, das Hans Hollmann als Regisseur meisterhaft leitet. Die Sprecher bilden eine Reihe, setzen sich, knien, hüpfen, gehen im Kreis, tanzen, vereinen sich blockartig und lösen sich auf.
Doch was ist der Ertrag? Ein Equilibrist führte da seine Sprachartistifc vor, die allerdings erst durch die Künste des Regisseurs in der Führung der Sprecher nicht monoton, sondern amüsant wirkt. Einen Gehalt gibt es nicht; er wird durch die unentwegte Betonung, daß es ihn nicht gibt, und durch Aggression wider die Zuschauer ersetzt. Das ist Handkes Schelmenstreich.
Vorher sieht man ein Lustspiel, das der 20jährige Lessing schrieb: das Tendenzstück „Die Juden“. Ein Reisender rettet da einem antisemitisch gesinnten Baron das Leben, gibt sich schließlich als Jude zu erkennen, worauf der Edelmann das Unsinnige seines generalisierenden Urteils einsieht. 30 Jahre später blühte diese doch eigentlich selbstverständliche humane Gesinnung im „Nathan“ zu großer Dichtung auf. Auch hier führte Hans Hollmann Regie; außer den Sprechern der „Publikums-beschimpung“, Bernd Ander, Peter Matte, Helmut Schleser und Heinz Zuber, sind hier auch noch Fritz Schmiedel, Ingrid Kohr und Luzi Neudecker eingesetzt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!