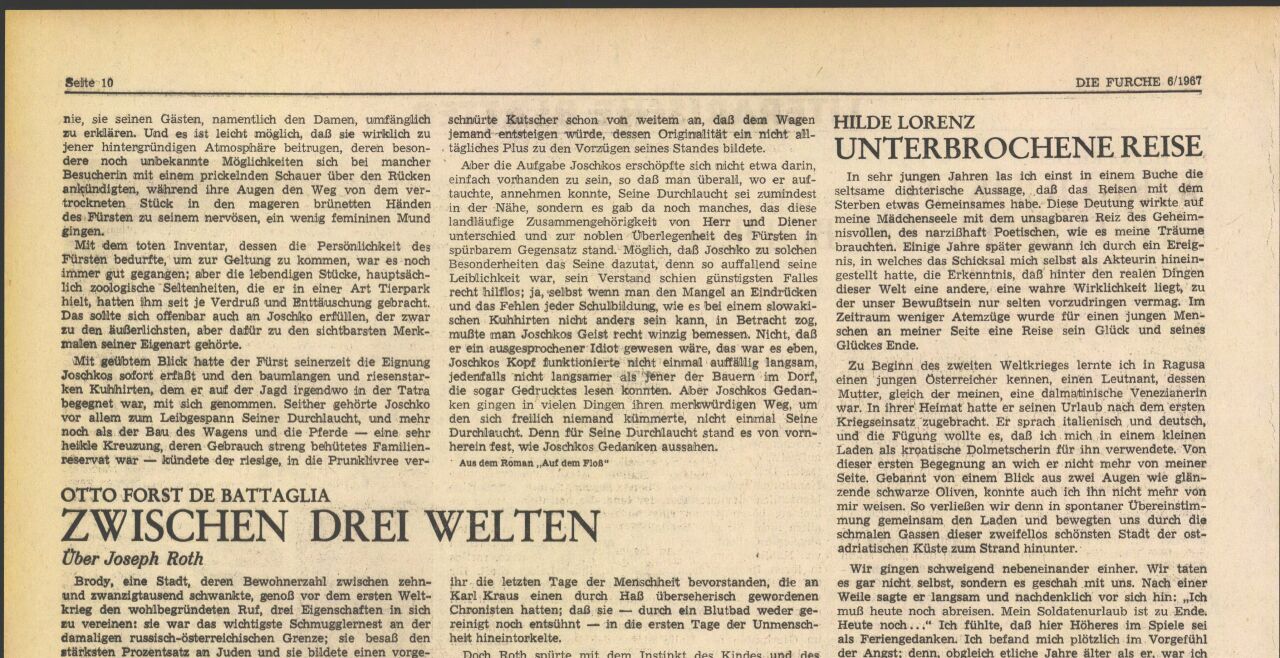
Brody, eine Stadt, deren Bewohnerzahl zwischen zehn-und zwanzigtausend schwankte, genoß vor dem ersten Weltkrieg den wohlbegründeten Ruf, drei Eigenschaften in sich zu vereinen: sie war das wichtigste Schmugglernest an der damaligen russisch-österreichischen Grenze; sie besaß den stärksten Prozentsatz an Juden und sie bildete einen vorgeschobenen Posten deutscher Sprache und Kultur. Die beiden zunächst genannten Vorzüge bedürfen keiner Erläuterung. Was dagegen die Rolle der wolhynischen Handelsmetropole als Feste des Deutschtums betrifft, so sind einige Anmerkungen dringend nötig. Der Gast aus dem Reiche hätte sich in den „aufgeklärten“ Israeliten, die da am Gymnasium für Lessing und Schiller begeistert wurden, kaum wiedererkannt. Sogar die wenigen, meist evangelischen Nachfahren schwäbischer Kolonisten, die in Brody eine Rolle spielten, hatten sehr viel von ihrer polnischen und ruthenischen Umgebung angenommen, wenn sie nicht, wie die führende Familie Hausner, polonisiert wurden. Es war weniger das deutsche Wesen, an dem die sich Weltleute Dünkenden hier zu genesen suchten, denn das österreichische, schwarzgelbe, kaiserliche, habs-burgische, für das die deutsche Sprache ein verbindendes Glied zwischen einem Dutzend Nationen bedeutete, und dem die deutsche Kultur ein Kleid sein mochte, in das gehüllt man Einlaß in den vornehmen Kreis der europäischen Völkerfamilie fand. Eine österreichische Insel im slawischen — polnischen, ruthenischen — Meere und nahe dem russischen Ozean oder, wenn man will, eine Vorstadt des Wiener Judenbezirks, der Leopoldstadt, von ihr durch 800 Kilometer Bahnfahrt getrennt und mit ihr durch die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn verbunden, das war Brody. Und hier ist der österreichische Dichter, der große deutsche Schriftsteller, der liebende und dankbare Gast im französischen Raum, der ewig wandernde, nie eingewurzelte, stets nach einer Heimat begehrende Jude Joseph Roth 1894 geboren, der im bald darauf untergehenden Habsburgerreich und dann im Schöße der katholischen Kirche sich geborgen glaubte.
Uber das Leben des Menschen Joseph Roth, so wie es in trockenen Akten einer weiland k. k. oder jeder Amtsstelle erschien, ist ein duftiger Schleier gebreitet. Der Held hat dafür gesorgt, daß er schon in den Mythos entrückt wurde, als noch Roths zarte Leiblichkeit graziös über Abgründe ein-hertänzelte. In den autobiographischen Bekenntnissen des Poeten ist Wahrheit und Dichtung hart nebeneinander zu lesen. Daß der Vater „ein merkwürdiger Mensch gewesen“ sei, einer, „der viel verschwendete, wahrscheinlich trank und im Wahnsinn starb“, ist durchaus am Schicksal des schwer belasteten Sohnes erhärtet, nicht minder, daß seine Mutter „eine Jüdin von kräftiger, erdnaher, slawischer Struktur war“ und „sehr unglücklich“ (Brief Roths an seinen Verleger G. Kiepenheuer). Weniger überzeugend ist die Not, von der Roth, seiner Lebensbeichte gemäß, in der Jugend umkreist gewesen sein will. Authentische Zeugen berichten vom Neunzehnjährigen, der in Wien aus der polnisch-ukrainischen Legendenaura In die nüchterne der Philosophischen Fakultät kam, daß er, geschniegelt und gestriegelt, das Monokel im Auge, unter den Hörern der Germanistik auffiel, unter denen derlei Eleganz nicht häufig war. In jener Zeit lauschte er den Vorlesungen des genialischen Walther Brecht, des um viele Jahre älteren Bruders Berts; er begegnete dort, heraufbeschworen vom gar nicht akademisch vertrockneten Professor, dem Schatten Heines und dem „ästhetischen Immoralismus“, dann dem polnischen Kollegen Jözef Wittlin, der später ähnliche literarische Wege wandelte wie der recht wenig nach dem bürgerlichen Sittenkodex lebende Joseph Roth. Der spielte mit Wollust das Ebenbild des „Vonerl“, des jungen Herrn aus guter Familie, aus guten Verhältnissen, mit vielen Verhältnissen; und er übertrieb, sowohl was die Familie als auch was die Verhältnisse anlangt. Mit jener Neigung zum Märchen, die Kindern und Poeten eignet. Denn er war, noch und schon, beides: Kind und Poet. Die Welt war bittersüß, wie die Bartsch'schen Liebesgeschichten; sie sah süß aus, wie die Schnitztersoen Wiener Maderln, und sie ahnte nicht, daß ihr die letzten Tage der Menschheit bevorstanden, die an Karl Kraus einen durch Haß überseherisch gewordenen Chronisten hatten; daß sie — durch ein Blutbad weder gereinigt noch entsühnt — in die ersten Tage der Unmenschheilt hineintorkelte.
Doch Roth spürte mit dem Instinkt des Kindes und des Poeten das eine und das andere, ohne sich davon (er war nie ein Rechner) Rechenschaft abzulegen. Es drängte ihn, zusammen mit Freund Wittlin, aus dem Hörsaal ins Feld. Der Krieg war inzwischen ausgebrochen, und junge Leute mit Beziehungen hatten in Österreich nur die Wahl zwischen Kriegspressequartier oder Kriegsarchiv einerseits, dem Heldentum an der Front anderseits. Die beiden künftigen Dichter aus Brody waren naiv (oder klug) genug, sich für die Front zu entscheiden. Joseph Roth sammelte dort abschließende Eindrücke von der sterbenden Donaumonarchie bei der Armee, in deren Lager, ein letztes Mal, Österreich war.
Der „Radetzkymarsch“ steht nicht allein auf weiter Flur. Es gibt ein halbes Dutzend epischer Prosabücher, die das alte Österreich in den Jahren seiner Auflösung schildern. Mit inniger Liebe, die sich hinter kühl-ironischer Sachlichkeit flüchtet, wie bei Robert Musil im „Mann ohne Eigenschaften“, in elegischer Klage und Anklage der „Agnes Altkirchner“ Felix Brauns, mit offen einbekannter leidenschaftlicher Anhänglichkeit, wie in Friedrich Winterhollers „Kaiserhöhe“ und in Richard von Schaukais Novellen und autobiographischen Skizzen, mit der Treue eines in seiner Wunderlichkeit wundervollen Geschichtenschreibers wie Heimito von Doderer. Der Kundige fühlt Sentiment im Ressentiment sogar aus den zornigen Pamphleten Bruno Brehms in „Apis und Este“, „Das war das Ende“ und „Weder Kaiser noch König“ heraus, ja aus der gigantischen Haupt- und Staatsaktion, die Karl Kraus in den „letzten Tagen der Menschheit“ gegen das, zuletzt noch beklagte, Habsburger-Reich gerichtet hat, nachdem dieses bereits von der Weltgeschichte gerichtet und zu leichtlebig befunden worden war. Dennoch wage ich es, für den „Radetzkymarsch“ den Rang als das gerechteste Urteil und als das schönste wortkünstlerische Denkmal für einen Toten zu heischen, an dessen Grab nur zu oft verkündet wurde, der Ermordete, nicht der Mörder sei schuldig. Über die politische Seite dieses außerordentlichen Nachrufs brauchen wir heute, da die Völker der einstigen Donaumonarchie sowohl die Probe aufs Exempel „Lieber Hitler als Habsburg“ als auch auf das „Lieber Stalin als Habsburg“ gemacht haben, keine Worte zu verlieren. Es obliegt mir aber, die an Tiefstes rührende Treue zu einer kaum dem Gedächtnis entschwundenen Wirklichkeit zu rühmen und die malerische, musikalische, suggestive Kraft des Magiers zu preisen, der durch Wort und Satz und eine Erfindungsgabe, die sich gerade an ihrem Tatsachengehalt bewährt, eine ganze Welt vor uns wiedererstehen läßt: beseelt vom ohnmächtigen Willen, eben diese Welt wahrhaft wiedererstehen zu sehen. „Mein stärkstes Erlebnis war der Krieg und der Untergang meines Vaterlandes, des einzigen, das ich je besessen: der österreichisch-ungarischen Monarchie.“ So schrieb mir einst (am. 28. Oktober 1932 aus; Ascona) Joseph Roth im ersten seiner Briefe...
Joseph Roth fand seine letzte Zuflucht In Frankreich. Dorthin hat er seine politische Tätigkeit, seine Hoffnungen, seine Träume mitgeschleppt. Er war Mittelpunkt eines Kreises von Legitimisten und andern Emigranten aus der Habsburger-Monarchie, stand sogar in losem Kontakt mit dem Oberhaupt des Hauses Österreich, gewann aber für das Land, das ihm, dem jetzt doppelt Heimatlosen, Asyl gewährte, immer heißere Liebe, und zugleich sank er mit schamhafter Ergebung, ein seine Laster nicht verleugnender Sünder, der Kirche immer zärtMcher in die, mild geöffneten Arme. Es wäre sehr fesselnd, die Korrespondenz zu durchblättern, die Roth mit dem Jesuitenpater Friedrich Muckermann gepflogen hat. Sie würde nochmals die Parallele zu Max Jacob wecken. Doch wir haben ein holdes, schönes poetisches Geschenk aus jener Verdämmerzeit des von den Dämonen gehetzten, von Engeln erwarteten Todgeweihten. „Die Legende vom Heiligen Trinker“. Sie verlöre ihren Schmelz, versuchten wir, den Inhalt dürr nachzuerzählen, jenes Ineinander der süßen heiligen Therese von Lisieux und eines kleinen französischen Fräuleins, die Wege und Irrwege himmlischer und irdischer Liebe, die Versponnenheit von Wunder und krasser, grober Wirklichkeit. Erschütternd und doch in Harmonie ausklingend ist das letzte Wort des Büchleins, zugleich des Poeten letztes, unerfülltes Flehen: „Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und so schönen Tod.“
Da wir diesen Satz und diese Legende lesen, begreifen wir plötzlich, daß Joseph Roth, Wanderer zwischen drei Welten, von der Judenstadt zur Kaiserstadt und zur Licht arstadt an der Seine, seine Heimat nicht erst verlor, als die Habsburger-Monarchie zusammenbrach. Er war, ein hochbegnadeter, hochverfluchter Poet, niemals und nirgends auf dieser Erde zu Hause. Sein Raum war das Reich des Schönen, des Guten und des Glaubens; seine Zeit aber ist jene Unsterblichkeit, die ihm und seinem Werk verbürgt ist.
HILDE LORENZ
UNTERBROCHENE REISE
In sehr jungen Jahren las ich einst in einem Buche die seltsame dichterische Aussage, daß das Reisen mit dem Sterben etwas Gemeinsames habe. Diese Deutung wirkte auf meine Mädchenseele mit dem unsagbaren Reiz des Geheimnisvollen, des narzißhaft Poetischen, wie es meine Träume brauchten. Einige Jahre später gewann ich durch ein Ereignis, in welches das Schicksal mich selbst als Akteurin hineingestellt hatte, die Erkenntnis, daß hinter den realen Dingen dieser Welt eine andere, eine wahre Wirklichkeit liegt, zu der unser Bewußtsein nur selten vorzudringen vermag. Im Zeitraum weniger Atemzüge wurde für einen jungen Menschen an meiner Seite eine Reise sein Glück und seines Glückes Ende.
Zu Beginn des zweiten Weltkrieges lernte ich in Ragusa einen jungen Österreicher kennen, einen Leutnant, dessen Mutter, gleich der meinen, eine dalmatinische Venezianerin war. In ihrer Heimat hatte er seinen Urlaub nach dem ersten Kriegseinsatz zugebracht. Er sprach italienisch und deutsch, und die Fügung wollte es, daß ich mich in einem kleinen Laden als kroatische Dolmetscherin für ihn verwendete. Von dieser ersten Begegnung an wich er nicht mehr von meiner Seite. Gebannt von einem Blick aus zwei Augen wie glänzende schwarze Oliven, konnte auch ich Ihn nicht mehr von mir weisen. So verließen wir denn in spontaner Ubereinstimmung gemeinsam den Laden und bewegten uns durch die schmalen Gassen dieser zweifellos schönsten Stadt der ost-adriatischen Küste zum Strand hinunter.
Wir gingen schweigend nebeneinander einher. Wir taten es gar nicht selbst, sondern es geschah mit uns. Nach einer Weile sagte er langsam und nachdenklich vor sich hin: „Ich muß heute noch abreisen. Mein Soldatenurlaub ist zu Ende. Heute noch...“ Ich fühlte, daß hier Höheres im Spiele sei als Feriengedanken. Ich befand mich plötzlich im Vorgefühl der Angst; denn, obgleich etliche Jahre älter als er, war ich doch zu unerfahren, um in das Innere dieses durchaus nicht soldatisch aussehenden Jünglings zu schauen. Eine sanfte Hoheit ging von ihm aus und bestimmte alle seine Bewegungen.
Auf seiner Stirne aber wohnte etwas wie Traurigkeit. In Fragen des Seelischen und Ästhetischen war ihm eine außergewöhnliche Verletzbarkeit eigen. Er war ein Ankömmling. Er stand an einem Anfang, vorbereitet für die Invasion des Großen. Seine Phantasie stellte in bezug auf die menschliche Glückseligkeit Forderungen ohne Maß und Grenze. Was liegt schon daran, dafür sein Leben einzusetzen, schien er zu denken. — Wir schwiegen weiter. Da gehorchte er einer plötzlichen inneren Aufforderung und fügte seinen ersteh Worten hinzu: „Ich werde nicht abreisen. Ich werde noch drei Tage bleiben, Ihretwegen bleiben...“ — „Aber das kann Sie ja den Kopf kosten“, rief ich und fühlte mich mitten in ein Drama versetzt. Ich überlegte blitzschnell, ob ich fliehen solle... er würde mich einholen; ob ich mich verstecken solle... er würde mich finden; ob ich mich töten solle... er würde mir folgen. Sein Entschluß stand fest. Er faßte mich an der Hand, zog mich zärtlich, aber mit männlicher Sicherheit an den Strand heran und warf vor meinen weit geöffneten Augen mit pathetischer -: Gebärde seine Uhr in weitem Bogen ins Meer... Der Wurf eines kleinen, weißen Kieselsteins mochte nicht weniger Aufsehen erregt haben. Dann atmete der junge Soldat tief und langsam wie ein Befreiter auf. „Ich habe die Zeit ausgelöscht!“ rief er, und in dieser Verzückung trat er an meiner Seite aus der Zeit heraus... für drei Tage aus der Zeit heraus.
Zum Abschied legte er ein schon abgegriffenes Buch mit dem Titel „Die unterbrochene Reise“ wie ein Vermächtnis in meine Hände. Die Schlußworte der Erzählung aber setzte er als Widmung auf die erste Seite des Buches: „Unvergeßliche Stadt, und du, unvergeßliche Gefährtin dreier beglückender Tage, lebt wohl!“
So gingen wir wieder auseinander; denn „nicht Stellung fördert die Liebe zutage, sondern Sehnsucht, vom Geliebten weg in eine neue Einsamkeit, In der sich jeder sein Leben selbst beantworten muß“.
Ich habe den Freund nie wiedergesehen, habe nie wieder von ihm gehört.
Das Buch beinhaltet eine unserer Begegnung erschreckend ähnliche Geschichte, die mit der Füsilierung des jungen Helden endet




































































































